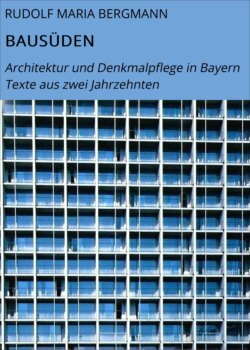Читать книгу BAUSÜDEN - RUDOLF MARIA BERGMANN - Страница 9
EICHSTÄTT Gratwanderungen Bauen im historischen Bestand einer barocken Residenzstadt. Zum 80. Geburtstag des Architekten Karljosef Schattner
ОглавлениеEs gibt einen Spielfilm, eine typische Nachkriegsschnulze, gedreht in Eichstätt, als dort Karljosef Schattner im Jahr 1957 gerade den Aufbau des Diözesanbauamts begonnen hatte. In die unverwechselbaren Agfacolor-Farben wurde die Kleinstadt im Altmühltal getaucht, weil sie den Krieg unbeschadet überstanden hatte. Gleichwohl dokumentiert die Filmkulisse die Blessuren baulichen Niedergangs, der mit der Säkularisation begonnen hatte.
Als der Architekt antrat, war die barocke Bischofsstadt zum Jurakaff verwittert. Damit stand sein Aufgabenfeld fest: Bauen im historischen Bestand. Deshalb nannte er später den großen Hans Döllgast, den Retter der Alten Pinakothek, seinen wichtigsten Lehrer beim Studium in München und dessen Umgang mit demolierter Bausubstanz sein „Grundgesetz“.
Die Voraussetzungen waren günstig: ein aufgeschlossener Bischof als Dienstherr, auf kommunaler Seite ein engagierter Stadtbaumeister, schließlich die Gründung der kirchlichen Gesamthochschule mit solider finanzieller Ausstattung. Der Architekt nutzte das auch als Chance, viele historische Gebäude durch Umwidmung zu retten, die – selbst seitens der Denkmalpflege - zum Abbruch freigegeben waren.
Bislang findet wenig Beachtung, dass der energische Vertreter modernen Bauens entscheidend zum Erhalt des barocken Stadtbilds beitrug. Die Pläne zum autogerechten Ausbau mittels brutaler Schneisen lagen bereit. Es war auch die Auseinandersetzung mit historischer Bausubstanz, in der er seine Handschrift fand. Carlo Scarpa war dafür der zweite wichtige Impulsgeber. Karljosef Schattner präparierte Jahresringe und Stilschichten heraus und baute den Bestand in seiner Sprache weiter. Akribisch dabei seine Trennung der Zeiten, penibel ablesbar die Umstände, die zur Veränderung führten, deutlich erkennbar der Wandel in der Nutzung.
Das Altes als alt und das Neues als neu darzustellen, bedeutete einen unerhörten Bruch mit den Sehgewohnheiten für naive Historisten, für Denkmalpfleger und mehr noch für gläubige Modernisten. Was damals blankes Entsetzen hervorrief, ist heute vorbildlich. Der Ausbau eines alten Stadtpalais zum Fachbereichsgebäude mit dem Bibliothekslesesaal im ursprünglich offenen Innenhof, das zum Universitätsinstitut verwandelte barocke Waisenhaus sind Klassiker des Metiers.
Aus dem langen Werkverzeichnis wird man aber zukünftig ein Hauptwerk streichen müssen: Die zerstörerische Veränderung des Jura-Museums, ausgezeichnet 1977 mit einem BDA-Preis, hat begonnen. Es entstand durch den Umbau von Teilen der maroden Willibaldsburg über der Stadt. Der Architekt hielt die unterschiedlichen Erhaltungszustände der Räume fest, zog aber notwendige Stahlbetondecken sichtbar ein. Zum umfassenden Entwurf gehören alle Einbauten, Vitrinen und Stellwände, sogar Objektpräsentation und Beschriftung. Nur darauf gründet der internationale Ruf des Museums. Die Atmosphäre erwächst im Zusammenklang des rohen Sichtbetons, weiß gekalkten Gemäuers, dunkel überfangener diaphaner Einbauten mit punktuell ausgeleuchteten Objekten und dem rotbraunen, schwarz verfugten Klinkerboden. Leitmotiv der Inszenierung ist das Staunen: Über das Walten der Natur in den gezeigten Fossilien, den Lauf der Geschichte, abzulesen im Gebäude, und die Möglichkeiten der Kunst, sichtbar in der Arbeit des Baumeisters. Das sind Grundelemente jener Jahrhunderte alten Gattung der Kunst- und Wunderkammer, als deren moderne Interpretation man das Museum begreifen muss.
Die neue Museumsleiterin kümmert das nicht. Mit brachialem Profilierungswillen rückt sie dem Gesamtkunstwerk zu Leibe. Im besonders gerühmten Eckraum mit dem teilrekonstruierten Gewölbe wurden schon alle Einbauten entfernt, auch die abgehängte durchlaufende Schiene mit Lichtquellen, die als materialisierte Führungslinie diente und den Rhythmus der Räume grafisch nachzeichnete. Den ursprünglichen Fußboden ersetzen helle Solnhofer Platten, die zum Raum in keiner Beziehung stehen. Den Architekten hat sie nicht informiert und verweigert Auskünfte über ihr Konzept.
Während man andernorts alles tut, um mit Museumsbauten von renommierten Architekten Aufmerksamkeit zu erregen, zerstört man in Eichstätt dergleichen achtlos. Lieber verkauft der Tourismus dröge Konzepte einer gemütlichen Vergangenheit. Ohnehin nimmt man Karljosef Schattner nur so weit zur Kenntnis als unbedingt nötig. Aus seiner Baukunst ist kein bequemes historisches Kapital geworden; sie hat nichts von ihrer provokanten Modernität verloren, von der verstörenden Klarheit, die nur großartige Werke auszeichnet.
Zum Kern der Erfahrung solcher Kunst gehört ja, dass wir uns durch sie mehr vorstellen können als vorher. Das muss freilich nicht zwingend der Fall sein. Eichstätt führt seit geraumer Zeit vor, dass es sich auch bauen lässt, wenn man Schattners Kunst nicht einmal ansatzweise kapiert. Willig ebnen architekturresistente Kommunalpolitiker einer baulichen Peinlichkeit nach der anderen den Weg.
Dabei hatte der Architekt seiner Stadt nicht allein die Verwirklichung einer städtebaulichen Vision geliefert. Die räumliche Integration der Universität in die Stadt verstand er auch als intellektuelle Herausforderung an sie. Aber das wurde nur als zusätzliche Einnahmequelle begrüßt. Studenten äußern sich begeistert über Ausstattung und Qualität der Katholischen Universität, wütend über die Wohnungsknappheit, frustriert über das unsäglich provinzielle Kulturangebot.
Um so bedeutender ist Karljosef Schattners Leistung, weil es ihm trotz aller Hemmnisse in solcher Atmosphäre gelang, ein Bauen zu verwirklichen, das modern und nicht modisch, identitätsstiftend und nicht beliebig ist. Er hätte auch den Begriff Provinz neu justiert, wäre ihm Eichstätt nur etwas entgegengekommen.
[8.2004]