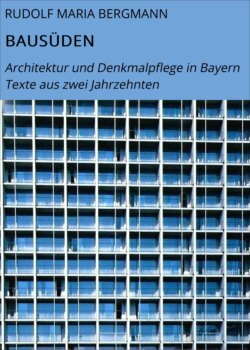Читать книгу BAUSÜDEN - RUDOLF MARIA BERGMANN - Страница 7
EICHSTÄTT Im Kleinen groß Zu einem neuen Atelierhaus in einer alten Stadt
ОглавлениеParadiese gibt es nicht, nicht einmal in der Provinz. Nehmen wir Eichstätt, zum Beispiel, die Kleinstadt im Altmühltal, besser gesagt: diesen europäischen architektonischen Ausnahmezustand. Trotz viel gelobter und ausgezeichneter neuer Architektur kämpft die Bischofsstadt mit allenthalben bekannten Problemen: Einkaufszentren an der Peripherie trocknen den Einzelhandel im Zentrum aus, Arztpraxen und Büros verknappen dort den Wohnraum. Die Folgen sind absehbar. Und natürlich träumt man sich auch in Eichstätt gern retour in eine aufgehübschte Vergangenheit, beispielsweise mit dem kulinarischen Dialog von der mundgeblasenen Butzenscheibe und duftigem Barokoko an ökologisch wertvollen Sonnenkollektoren. Mutige Bauherren haben es in solcher Atmosphäre nicht leichter als anderswo. Denn auch an der Altmühl herrscht die Denkmalpflege als absolutistische Bewahranstalt über die Historie und ein Jurahausrettungsverein verwaltet das Interpretationsmonopol für Hausgestaltung. Zeitgenössisches gilt beiden ausdrücklich als Störfaktor. Der Bildhauer Günter Lang ließ sich davon nicht schrecken.
Lange gehörte das Stadtquartier am Salzstadel nicht eben zu Eichstätts piekfeinen Ecken. Vergeblich hatte man über Jahre versucht, durch gezielte Eingriffe die Wohnqualität zu heben. Die Denkmalpfleger waren noch begeistert, als Günter Lang vor zwölf Jahren sein Geburtshaus, ein satter Bau aus dem 17. Jahrhundert, historisch korrekt liften ließ, aber natürlich entsetzt, als er schließlich das ruinöse Jurahaus vis-à-vis kaufte, um es durch einen Atelierbau ersetzen zu lassen. Gleichwohl wertet nun ausgerechnet dieser Neubau das ganze Karree zu einem neuen kulturellen Treffpunkt auf und trägt zur Belebung der Innenstadt bei.
Dem Eichstätter Architekturbüro Diezinger und Kramer gelang das Kunststück mit einem kleinen Haus. Klein, doch ganz und gar nicht unbedeutend, im Gegenteil: Ein gebautes Manifest der Schlichtheit, ein Plädoyer für die Reduktion. Weil ohnehin nichts schwerer fällt als das Einfache, entsteht dabei nur im besten Fall Architektur. Hier zum Beispiel.
Das Atelierhaus ordnet sich der gebauten Umgebung unter, indem es im Grund- und Aufriss den Konturen des Vorgängerbaus folgt. Traufe, First und Dachneigung zitieren in Maßstab und Proportion den Typus des Altmühltaler Jurahauses. Weiter geht die Referenz an die regionale Bautradition aber nicht.
Die Dreigeschossigkeit des niedrigen Altbaus wurde zu Gunsten einer saloppen zweigeschossigen Aufteilung mit großzügig bemessenen Räumen aufgegeben. Obwohl jedes Geschoss nur über 75 Quadratmeter Grundfläche verfügt, wirkt das Haus überraschend weitläufig. Dieses Kunststück gelang, weil der Kubus innen räumlich erfahrbar bleibt, indem alle Außenwände und Dachflächen eine scharf umrissene homogene Hülle bilden.
Im Erdgeschoss wurde ein kleinerer Ausstellungsraum wie eine Schaufensterkoje proportioniert. Intim ist die Atmosphäre hier und dennoch von luftiger Weite, weil das Obergeschoss wie eine Empore den Blick nach oben freigibt. Der größere Raum dahinter, um die drei Stufen des Treppenantritts angehoben, lässt sich mit wenigen Handgriffen zur abgeschlossenen Gästewohnung umfunktionieren: Hinter Schranktüren verbergen sich Küchenzeile und Nasszelle.
Die filigrane Treppe mündet unmittelbar im geräumigen Atelierraum des Künstlers. Ungeteilt und offen bis unter den First, ist das Obergeschoss ein Ort von lapidarer Schönheit. Noch größer als der Raum ohnehin schon ist, lässt ihn ein eingestellter Holzcontainer erscheinen, der über dem Eingangsbereich zu schweben scheint und als Haus im Haus wiederum eine Nasszelle verbirgt.
Die Fassaden sind in ihrer Grundauffassung den Jurahäusern nicht unähnlich, so weit es um das Verhältnis von Wand und Öffnung geht. Gleichwohl sind sie aber auch völlig anders durch den Verzicht auf jegliche Symmetrie. Einzig die Erfordernisse in den Räumen bestimmten Platzierung und Größe der Fensterausschnitte, die zwanglos aus dem Kubus geschnitten sind. Insofern erzählen sie außen nichts vom Innenleben des Hauses, während sie drinnen das Draußen in ästhetisch inszenierte Ausschnitte zerlegen. So projiziert ein stehendes Fenster, das in der Eingangsfassade schwimmt, das Bild der Hauswand gegenüber in den oberen Raum. Das Eckschaufenster im Erdgeschoss setzt hingegen einen markanten Akzent im Straßenraum. Damit wird zugleich auf ein Leitmotiv Eichstätter Architektur angespielt, den „blickführenden Erker“, wenngleich im umgekehrten Sinn: Nicht um den Ausblick geht es hier, sondern um den Einblick in einen Ausstellungsraum.
Die ungeteilten Fenster sitzen bündig auf der Außenwand, schmale schwarze Einfassungen nobilitieren sie zu transparenten Bildern im edlen Grau der Fassaden. Sie fungieren als Membranen und Flächen vielschichtiger Projektionen des Inneren nach draußen und des Außen nach drinnen. Kommunikation wollen sie befördern, Gedankenaustausch, den der Hausherr sucht.
Die Eingangstür, in die Mauertiefe eingelassen, signalisiert den öffentlich zugänglichen Raum sinnfällig. In Maß und Proportion bezieht sie sich ausdrücklich nicht auf die Fenster, nicht einmal ihre Höhe nimmt Bezug auf das Schaufenster gegenüber. Trotz weniger Elemente wirkt die Fassade dadurch lebendig. Fläche und Volumen, geschlossene Wand und Öffnung inszenieren ein kontradiktorisches Zusammenspiel. Die Traufseiten geben sich dagegen einsilbig, beinahe monoton, weil nur die Eingangsfassade zum Haus und dem öffentlich begehbaren Stadtraum gehört und im Kontext der Umgebung das Stadtquartier prägt. Sie bildet ab und ist selbst ein Bild. Merkwürdig vertraut wirkt dabei das Eckschaufenster: Gestattet ist die Erinnerung an eine Ikone der amerikanischen Malerei, Edward Hoppers Gemälde „Mitternachtsvögel“.
[11.2001]