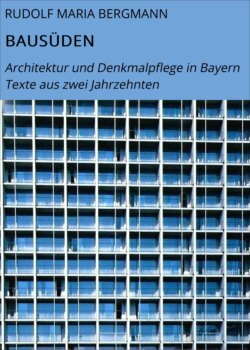Читать книгу BAUSÜDEN - RUDOLF MARIA BERGMANN - Страница 8
EICHSTÄTT Eichstätt baut aus Tradition modern BDA-Preis Bayern 1997 für Diözesanbaumeister Karl Frey
ОглавлениеWenn Tradition nicht einfach das alte Schöne ist, kein Antiquariat, sondern eine lebendige Reihe, in der wir stehen, wie Peter Bichsel in dieser Zeitung schrieb (FR vom 28.Dez.1996), dann illustriert Eichstätt das aufs schönste. Die Baumeister des Barock formten über den Ruinen des Dreißigjährigen Kriegs ein städtebauliches Gesamtkunstwerk im Rekurs auf mittelalterliche Lokaltradition, das Charakter und Stil gerade aus dem individuellen Habitus der Architekten bezieht. Und in unserer Zeit stellten auf den Scherben der Säkularisation Josef Elfinger und Karljosef Schattner die Weichen für eine moderne Architektur unter Berücksichtigung der barocken Struktur. Daraus ist längst wieder eine passgenaue Architekturkorsage von hohem Rang geworden, getragen zunächst von Karljosef Schattner, mittlerweile ausgefüllt von vielen Anderen.
Seit 1992 leitet Karl Frey das Diözesanbauamt. Er ist zwar Schattners Nachfolger im Amt, aber nicht in der Haltung. Wie die barocken Baumeister hegt er größten Respekt für die Arbeit des Vorgängers, aber seine Handschrift ist eine andere. Wie Schattner tut uns auch Karl Frey nicht den Gefallen, den Glamour des Stararchitekten mit ins Amt zu bringen, sondern grundsolide Voraussetzungen: Architekturstudium an der TU München, Mitarbeit im Büro von Josef Elfinger, ein städtebauliches Aufbaustudium. Stadtbaumeister von Eichstätt seit 1983, war er Schattner ein kongeniales Pendant und suchte dessen hohem Niveau mit dem Stadtbild zu entsprechen. Zwar musste er im Kampf gegen spießbürgerlichen Horror vacui und Schrebergartenmentalität manche Niederlage einstecken, aber jedenfalls konnte er bedeutenden Kollegen den Weg nach Eichstätt ebnen. Günter Behnisch & Partner, Diezinger & Kramer, Hilmer & Sattler, Theodor Hugues, Eberhard Schunk, Werner Wirsing: Eichstätt wächst an und in der Rolle eines Zentrums für Gegenwartsarchitektur, eine Kleinstadt von 12000 Einwohnern. Vorläufiger Höhepunkt für Karl Frey und seine Mitarbeiter sind zwei Auszeichnungen beim BDA-Preis Bayern 1997. Die Teilbereichsbibliothek 2 der Katholischen Universität erhielt einen (ersten) Preis, die Erweiterung und Sanierung des Orbansaals der Canisiusstiftung in Ingolstadt bekam eine Anerkennung (ein zweiter Preis). Wenn man bedenkt, dass unter 111 eingereichten Arbeiten die Jury nur sieben erste Preise vergab, wovon zwei nach Eichstätt gingen, spricht das eine deutliche Sprache. Der Preis versteht sich übrigens auch als Auszeichnung für den Bauherrn; in Eichstätt ist das in beiden Fällen die katholische Kirche, in Person von Bischof und Domkapitel.
Der neue Bibliotheksbau komplettiert die universitäre Bücherlandschaft, die mit zwei Bauten Schattners und der Zentralbibliothek von Behnisch & Partner eh schon fulminant bestückt ist. Wer die aberwitzigen Betonburgen deutscher Universitätsbauämter durchlitten hat, traut in Eichstätt seinen Augen nicht. Zu einem guten Teil ist das auch ein Verdienst des Bibliotheksdirektors Hermann Holzbauer. Dem bibliophilen Gelehrten sind Bücher Gegenstand sinnlichen Vergnügens, kein Stapelproblem. Deshalb kam er noch jedem Architekten mit der dezidierten Forderung nach wohnlicher Atmosphäre. Karl Frey stand ein Terrain unmittelbar vor der historischen Stadtmauer zur Verfügung, das partiell noch mit Gebäuden der ehemaligen fürstbischöflichen Hofstallungen bebaut war. Er schälte die historische Bausubstanz aus späteren Anbauten heraus, richtete in der früheren Reithalle den Lesesaal ein und schob rechtwinklig den neuen Magazintrakt mit zusätzlichen Arbeitsplätzen hinaus, parallel zur Stadtmauer. Der großartigen Raumwirkung des Lesesaals verhelfen sensibel hineinkomponierte Einbauten zu fast mediativer Kraft. Indem sie deutlich von der Raumschale abgerückt bleiben, ordnen sie sich dem Überkommenen unter. Sie machen es nicht der eigenen Inszenierung dienstbar, vielmehr dienen sie dem historischen Kontext. So konsequent sich Karl Frey in die alte Bausubstanz fügt, so energisch stellt er ihr seine Architektur entgegen. Sie entwickelt Proportion und Rhythmik aus der gebauten, gewachsenen Umgebung, sie ist immer als Teil einer gesamtstädtischen Lösung gedacht. Ihre Form allerdings wird einzig aus der Funktion herausmodelliert. Die ästhetische Strahlkraft bezieht sie ganz aus sich selbst, nie über die szenische Einbindung historischer Versatzstücke. Frey respektiert das Alte viel zu sehr, um es anzutasten und verleiht ihm gerade aus seiner distanzierten Haltung neue ästhetische Prägnanz. Konsequent rückte er den Magazinbau von der Stadtmauer ab, zeigt das auch im Innenraum: Der neue Fußboden bricht ein gutes Stück davor ab, der neuralgische Streifen wird von oben durch das verbindende Glasband beleuchtet. Weil das Pultdach unter der Krone der Stadtmauer ruht, respektiert es dessen stadträumliche Ordnungsfunktion. Dem vorspringenden Turm zollt das gläserne Treppenhaus Respekt, indem es noch unter der Traufhöhe des Neubaus bleibt. Nur im Erdgeschoss stoßen seine hochrechteckigen Glasfelder durch den Sockel in den Magazintrakt vor. Dessen Kubus, höher und tiefer, schiebt sich darüber. Die bündig liegenden Fensterbänder markieren Arbeitsplätze. Gleichzeitig spielt sich der lang gestreckte Bau gegen das aufsteigende Treppenhaus aus und bricht mit dem historischen Trakt. Aus dem Spiel mit Gegensätzen erwächst in einem komplexen Beziehungsgeflecht eine Architektur von konzentrierter Reduktion. In ihrer ruhigen, subtilen Selbstverständlichkeit steht die Architektur von Karl Frey scheinbar schon immer da.
[11.1997]