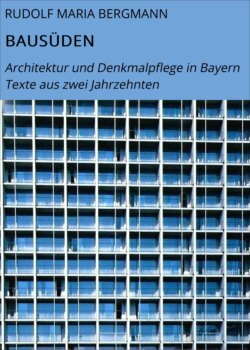Читать книгу BAUSÜDEN - RUDOLF MARIA BERGMANN - Страница 11
FRÄNKISCHE LANDSYNAGOGEN Erinnerung, Geschichte, Gegenwart Schicksale von Synagogen in der Provinz seit 1945
ОглавлениеIn den siebziger Jahren kam es in Deutschland erstmals nach dem Ende des Nationalsozialismus zu einer breiten Beschäftigung mit jüdischer Historiographie. In ihrem Gefolge wurden Dorf- und Kleinstadtsynagogen als Objekte der Lokalforschung wieder salonfähig. Wegen der engen, kleinteiligen Baugefüge hatte man sie in der Pogromnacht zum 10. November 1938 nicht niederbrennen können. Sonst war damals alles nach Plan gelaufen: Die Innenräume verwüstet, die jüdischen Mitbürger in Konzentrationslager abtransportiert, ihre Geschäfte und Häuser geplündert. Einzelfälle belegen übrigens, dass mutiges Einschreiten den Vandalismus durchaus verhindern konnte. Meistens beteiligte sich aber die Bevölkerung an den Plünderungen. Und auch für die Landjuden bedeutete das Pogrom die endgültige rechtliche Ausgrenzung aus der Gemeinschaft, den letzten Schritt vor der Wannseekonferenz am 20. Januar 1942. Was uns nicht daran hindert, nach wie vor von der „Kristallnacht“ zu schwatzen, wie Josef Goebbels süffig soufflierte.
Das Landjudentum ist typisch für das deutsche Judentum der Neuzeit. Seit den Pogromen und Vertreibungen im Mittelalter lebten die Juden über Jahrhunderte in ländlichen Siedlungen der Territorialherrschaft. Ihre Geschichte ist ein integraler Bestandteil der deutschen Geschichte. Weil nach ihrer Ausrottung nur Weniges blieb, sind die erhaltenen Synagogen umso wichtiger. Deren architektonische Analyse dokumentiert das Verhältnis im jahrhundertelange Miteinander von Juden und Nichtjuden: Zeiten des Miteinander, Assimilationsbestrebungen, Suche nach eigenem Stil und Identität, Darstellung gewonnenen Selbstbewusstseins, Not und Terror. Virulenter können Geschichtsdokumente nicht sein.
Die Architektur der Landsynagogen folgte bis ins frühe 19.Jahrhundert lokalen Gepflogenheiten. Erst die anschließende Stildiskussion verordnete ihnen orientalisierendes Vokabular, das freilich so authentisch blieb wie Mozarts Serail. Friedrich von Gärtner schuf mit der Synagoge von Ingenheim, Pfalz (um 1830, 1938 zerstört) den Prototyp. Im Ringen um eine spezifische Form entstanden beachtliche Bauten. Dennoch hatte sich die deutsche Kunstgeschichte vor 1933, auf höchstes Niveau geführt von jüdischen Gelehrten, für das Thema nicht sonderlich erwärmen können. Und Richard Krautheimers Habilitation über mittelalterliche Synagogen, 1927 bei Richard Hamann in Marburg, kam bereits zu spät: Andere hatten den Juden K. schon nicht mehr habilitieren wollen. Seine These, mangels eigenen Formapparats sei der Synagogenbau ausschließlich reaktiv im Rekurs auf christliches Formvokabular erfolgt, letztlich getragen von der Idee eines nationalistisch-jüdischen Kunststils, wirkte durch die intendiert mitschwingende Zweitklassigkeit auf die Forschung nicht eben befruchtend. Tatsächlich folgten aber schon mittelalterlichen Synagogen denselben räumlichen Dispositionen zur Umsetzung der kultischen Anforderungen, im lokalen Gewand und im Rekurs auf das soziale Umfeld. Und nur ein Synagogenraum ist getragen von der Spannung zwischen Sakralem und Profanem, resultierend aus der ambivalenten Nutzung.
In den früheren Siedlungsschwerpunkten des Landjudentums, den südlichen Bundesländern, nahmen sich zunächst Bürgerinitiativen der Synagogen an. Den ersten Höhepunkt erreichte die Bewegung 1988, zum 50. Jahrestages des Novemberpogroms. In diesem Zusammenhang muss man eine Reihe von Publikationen sehen, die erste Regionalinventare jüdischer Kulturdenkmäler versuchten. Von exemplarischer Bedeutung ist hier die Untersuchung von Thea Altaras über den Synagogenbestand in Hessen. Mit ihrer Fragestellung „Was geschah seit 1945?“ kam sie zu einem bestürzenden Ergebnis, das sich in anderen Bundesländern bestätigt, alten wie neuen: Synagogen, die irgendwie ins Jahr 1945 gekommen waren, hat man in allergrößtem Ausmaß über Jahrzehnte weiter zerstörend verändert oder abgerissen. Sogar Bauten von erheblicher architekturhistorischer Relevanz traf die Spitzhacke noch in den achtziger Jahren. Eduard Bürkleins Synagoge in Heidenheim (Mittelfranken) von 1853, wurde 1988 für den Parkplatz einer Bank abgeräumt.Vergangenheitsbewältigung mit der Abrissbirne: Keusch verschweigen die Gedenktafeln die Niederlegungen. Viele Synagogen wurden beim Umbau nach 1945 schlimmer zerstört als im November 1938. Und überhaupt die neuen Nutzungen: Nicht nur Wohnhaus, auch Schweinestall oder Bank, Getränkehandlung oder Nachtklub. Kein Schnee von gestern: Die Sanierung der stattlichen barocken Synagoge von Hüttenbach (Kitzingen) als Wohnhaus beginnt eben erst. In diesem Zusammenhang konnte Thea Altaras nachweisen, dass bei der Zweckentfremdung die Beseitigung der baulichen Merkmale in jedem Fall wichtiger war als der zweckmäßige Umbau.
Die Denkmalpflege entdeckte die Bauten spät, oft zu spät. Längst sind nicht alle erfasst, längst nicht alle erfassten stehen unter Denkmalschutz, längst nicht alle geschützten werden erhalten. Einzig Hessen hat konsequent alle dokumentierten Bauten unter Denkmalschutz gestellt.
Allerdings: auch die jüdischen Kultusgemeinden zeigen oft kein Interesse an diesem Erbe. Natürlich ist an eine religiöse Nutzung der entweihten Gebäude nicht zu denken, schon weil in den Orten keine Juden mehr leben, aber der Erinnerungswert und die kulturhistorische Bedeutung sind für alle Nachgeborenen, egal welchen Glaubens, enorm. Und immer mehr ausländische Juden machen sich hier auf die Spuren der Vorfahren.
Der fortschreitenden Zerstörung steht eine wachsende Zahl von Sanierungsprojekten gegenüber, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das geht meistens so: Privatinitiativen geben den Anstoß, Verwaltung, Denkmalpflege und Politik ziehen nach. Als Nutzung wird anvisiert „ein Ort der Toleranz und Versöhnung“ und „angemessener“ kultureller Veranstaltungen. Man versteht sich als „Begegnungsstätte“, wobei die Frage, wem noch zu begegnen sei, oft verblüfftes Schweigen auslöst. Eine Dokumentation zur lokalen jüdischen Gemeinde ist selbstverständlich, ihre Wechselwirkungen mit der christlichen Mehrheit sind kein Thema. Um die Klärung von Einzelschicksalen in Konzentrationslagern bemüht man sich, Fragen nach dem Verbleib jüdischen Eigentums stellt man hingegen nicht. Zur Darstellung der „jüdischen Kultur“ dienen Kult- und Ritualgegenstände, die zwangsläufig das Thema auf die Religion reduzieren. Juden erscheinen so als religiös-exotische, kulturell isolierte Gruppe jenseits der Gesellschaft, mit über Jahrhunderte konstanten Merkmalen. Ein kurzer Blick in die deutsche Geistesgeschichte könnte hilfreich sein. Fehlen lokale Objekte, erwirbt man im Kunsthandel Beliebiges, wobei die starke Nachfrage einen florierenden grauen Antiqitätenmarkt entstehen ließ. Bernhard Purin, Leiter des Jüdischen Museums Franken, wies darauf hin, dass man genauso „Weihnachtsbaum und Osterei, Gebetsbuch und Weihwasserkessel zu den alles erklärenden Determinanten christlichen Lebens der letzten Jahrhunderte“ erheben könne. Im Museumskomplex um die ehemaligen Synagoge in Schnaittach bilden deshalb Sachzeugnisse im Gebrauchszusammenhang einen Schwerpunkt.
Bei der Gebäudesanierung stellt sich die denkmalpflegerische Kernfrage: Welchen Bauzustand konservieren? Vor dem Pogrom von 1938 oder danach? Beseitigung der Verwüstungsspuren oder deren Dokumentation? Weil unser Bild von der Geschichte auch geprägt ist von den Bedürfnissen der Gegenwart, hat der Rückbau Konjunktur. Als Hinweis auf den Massenmord genügen ein paar Accessoires der Betroffenheit. Veitshöchheim zum Beispiel: Die Synagoge, zwar 1938 nicht geschändet, wurde wenig später beim Umbau zum Feuerwehrhaus innen völlig zerstört. Davon ist nach der Restaurierung nichts geblieben. Nachrichten von neuerdings brennenden Synagogen und wachsendem Antisemitismus relativieren sich da wie von selbst. Aufarbeitung als Wiedergutmachung an der Architektur? Geschichtsfälschung oder Dokumentation eines ausgerotteten Stücks deutscher Kultur? Denn welcher Nichtjude weiß Genaues über eine Synagoge?
Ganz anders sieht man die Dinge in Baisingen, unweit Tübingen. Die Synagoge, 1938 verwüstet, diente bis in die siebziger Jahre landwirtschaftlichen Zwecken. Nach der Sanierung werden alle Verwüstungen und Veränderungen sichtbar bleiben, auch der herausgerissene Fußboden und das später eingebrochene Scheunentor. Das denkmalpflegerische Konzept steht bislang einzigartig da, es versteht sich bewusst als neuer Weg im Umgang mit dem gemeinsamen Erbe, als Versuch zur Dokumentation der „ganzen“ geschichtlichen Wahrheit am Denkmal.
Zwischen diesen Eckpunkten bewegen sich alle Initiativen und die Positionen jüdischer Kultusgemeinden. Unterschiedliche Lösungen sind möglich, aber wenigstens das respektvolle Bewahren aller ehemaligen Kultstätten sollte selbstverständlich werden. Thea Altaras: „Außerdem gibt die unterschiedliche Behandlung der vorhandenen ehemaligen Synagogen, ihre Umwandlung in Museen und Stätten der Begegnung oder ihre konsequenten Umbauten sowie der Abbruch, Aufschluss über die verschiedenartige Auffassung und das Verantwortungsbewusstsein sowohl einzelner Bürger als auch der zuständigen Behörden. Dadurch können aus dem Schicksal der stehen gebliebenen ehemaligen Kultstätten wichtige Hinweise für das zukünftige Leben der Juden in Deutschland entnommen werden.“ Angesichts wachsender religiöser Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit kommt noch eine Dimension dazu.
[06.2008]