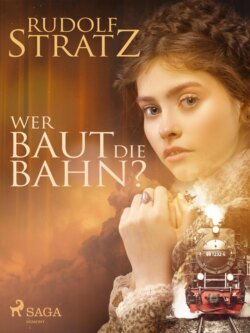Читать книгу Wer baut die Bahn? - Rudolf Stratz - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9
ОглавлениеIn dem heissen, von Rauch bläulichen, von Fessen rotschimmernden Tingeltangel beendete eben das böhmische Damenorchester schmetternd den Fatinitzamarsch. Die Kapellmeisterin stand feurig, schwarzäugig, vor ihrer Schar, in einem Kopftuch aus bunten Glasperlen, weissleinene Puffärmel an der farbigen Jacke, mit einer geblümten Schürze und hohen roten Saffianstiefeln.
Sie senkte den Taktstock wie einen Degen zum Dank gegen das südliche Geprassel der Handflächen. Nur ein pariserisch elegant in Taubengrau gekleideter, schmächtiger Grieche lass teilnahmlos allein an einem Tischchen. Seine regelmässigen, von einem kleinen schwarzen Schnurrbart beschatteten Züge waren ohne Ausdruck. Seine dunklen Augen leer, tief in sich glühend.
Mit dem Riefendiamanten in seinem mattgoldenen Seidenschlips hätte man den ganzen Kristallpalast kaufen können. Scheue Blicke geldgieriger Andacht fielen rings auf ihn. Jedes Kind in Pera kannte den Sohn des Stiefelputzers von Saloniki, den Schrecken aller ehrbaren Kaufleute der Levante, den grössten aller Abenteurer zwischen Alexandria und Odessa — jedes Kind kannte Lamba, den reichsten der Griechen — Palamidi Lamba, dem der weisse Palast draussen am Bosporus, gegenüber dem Dorf Ortaköi, und in dem Palast die dunkeläugige Charis, die schönste der Levantinerinnen, gehörte.
Alphonse Brigolaud, obwohl im Frack einem Diplomaten des vornehmen Cercle d’Orient nebenan ähnlich, stand ehrerbietig vor dem gefürchteten Millionär, so, als sei er, der Oberkellner, nur rasch, in blossem Kopf, aus dem Restaurant Lebon herübergekommen, um die Befehle der Eccellenza für ein späteres Souper dort entgegenzunehmen. Er sagte leise, mit dem Lächeln des Vertrauten:
„Kein Augen heute für Mademoiselle Mucki?“
Die Slavacek, die Kapellmeisterin, war als die „Mucki“ seit fünfzehn Jahren mit ihrer Damenkapelle in den Häfen des östlichen Mittelmeeres bekannt wie ein bunter Hund. Wenn sie nach Konstantinopel kam, war sie die Freundin Lambas. Das stand ein für allemal fest. Aber der Levantiner murmelte mit einem widerwilligen Zucken der Unterlippe:
„Wann wird man diese alte Ziege schlachten?“
Und dann leidend, in sich verbissen, mehr zu sich als zu dem Oberkellner vor ihm:
„Es ist nur eine Gewohnheit, dass ich hier sitze! Ich habe heute im Meer ein Mädchen gesehen — ein Mädchen wie die Sonne — das Haar golden wie die Sonne — tief — tiefblau wie das Meer die Augen . . .“
Der vornehme Frackträger wechselte diskret das Gespräch. Er versetzte absichtlich laut:
„Hühnerbrust in Milch . . . Sehr wohl!“ und flüsternd, während er anscheinend notierte: „Nachricht aus dem Konak Schükri: der Marschall empfängt in acht Tagen Herrn Buddenhaus. Das Paris-Petersburger Syndikat ist auf dem Marsch zur Macht!“
„Zum Nachtisch Maiskörner mit Maulbeersaft!“ Lamba, der griechische Übermillionär, stand hastig auf. Ohne einen weiteren Blick nach seinem Agenten, dem Oberkellner, und der Kapellmeisterin, verliess er das Café chantant. Er eilte weiter die Grande Rue hinauf und betrat nach zwei Minuten, auf der linken Strassenseite wie der Kristallpalast, die prunkvollen Räume des Cercle d’Orient.
Er sah in dem feudalen Konstantinopeler Diplomatenklub um sich die gesellschaftliche Creme aller Nationen Europas, er fühlte an jeder Bewegung der vornehmen Franken, die da sassen, lasen, assen, konversierten, die Jahrhunderte alte Selbstverständlichkeit abendländischer Gesellschaftskultur. Er ahnte die exklusive Unauffälligkeit der Kleidung — keine traubenbeerengrossen Diamanten — keine farbentrunkenen Schlipse — keine schwarzen Fussspiegel von Lackstiefeln.
Auf ihn, den Levantiner, der von den Galgenphysiognomien des Kristallpalastes kam, machte das keinen Eindruck. Europa sagte ihm nichts. Für ihn war Pera das Paradies und das Ägäische Meer die Welt. Er hätte gar keine Sehnsucht gehabt, sich zwischen diesen Honourables und Marquis und Durchlauchten des ihm ewig fremden Okzidents zu langweilen. Aber selbstverständlich war ein Mittelmeermischling seines Rufes trotz aller seiner Millionen nicht Mitglied des Cercle d’Orient, sondern nur für diesen Abend zu einer Besprechung hierhergeladen, und der, der ihn bestellt hatte, noch nicht anwesend.
Lamba durchschritt die Säle. Er kannte niemanden, und niemand nahm von ihm Notiz, obgleich manche wussten, wer er war, oder weil sie es wussten. Er setzte sich dahin, wo er als halber Grieche allein Anschluss finden musste — zum Dritten Sekretär der griechischen Gesandtschaft. Der distinguierte Hellene war nicht gerade erbaut. Er wollte wenigstens, als Diplomat, das unterirdische Wissen dieses gefährlichen Menschen nutzen. Er frug beiläufig, wie um überhaupt etwas zu sagen:
„Haben Sie in letzter Zeit zufällig etwas von dem türkischen Thronanwärter, diesem nach Griechenland geflüchteten Prinzen, gehört?“
„Er soll bei euch aus Korfu verschwunden sein!“ sagte Lamba gequält.
„. . . und sich irgendwo drüben in Stambul verborgen halten. Man ist mehr als nervös im Jildis-Kiosk!“
Der Levantiner antwortete nicht. Er starrte fiebrig unruhig vor sich auf den kostbaren Joraghanteppich.
„Und dieser gestürzte Hofintendant des Sultans, Fuad Pascha . . .?“ fuhr der Gesandtschaftssekretär fort und unterdrückte ein scheinbares Gähnen der Teilnahmlosigkeit.
„. . . ist aus Damaskus geflohen!“
„Sie hörten es auch? Was bedeutet das alles?“
Wieder schwieg Lamba und atmete nur schwer. In der Stille hörte man eine gedämpfte, eindringliche Männerstimme aus der Diwanecke drüben. Dort sassen bräunliche Grosse des Morgenlandes, in Kleidern von Pariser Schnitt, den roten Fes der Sunniten oder die schwarze schiitische Lammfellmütze auf den schweigend horchenden Häuptern. Der Levantiner kannte ein paar der Hoheiten von Ansehen.
„Prinz Tussan Pascha von Ägypten, Prinz Safar es Saltaneh, der Perser“, sagte er. Und nach einer Weile, misstrauisch:
„Wer ist dieser junge schnurrbärtige Europäer, der so schnell und lebhaft auf sie einspricht? Mein Gott: er kann ja Türkisch! Er kann geläufig Persisch! Sehen Sie nur dieses überzeugende, suggestive Lächeln! Diese kaltblütigen Augen! Er zähmt diese Orientalen mit seinem Blick wie der Gaukler die Schlangen!“
„Es ist ein Russe — oder vielmehr ein Deutschrusse!“ sagte der griechische Diplomat. „Er landete erst heute nachmittag!“ Ein kollegialer Handwink. „Guten Abend, mein Fürst!“
Fürst Tschawadse, zugeteilt der russischen Botschaft, ging vorbei. Schon mit neun Jahren aus seiner kaukasischen Heimat als Geisel nach Petersburg gebracht, dort im Pagenkorps erzogen, zur orthodoxen Kirche übergetreten, Stabsrittmeister bei den Gardegrenadieren zu Pferde des Zaren, war er, der geborene Asiate, Russe durch und durch. Er begrüsste die andern morgenländischen Prinzen und schüttelte dem energischen jungen Europäer in ihrer Mitte die Hand.
„Willkommen, Gospodin Buddenhaus!“ sagte er auf russisch, und lachend auf französisch zu den halb verpariserten Grossen: „Hütet euch, vor ihm! Er ist ein Spitzbube! Gott löste ihm, wie einem Papagei, die Zunge. Wo er spricht, bleibt kein Ohr taub! Er kriecht hinein! Er kriecht in die Seelen!
Ich sehe es euch an: Gospodin Buddenhaus hat euch schon für seine Pläne gewonnen!“ Der Petersburger Kaukasier setzte sich. „Er hat euch überzeugt, dass der Eisenbahnbau der Russischen Studiengesellschaft Glück und Wohlstand durch ganz Vorderasien bringt! Schon seine Worte füllen eure Taschen mit Gold! Nun — möge sich Gott erbarmen und ihn zur Höhe heben!“
Lamba, der Levantiner, hatte von den fernen Sätzen nur das Wort „Buddenhaus“ verstanden. Er starrte erschrocken hinüber auf die frisch gelaunten, zugleich liebenswürdigen und unheimlich energischen Züge des jungen Mannes, in dessen verbindlichen Handbewegungen beim Sprechen noch eine mitreissende Kraft lag.
„Das ist doch nicht . . .“
„Das ist Herr Buddenhaus!“ bestätigte der griechische Botschaftssekretär neben ihm. „Der Vertrauensmann des russisch-französischen Bahnsyndikats!“
Der junge Diplomat atmete auf. Sein unerwünschter Nachbar, der mit allen Makeln des Mittelmeers behaftete Levantiner, hatte sich plötzlich formlos, fast ohne ein Kopfnicken des Abschieds, erhoben und lief mit der Aufdringlichkeit des Emporkömmlings nach der Tür.
„Wo bleiben Sie, Eccellenza? Ich warte schon lange!“
Exzellenz Rhodokanaki, Senator des Osmanischen Reiches, der bedächtig eintrat, war ein milder kleiner Greis mit einem weissen Vollbart um ein braunes Gesicht, aus dem hinter einer goldenen Brille zwei kluge Augen schauten. Er erwiderte vorsichtig und bedächtig die stummen Verbeugungen umher. Er war ein Mann von höchstem Ansehen — der Nachkomme eines jener altgriechischen Fanariotengeschlechter in ihren Palästen am Goldenen Horn, die in früheren Zeiten in Fürstenrang als Statthalter des Sultans die Moldau und die Walachei regierten.
Er setzte sich mit Lamba, dem Mann von gestern, abseits. Der Levantiner sprudelte leise, aber leidenschaftlich los:
„Exzellenz! Es muss etwas geschehen! Sonst geht für uns Griechen und Armenier jede Hoffnung auf eine Eisenbahnkonzession in Vorderasien verloren!“
„Warum die Eile? Wir sind im Orient!“
„Weil das Petersburg-Pariser Syndikat sich eilt! Soeben erhielt ich durch den zuverlässigsten Geheimagenten, den ich in Pera habe — sein Name tut nichts zur Sache — die Nachricht, dass der Marschall Schükri in Kürze Herrn Buddenhaus in Audienz empfängt!“
„Das ändert die Lage!“
„Dort drüben, zwischen den entnervten, opiumrauchenden Haremkönigen, sitzt Russlands starker Mann! Ah — die Russen wussten, was sie taten: sie spannten sich einen Deutschen vor!“
„Man möchte diesem Mann viel zutrauen!“ sagte der menschenkundige alte osmanische Senator mit einem langen Blick auf Paul Buddenhaus.
„Sie versprachen uns Ihre Hilfe und die der andern Christen im Senat, Exzellenz! Für eine Bahn in Asien!“
„Lassen Sie mir Zeit!“
„Wir christliche Untertanen des Sultans verlangen das Vorrecht vor den Ausländern!“
„Gebt nur den Inländern ein besseres Beispiel, ihr Levantiner!“
„Die von Abd ul Hamid ausgeschalteten Paschas des Grosswesirats, die zum Nichtstun verurteilten Efendis der Hohen Pforte sollen uns die Bahnkonzession erteilen und der Palastkamarilla und dem Grossherrn ihre ehemalige Macht zeigen!“
„Die Stunde für die Obereunuchen und Henker und Pagen und Zwerge im Jildis-Kiosk wird einmal schlagen!“
„Aber wie! Mit Gewalt und Mord!“ Der Levantiner krümmte sich, halb in Todesangst, halb in blinder Gier nach dem asiatischen Riesengewinn. „Blut wird durch die Gassen fliessen. Die Häuser von Stambul werden rauchen . . . Furchtbares steht bevor, wenn ihr nicht uns, euren Glaubensgenossen, den friedlichen Weg nach Asien bahnt . . .“
„. . . soweit unter der Herrschaft Abd ul Hamids ein Mensch — sei er Christ oder Moslem oder Jude — noch etwas vermag . . .“ Der Greis erhob sich. Er sprach ganz leise. „Seit Jahrhunderten residiert mein Haus in Stambul. Seit siebzig Jahren kenne ich Stambul. Ich ahne, was ihr jetzt in Stambul plant! Aber — Lob sei der heiligen Dreifaltigkeit — ihr seid Levantiner! Ihr seid Armenier! Ihr seid zu feige!“
Der Fanariote verabschiedete sich von Lamba.
„Um Unheil zu verhüten, will ich meinen ganzen Einfluss für euch aufbieten! Geben Sie mir acht Tage Zeit! Dann werden wir wissen, was Gott oder Allah oder Jehova über Stambul bestimmt!“