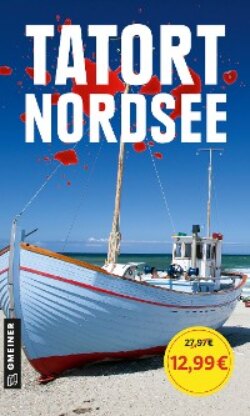Читать книгу Tatort Nordsee - Sandra Dünschede - Страница 10
2
ОглавлениеWiard Lüpkes war das, was man eigenbrötlerisch nennt. Er wohnte nicht allzu weit entfernt des Saathoff’schen Hofes. August verstand sich ganz gut mit ihm, sie hatten öfter mal miteinander zu tun, und wenn es nur das zufällige Treffen irgendwo in den umliegenden Poldern oder wie neulich in Norden war, bei dem man ein paar Worte wechselte. Dabei kebbelten sie sich immer, denn die politischen Ansichten von Wiard und August gingen durchaus nicht immer konform, manchmal diametral auseinander, aber sie akzeptierten sich. Früher hatte Wiard beim Finanzamt in Emden gearbeitet, bis ihm »das Amt und alles, was damit zu tun hatte, zum Halse raus hing«, und hatte seitdem keine feste Anstellung mehr gehabt. Die Leute hatten es kaum nachvollziehen können: »So eine Stelle auf’m Amt, Mensch, beim Staat, also, die gibt man doch nicht auf, heutzutage, bei mehr als fünf Millionen Arbeitslosen …«, »So gut wie verbeamtet.«, »Füße hoch, ein paar Einkommensteuererklärungen bearbeiten, und dann noch Gehalt dafür kriegen.« Wiard hatte das anders gesehen, und mit den paar Einkommensteuererklärungen war es auch nicht einfach so getan, er hatte es aufgegeben, mit den Leuten darüber zu diskutieren. Aber vor allem war ihm irgendwann, aus heiterem Himmel (oder doch nicht?) der Gedanke gekommen, warum er eigentlich acht Stunden täglich in dieser vermufften Bude saß und darüber gutachtete, ob jemand ein paar Euro Steuer zurückbekam oder nicht. Acht Stunden seines einzigartigen, einmaligen Lebens, von dem nun schon allerhand Jahre rum waren. Schließlich hatte er die Kündigung eingereicht, sogar den Betriebspsychologen des Kreises hatten sie ihm noch aufgehalst: »Herr Lüpkes, es ist aber sonst alles in Ordnung mit Ihnen?« Und: »In Ihrem Alter – also, da finden Sie keinen Job mehr, in der Wirtschaft sowieso nicht, aber im öffentlichen Dienst geht das auch nicht mehr …«
»Ich habe keine Frau, ich habe keine Kinder«, hatte er geantwortet, »und das, was ich für mich brauche, das kriege ich schon irgendwie zusammen, bin ja für sonst niemanden verantwortlich, nur für mich, na, das wird schon hinhauen.«
Am letzten Tag beim Finanzamt hatte er sich bei den Kolleginnen und Kollegen verabschiedet, bei all denen, die er schätzte, und den anderen. Dann hatte er sich, nachdem er das Gebäude durch die Außentür verlassen hatte, noch einmal umgedreht und ein, zwei Minuten nachgedacht, dabei auf die Gemäuer des Amtes blickend: Das war’s, ab sofort wird gelebt, war es ihm durch den Kopf gegangen. Und gleichzeitig: Na, ich kann das so machen, andere nicht …
Jetzt half Wiard im Sommer bei verschiedenen Landwirten aus, er kannte ja fast alle hier und in den Nachbarpoldern, und mit einigen verstand er sich gut. Bei August hatte er ebenso hier und da geholfen. Auch beim Bau des neuen Laufstalles, schließlich hatte August zusammen mit dem Bankberater so viel Muskelhypothek veranschlagt, dass er es allein kaum schaffte. Im Winter ging Wiard tageweise Beschäftigungen nach, war bei einer Jobvermittlung gemeldet, und immer, wenn das Geld zur Neige ging, suchte er sich Arbeit. Die Rente reichte »allenfalls fürs Klopapier und ein Stück Butter«, obwohl er mehr als 18 Jahre im Finanzamt gearbeitet hatte, aber er hatte ein Haus – seine Altersvorsorge, vielleicht die sicherste. Das war auch so ein Zufall in seinem Leben gewesen, hatte aber seinen Entschluss, dem Amtmannsleben Ade zu sagen, maßgeblich beeinflusst. Ein Onkel vererbte ihm das Haus, als der mit über 85 Jahren plötzlich verstarb. Der Postbote hatte irgendwann mit einer Einladung zur Testamentseröffnung beim Notar vor ihm gestanden, und Wiard hatte keinerlei Idee, worum es sich handeln könnte. Nach dem Notarstermin war er Besitzer eines kleinen Hauses im Polder. Handschriftlich hatte sein Onkel auf das Testament gesetzt: ›Und dat du mi dat Huus in Ordnung hollst.‹
Im letzten Sommer hatte er über eine Zeitarbeitsvermittlung einen Job als Helfer beim Bau des neuen Deiches bekommen. Vier Monate ordentlich gerackert, dabei aber ganz gut verdient.
»Das reicht locker, um den Herbst und den Winter zu überstehen und ein paar Wünsche zu erfüllen, die ich so habe …«, hatte er zu August gesagt. »Da kann ich mal wieder meinen Hobbys nachgehen.« Zu seinen Hobbys gehörten ein Schaf, eine Ziege, zahlreiche Katzen, Hühner und ein Schäferhund. Außerdem fertigte er Kunstgegenständen aus Holz an. Die wollte er in einem kleinen Laden, den er in seinem Haus auszubauen gedachte, zum Verkauf anbieten, »gerade, wenn die Badegäste aus dem Binnenland kommen«, von denen er sich einen Nebenverdienst erhoffte (»die kaufen doch alles, was halbwegs nach Küste und Meer aussieht«). Und er war technisch up to date, hatte einen Laptop zu Hause stehen, DSL-6000-Anschluss, wusste über alle neuen Trends Bescheid.
»Das passt doch alles nicht zusammen«, behaupteten seine Zweifler im Polder.
»Und wieso nicht«, hatte August gegengefragt …
Jedenfalls war Wiard dieses Leben offenbar lieber als das mit Ärmelschützern vor immer wieder denselben Formularen.
»Verdienst unsicher, Lebensqualität aber wesentlich besser geworden – das wiederum sicher«, so verteidigte Wiard seinen Schritt gegenüber besagten Kritikern.
August hatte keine Ahnung, was Wiard mit ihm besprechen wollte und was das mit dem Deich zu tun haben könnte. Seine Gedanken drehten sich um die Zukunft des HSV, als er eine mehr als daumendicke, dabei aber schnell zerfließende Wurst eines hellblauen Shampoos in seine Hand drückte, um das Zeug auf dem Kopf in reichlich Schaum zu verwandeln, damit Dreck und Kuhstallgeruch verschwanden.
»Sonst kannst du gleich im Stall bleiben und bei deinen Kühen übernachten«, hatte Henrike schon des Öfteren bemerkt. August lächelte, als er an diese Worte dachte, und wusch die Haare umso gründlicher.