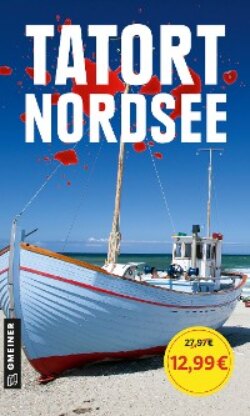Читать книгу Tatort Nordsee - Sandra Dünschede - Страница 23
15
ОглавлениеAls Henrike an diesem Nachmittag aus Norden kommend nach Hause fuhr, wunderte sie sich über Aktivitäten am neuen Deich. Die Straße beschrieb hier eine lang gezogene Kurve und umrundete so die Ostkrümmung. Der alte Deich hatte wesentlich näher an der Straße gestanden, von ihm war aber so gut wie nichts mehr zu sehen. Das alte Material war teilweise direkt im neuen Deich verbaut und dieser 200 Meter Richtung Wattenmeer hinaus angelegt worden, ein kleines Stück Neulandgewinnung, obwohl das längst nicht mehr das vorrangige Ziel war. Bislang hatte der neue Deich frei gestanden, zwar wiesen vereinzelt Schilder darauf hin, dass ein Betretungsverbot bestand, da das Bauwerk durch die Verlegung in die Ruhezone des Nationalparks fiel, aber das war es auch gewesen. Als Henrike an diesem Tag vorbeikam, waren – wieder einmal – rege Bautätigkeiten im Gange. Es wurde aber nicht am Deich gebaut, sondern davor. Einige Pkws standen herum, zwei Lieferwagen und ein kleiner Bagger waren zugegen, und schnell hatte Henrike erkannt, was dort errichtet wurde. Sie war ziemlich erstaunt. Ein Zaun, an der Binnenseite des Deiches, und zwar ein recht hoher. Sie schätzte ihn auf etwa zwei Meter, obwohl sie gestehen musste, dass sie verdammt schlecht im Schätzen war.
Zufällig hatte sie Lübbert Sieken getroffen, der nicht weit von hier in einem kleinen Haus lebte, mit einem Hund, einer Katze und zwei Schafen. Siekens Frau war vor drei Jahren an Krebs gestorben, dieser »gottverdammten und völlig nutzlosen Seuche«, wie Sieken seitdem nicht ohne Verbitterung sagte. Er war, nach einer Phase, in der alle überzeugt gewesen waren, dass er nun endgültig dem Alkohol verfallen würde, vor dessen krankhaften Folgen ihn bis dahin wahrscheinlich nur seine Frau weitgehend abhalten konnte, vor anderthalb Jahren von einem Tag auf den anderen aus seiner Lethargie erwacht und hatte sich daran gemacht, aus seinem Haus und dem Grundstück ein kleines Schmuckstück zu zaubern. Das war sein neues Lebensziel geworden. Er hatte alles selbst gemacht, Fenster und Türen dunkelgrün gestrichen, was gut zu den roten Ziegeln passte (zumindest fand Lübbert das), den Garten auf Vordermann gebracht, Obstbäume beschnitten und den Zaun erneuert, an dem im Frühling Wicken rankten, die im Sommer herrlich dufteten. Manchmal wurde er ganz melancholisch und seufzte: »Wenn Erna nun von oben guckt, wird ihr das gefallen.«
Nicht dass er dem Alkohol abgeschworen hätte, aber er hielt den Konsum so weit in Grenzen, dass er den Tag über arbeiten konnte, klar, mit Pausen natürlich, aber schließlich war er Rentner. Mittlerweile ging er wieder mit offenen Augen durch seine Umwelt, zwischenzeitlich hatte ihn rein gar nichts mehr interessiert. Sein Verstand war immer noch scharf. Die 35 Jahre als Gemeindearbeiter im nächsten Sielort hatte er hinter sich, war etwas früher in Rente gegangen, und die »reichte allemal, selbst wenn sie die noch mal kürzen, damit die Diäten erhöht werden können oder wenn es wichtiger war, ein paar Panzer mehr für die Bundeswehr anzuschaffen, um die Heide kaputt zu walzen.« Außerdem, so ergänzte er, spare der Staat doch auch, obwohl er ihm Rente zahle – schließlich sei seine Stelle nach seinem Weggang nicht wiederbesetzt worden.
Am Deich hatte Lübbert Sieken Henrike schon von Weitem gegrüßt. Lübbert kannte Henrike seit deren Kindheit. Henrike ihrerseits schätzte ihn als netten, älteren Mann, der oft witzig war und beim Dorffest den Kindern eine Süßigkeit spendierte. Gerade dann besonders gern, wenn er angetrunken war. Der manchmal mürrische Sieken wurde unter Alkoholeinfluss lebhaft und lustig, was bekanntlich nicht bei allen Zeitgenossen der Fall ist, und von daher verband sie positive Erinnerungen mit ihm. Als Kind hatte sie den Alkohol nie bemerkt, jedenfalls konnte sie sich nicht daran erinnern. Sie grüßte ihn zurück, und als er nahe genug herangekommen war mit seinem Fahrrad, rief er: »Moin, min Kind, wat makst du hier so alleen bi de Schietwedder?«
»Moin, Lübbert, ich kam gerade aus der Stadt, und da sah ich, dass hier schon wieder gebaut wird …Was machen die denn hier?«
»Hest du Bohnen up dien Oogen?«, meinte Lübbert und fuhr dann auf Hochdeutsch fort: »Hier wird ein Zaun gebaut, würde ich mal tippen.« Geradezu väterlich lächelte er sie an, und wieder ging ihm durch den Kopf, dass er schon, als Henrike noch nicht einmal zehn Jahre alt gewesen war, immer hervorgehoben hatte: »Das wird mal das schönste Mädchen im ganzen Polder.« Henrike hatte später entgegnet, ob das denn nun ein Kompliment oder eher das Gegenteil davon sein sollte, aber Lübbert hatte erwidert: »Wieso? Gibt’s denn noch was anderes als unseren Polder auf dieser Welt?«
»Ja, das sehe ich, aber wozu?« In diesem Moment fiel Henrike auf, dass sie eigentlich immer mit Lübbert Sieken Gespräche geführt hatte, in denen sie Fragen stellte und Lübbert wohlwollend antwortete.
»Na, ich denke, da soll keiner mehr auf den Deich.«
»Da standen doch schon Schilder, reicht das nicht?«
»Doch, das reicht wohl. Aber erklär das mal den Leuten auf’m Amt. Die meinen, das reicht nicht. Und dann kann man ja noch ein paar Steuergelder verschleudern, ist ja Herbst, da muss das Geld weg, baut man eben einen Zaun an den Deich, wenn einem nix anderes einfällt. Und die Verbotsschilder dazu, die gibt’s ja auch nicht umsonst, da kann man noch ein bisschen mehr Geld verballern«, ereiferte sich Sieken, und wusste nicht, ob er dabei nun lachen oder weinen sollte. Kurz dachte er auch wieder an die erneute Nullrunde bei den Renten.
»Aber man muss doch mal drauf können, auf den Deich. Die können hier doch nicht alles dichtmachen«, war das Einzige, was Henrike hervorbrachte.
»Da kommen sicher ein paar Türen rein. Ja, klar.« Lübbert machte eine kleine Pause. »Aber die werden wohl verschlossen sein, und den Schlüssel hat dann wieder so ein Amtlicher – also, wir, die hier wohnen, wir kommen nicht mehr auf den Deich, jedenfalls nicht hier.« Es lag echte Trauer in seiner Stimme, denn er war über viele Jahrzehnte hinweg fast jeden Tag auf und vor dem Deich gewesen. Der Wind, die See, das waren Lebenselixiere für ihn. Wenn man hinter dem Deich wohnte, aber ihn nicht begehen durfte, war das mindestens so bitter wie zu lang gezogener Tee, und dann noch ohne Kluntje. Oder Beutel-Tee, im Glas, mit Kondensmilch. Holl mi up.
»Ich verstehe ja, dass nicht jeder drauf soll, aber die Einheimischen, die wissen, dass man auf so einem Deich nicht alles machen darf und auch nicht im Deichvorland einfach herumtollen kann, wie man will, die müssten doch eine Sondergenehmigung erhalten«, dachte Henrike laut nach, und Lübbert Sieken nickte zustimmend, aber schweigend mit dem Kopf.
Schließlich fügte er hinzu: »Das meine ich auch, min Deern, aber solche Dinge zählen heute nicht mehr, alles schnuppe. Amtliche Vorgänge sind anders. Zäune bauen, betreten verboten, und wer’s trotzdem tut, kriegt ’ne saftige Strafe aufgebrummt. So geht das. Die Krux ist, dass so etwas nicht hier beschlossen wird, sondern in der Kreisstadt oder noch weiter weg. Das entscheiden Leute, die zum Deich hier keinerlei Verbindung haben, denen es egal ist, ob ein Zaun davor steht, oder nicht. Die wissen doch rein gar nicht, was uns der Deich hier bedeutet – und dass wir gut mit ihm umgehen, schließlich schützt er uns. Denen da oben ist das so schnuppe, wie der nächste Huster des bayerischen Ministerpräsidenten mir piepegal ist«, Lübbert Sieken sah durchaus erbost aus.
Henrike und Lübbert standen eine Weile, sahen zu den Arbeiten am Deich hinüber und sagten nichts. Schließlich ergriff Lübbert wieder das Wort, und was sie hörte, verblüffte Henrike.
»Ich mache mir aber weniger Sorgen um den Zaun und die Schilder als um den neuen Deich.«
»Sorgen?«
»Also, man darf den Deich nicht mehr begehen, das ist schlimm für mich, weißt du? Ich wohne hier hinter’m Deich und darf nicht darauf, das ist fast wie im Knast. Du kannst dir vorstellen, dass ich oft hingegangen bin, zum Deich, vor allem abends, um noch ein paar Schritte auf oder vor ihm zu gehen. Ich brauche das einfach, den frischen Wind, den Geruch des Watts, die Vögel, die irgendwo rufen. Möwen, Enten und vor allem Austernfischer, Tütjevögels. Du weißt ja, wie schön das ist, hast August doch auch am Deich kennengelernt, ja … da kann Liebe entstehen … Ich habe den alten Deich gekannt wie meine Westentasche, und auch der neue ist mir schon ein wenig vertraut geworden.« Lübbert machte eine kleine Pause, als denke er nach. »Der neue ist aber nicht wie der alte, obwohl er ja höher, fester und besser sein soll. Wie alles Neue angeblich besser sein soll, schneller, weiter, am höchsten, am … ach, was weiß ich …« Lübbert Sieken schwieg wieder. Seine Wangenknochen traten hervor, er schien sich auf die Zunge zu beißen. Sein Blick ging in die Ferne.
»Was meinst du?« Henrike spürte, dass sie sich der Wiard’schen Deichgeschichte näherten, die nun auch im Kopf ihres Mannes herumschwirrte.
»Ich glaube, die haben den Deich nicht überall so gebaut, wie er eigentlich gebaut sein müsste. Das ging alles zu schnell. Ich habe nicht Buch geführt, aber man hat das im Gefühl, wenn man sein ganzes Leben hinter dem Deich verbringt. Auch mit den neuen Maschinen und so, ich habe das damals schon komisch gefunden, wie schnell plötzlich alles fertig war. Da wurde mit einer Hochgeschwindigkeit gebaggert, aufgeschüttet, modelliert, gesodet, gesät, dann war die Einweihung und schwupp, alles bestens. Und nun ist mir bei meinen – zugegebenermaßen verbotenen, aber da sag ich mal wie die im Süden: ›Hobt’s mi alle gern‹ – abendlichen Wanderungen etwas aufgefallen, was mir ernsthaft Sorgen macht.« Er machte wieder eine Pause.
»Was?« Henrike ahnte, worauf er hinauswollte.
»Der Deich ist weich. Und ich reime da nicht aus Spaß.«
»Weich?« Henrike wusste genau, was Lübbert meinte, wollte aber seine Version hören.
»Er ist nicht so widerstandsfähig, wie ein Seedeich sein sollte.«
»Wie meinst du das? Da steht ja sogar ein Bagger drauf, der ist doch stabil.«
»Nee, so mein ich das nicht. Weich heißt, dass der Kern, das Innere des Deiches, vor allem aus Sand besteht, was ja in Ordnung ist, aber ich glaube, den haben die einfach nur reingespült. Was auch normal wäre, wenn man ihm genug Zeit gelassen hätte, um sich setzen zu können. Noch schlimmer ist, dass die Kleischicht viel zu dünn ist und eine ordentliche Einsaat fehlt. Klar, Gras wächst da, aber wohl mehr, damit es schnell über etwas wächst, was nicht gut gemacht ist. Da gibt es jetzt schon Schadstellen, die nur aufgrund der miserablen Arbeit entstanden sind und die extrem nachlässig geflickt wurden. Ich habe mir das mit eigenen Augen angesehen! Wenn man ein bisschen den Blick dafür hat, sieht man das sofort. Also ich sage: Der hält keine zwei Sturmfluten aus. Ist vielleicht übertrieben, aber vielmehr werden es nicht sein. Und es soll mehr davon geben in Zukunft, sagt man. Ein paar Nordweststürme, hoch auflaufendes Wasser, läuft ja sowieso höher auf nach dem Eindeichen der halben Bucht, dann ist Land unter, es könnte zumindest sein. Ich übertreibe nicht, Henrike! Das alles passt zusammen mit der Hektik, mit der der Deich hier an der Ostkrümmung fertiggestellt wurde – die haben auf ein paar elementare Dinge verzichtet. Wenn Karnickel am Deich wühlen und ganz schnell heller Sand aus ihrem Bau kommt, dann stimmt da was nicht. Und weißt du was? Die bauen hier den Zaun und machen all das Verbotstrara, weil das keiner sehen soll. Dann würden hier nämlich ein paar Leute mal zur Verantwortung gezogen. Die sitzen aber auf Stellen, dank derer sie die Möglichkeiten haben, das zu verhindern.« Wieder schwieg Lübbert Sieken, und wieder traten seine Wangenknochen deutlich hervor.
»Der neue Deich?«, Henrike konnte kaum glauben, dass Lübbert bestätigte, was Wiard August erzählt hatte, dies aber ganz unabhängig voneinander.
»Ich denke, hier, am Deichschluss, ist es am schlimmsten, wahrscheinlich ist der Rest in Ordnung. Ich glaube, nur hier, im Bereich der Ostkrümmung, ist was faul. Ich habe das im Gefühl. Habe auch mit den Leuten gesprochen, die dort arbeiten. Die reagieren ein bisschen verstockt. Manchmal meine ich, sie weichen aus. Sagen dann: »Keen Tied, du, ick mutt arbeiten, wie hebben hier Akkord«, so wat ähnelsk jedenfalls. Aber an einem Deich darf’s nirgendwo eine Schwachstelle geben. Schließlich kannst du einen Eimer, der nur ein winzig kleines Loch hat, wegschmeißen. Am Deichfuß entstand nach der etwas höheren Flut neulich ein richtiger Wasserstrom. Ich war jeden Abend da, die Nässe hat mich gewundert und daran erinnert, wie die Leute bei der großen Oderflut in Ostdeutschland befürchteten, dass die alten Flussdeiche nach einigen Tagen Wasserhochstand durchweichen und schließlich brechen könnten. In Holland, an den Rheindeichen, war es genauso. Die haben gebangt und gebibbert, unsere lieben Nachbarn, dass die Deiche halten. Es war schon alles für eine rasante Evakuierung geplant, na der Herrgott, oder wer auch immer, hat’s erst einmal noch nicht so weit kommen lassen, obwohl es grob fahrlässig ist, Deiche über Jahrzehnte nicht zu sanieren. Oder denk mal an diese Hurrikane in den USA, in New Orleans. Da haben die Deiche nicht gehalten, weil sie schlecht gebaut waren. Und was sie danach wieder aufgebaut haben, war wahrscheinlich noch schlechter. Stand doch alles in der Zeitung. Also, so was gibt’s, das sind keine Märchen. Und hier, Henrike, hier haben wir einen Seedeich vor uns, keinen Flussdeich, das ist noch ein kleiner Unterschied«, nach einer weiteren Pause fuhr er fort, »und das mit der Ostkrümmung passt gut, denn das war sozusagen das Schlussstück des Meisterwerks. Damals gab es diese Verzögerungen und Diskussionen, weil die Baufirma plötzlich vor der Pleite stand, und es musste dann alles ganz schnell gehen. Nee, der Deich ist gut, aber hier, genau hier, wo ich wohne, gibt es eine Schwachstelle, ich bin mir da sicher. Ich bin vielleicht alt, aber nicht blöd. Mindestens 500 Meter, die müsste man noch mal sorgfältig prüfen und sanieren. Ich überlege schon die ganze Zeit, was man tun kann.«
»Na, das muss öffentlich gemacht werden!«
»Ja, das ist richtig. Aber wer soll das machen? Ich? Wer glaubt schon einem alten Mann, der als Frührentner hinter’m Deich wohnt und einige Jahre als Alkoholiker galt. Und manche halten mich immer noch dafür. Sie haben ja recht, bleibt man ja immer, auch wenn man trocken ist. Und außerdem: einmal in der Schublade, immer in der Schublade. Ich weiß, was geredet wird über mich. Nee, mir glaubt keiner. Guck dir doch mal an, wie in unserem Land Meinungsmache betrieben wird, in den Zeitungen. Und weißt du was? In den USA, nach dem Hurrikan, als New Orleans unter Wasser stand, haben sie auch getönt, wir erhöhen die Deiche, machen sie fester, besser. Und nun gab es viele Artikel, dass die neuen Deiche totaler Pfusch sind. Und die Konsequenz? Null, nichts. Sie stehen, und damit basta. Aber die Qualität wird sich erst im nächsten Ernstfall zeigen, und dann prost Mahlzeit.«
»Aber doch nicht bei uns in Ostfriesland«, warf Henrike ein, doch Lübbert unterbrach sie, beinahe barsch:
»Henrike, das ist naiv, was du da sagst. Zugegeben, die Deiche hier sind alle super gemacht. Durchweg. Aber hier scheint es eine Ausnahme zu geben. Skandale sind immer zeitlich punktuell. Wenn etwas lange und immer gut geht, gibt es plötzlich einen Einschnitt. Da gibt’s doch viele Beispiele. In heutiger Zeit haben sich viele Dinge geändert. Alles muss immer schneller gehen, und dahinter stecken viel mehr Interessen, als noch vor wenigen Jahren. Da wollen Leute Geld verdienen, die sitzen unter Umständen in München, in der Schweiz oder wer weiß wo, aber bestimmt nicht in ihrem kleinen Landhaus hinter’m Deich. Die Globalisierung lässt grüßen. Einige schwarze Schafe wollen den schnellen Euro machen – die kümmert’s nicht, ob etwas qualitativ gut oder schlecht ist. Und das ist die Gefahr. Solange nichts passiert, ist alles gut. Ein Deich muss aber den schlimmsten Sturm aushalten; viele kleine tun eigentlich nichts zur Sache. Als die Einheimischen noch selbst ihre Deiche und Warften bauten, hatten sie ein ureigenes Interesse an der Stabilität. Wenn aber Leute am Bau beteiligt sind, denen die Bedeutung dieser Bauwerke gar nicht klar ist, ist das etwas anderes. In New Orleans haben Army-Soldaten Deiche gebaut … ich bitte dich, was soll dabei herauskommen?! Und hier hat man ein Baukonsortium zusammengezimmert, das einen Auftrag erhalten hat, den auszuführen es nicht kompetent war. Warum soll’s das nicht auch bei uns geben? Erst einmal geht’s ums Geld, Geld, Geld. Nichts anderes. Wenn jemand mit einem günstigeren Angebot einen lukrativen Auftrag erhalten kann, na, dann baut er eben mal einen Deich. Und was ich sehe, ist, dass hier eine Stelle nicht richtig gemacht wurde. So ist das!« Lübbert holte tief Luft. Er hat wohl recht, dachte Henrike, obwohl sie zweifelte, aber auch wusste, dass sie bislang noch nie Veranlassung gehabt hatte, an das, was Lübbert sagte, nicht zu glauben.
»Und wenn es andere gäbe, die dich unterstützten, die Sache publik zu machen?«
»Das wäre etwas anderes, ein paar ganz seriöse Leute, sag ich mal. Fragt sich nur, wer das sein könnte.«
»Ich werde mal mit August darüber sprechen. Ist ja keine gute Neuigkeit, die du da erzählst. Aber nun muss ich dringend weiter, das Abendessen muss gemacht werden, die Wäscheberge türmen sich schon wieder.«
»Was machen deine vier Bälger und wie geht’s August?«, erkundigte sich Lübbert Sieken, ganz bewusst auf Henrikes schnellen Abschied eingehend.
»Och, alle gesund und munter, Freerk wird groß und frech.«
Auf Tjadens Hof war Freerk als Fünfjähriger vom Heuboden gefallen. Zufällig hatte Lübbert Sieken genau unter ihm gestanden, als er herunterstürzte. Lübbert hatte ihm vielleicht das Leben gerettet, aber zumindest schwere Verletzungen erspart. Immerhin hatte Lübbert auf Betonfußboden gestanden.
»Ich bin dir heute noch dankbar dafür«, fügte Henrike hinzu, als Lübbert sie an die alte Geschichte erinnerte.
»Nicht dafür. Das hätte jeder gemacht, war Zufall, sonst nichts.«
»Aber ein glücklicher. Tschüss, Lübbert.« Henrike stieg ins Auto.
»Tschüss, min Deern. Grüß August, und es wäre schön, wenn du ihn darauf ansprechen könntest. Ich gehe gern mal mit ihm zum Deich. Ich bin zwar nicht mehr der Jüngste, aber über den Zaun da, das schaffe ich noch. Allein schon aus Trotz. Diese Arschlöcher«, fluchte Lübbert, doch bei den letzten Worten hatte er sich schon von Henrike weggedreht. Gegenüber ›den Kindern‹ hatte er solche Ausdrücke nie benutzt, und es fiel ihm, manchmal, wie vielen alten Menschen, schwer, in den früheren Kindern nun selbstständige Erwachsene zu sehen.
»Ich werd’s ihm sagen«, rief Henrike, startete den Motor und fuhr los, Lübbert, der sich noch einmal kurz umdrehte, durch die Windschutzscheibe grüßend. Im Rückspiegel sah sie, wie er sich auf sein altes Fahrrad setzte und in die Gegenrichtung davonfuhr. Er freute sich auf einen warmen Tee und dachte über die Hamburger Flut 1962 nach, die ihm noch lebhaft in Erinnerung war; die Berichte im Fernsehen, im Radio und in der Zeitung.
»Na, hat der Schnaps doch noch nicht alles weggepustet«, ging es ihm durch den Kopf, und er hatte dabei die Berichte über das entschlossene Vorgehen von Innensenator Helmut Schmidt vor seinem inneren Auge, als sei es gestern gewesen.
Mistzeug, dachte er und beschloss, dennoch einen zu trinken, am Abend. Aber nur einen. Und ein Pils. Er hatte gelernt, ein verträgliches Quantum einzuhalten. War schwer genug gewesen.