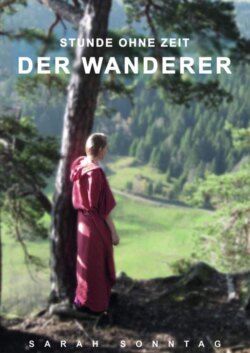Читать книгу Stunde ohne Zeit Der Wanderer - Sarah Sonntag - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеTom warf den beiden schlafenden Frauen einen Blick zu und entfernte sich dann leise vom Lager. Mit schnellen geschmeidigen Bewegungen folgte er einer kleinen Talsenke bis zu einem Stück Wiese, das durch Felsbrocken und einige Bäume, die sich kreisförmig um den Platz gruppierten, auf natürliche Weise geschützt war. Rasch entledigte er sich seiner Kleidung, bis auf eine Leinenhose und eine Bernsteinkette, die er seit seiner Säuglingszeit um den Hals trug, nahm die zwei kurzen Stöcke, die er mitgebracht hatte und trat in die Mitte des Platzes. Das Licht des abnehmenden Mondes schien bleich auf ihn herunter und überzog alles mit seinem seltsamen Zauber.
Langsam fing er mit einer einfachen Bewegungsabfolge seines sonderbar anmutenden Tanzes an, um warm zu werden. Dann dehnte er seinen Körper sorgfältig, bevor er mit dem eigentlichen Übungskomplex begann.
Die geschmeidigen Bewegungen, die eine faszinierende, fast hypnotische Wirkung auf den Betrachter haben konnten, waren allerdings weniger ein Tanz, als vielmehr eine Kampfkunst, die im Ernstfall tödlich sein konnte. Tom hatte den Stockkampf jedoch kaum einmal zu Verteidigungszwecken eingesetzt, sondern ihn genutzt, um seine Körperdisziplin und Konzentrationsfähigkeit zu schulen. Er half ihm, sich zu sammeln, den Kopf von Gedanken und die Brust von Gefühlen zu befreien. Er wurde eins mit seinem Körper, seinen Bewegungen und dem Kosmos. Er war der Jäger. Sein Körper glich dem einer Raubkatze. Seine Muskeln spannten und entspannten sich im Rhythmus seiner schneller werdenden Bewegungen und in jeder Bewegung war Bewusstsein.
Nachdem er als Kind mit seiner Mutter in die Stadt gezogen war, stellte der Stockkampf neben seinen Eltern das einzig Positive in seinem Leben dar. Allerdings konnte er die Welt, die er verloren hatte, nicht ersetzen. Später jedoch hatte er gelernt, seine Frustration in die Bewegung zu binden und als sein Vater gestorben war, hatte er seinen ganzen Schmerz in sie hineingelegt. Wie besessen hatte er geübt, seine Bewegungen präzisiert, um nicht an seinen Vater denken zu müssen, und war den anderen seiner Gruppe bald weit voraus. Er hatte sich einen privaten Lehrer gesucht und hatte mit einundzwanzig Jahren sogar eine Zeit lang bei den besten Meistern auf den Philippinen gelernt.
Tom drehte sich blitzschnell mit durch die Luft wirbelnden Stöcken und blieb dann abrupt wie erstarrt stehen. Sein Körper glänzte von Schweiß, doch sein Atem ging vollkommen regelmäßig.
Er verbeugte sich in alle vier Himmelsrichtungen und sprach einen kurzen Dank, bevor er seine Sachen zusammensuchte und zu einem nahe gelegenen Waldbach ging. Dort wusch er sich und machte sich dann auf den Weg zurück zum Lager.
Bevor sie am nächsten Tag aufbrachen, bedankte sich Tom bei dem Deva des Feldahorns, in dessen Schutz sie geschlafen hatten.
Mirlias Lachen klang hell und leicht durch die klare Luft des sonnigen Morgens, als sie zusammenpackten und loszogen. Unbeschwert erzählte sie dieses und jenes, hakte sich bei Felice unter und zog sie mit sich fort. Offensichtlich war Felice ebenfalls sehr bemüht, fröhlich zu erscheinen. Sie lachte oft und plauderte mit Mirlia, doch Tom bemerkte, wie sie mit sich kämpfte. Seit sie vor zwei Tagen aufgebrochen waren, stritten Eifersucht und Einsamkeit mit ihrem Gewissen, auch wenn sie versuchte, ihre Gefühle hinter einem fröhlichen Gesicht zu verstecken. Er würde später mit ihr reden.
Rasch schritt er hinter den Frauen her, die schon ein ganzes Stück vorausgegangen waren. Doch plötzlich blieb er stehen. Es gab keinen erkennbaren Grund dafür, aber er hatte das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Unauffällig schaute er sich um. Obwohl sie über offene Felder mit nur wenigen Versteckmöglichkeiten gingen, konnte er nichts Ungewöhnliches entdecken, abgesehen von einem Fuchs, der in einiger Entfernung um die Bäume strich. Außer den Stimmen der Frauen, dem Summen der Insekten und einigen wenigen Vögeln war kein Laut zu hören.
Beunruhigt beeilte er sich Mirlia und Felice einzuholen.
Was es auch war, das ihn störte, es entzog sich den äußeren Sinnen. Es war nur ein Gefühl, eine schwache Ahnung, beobachtet zu werden. Doch gewöhnlich konnte er sich auf Ahnungen, die ihn vor Gefahr warnten, verlassen.
„Minerva“ rief er in Gedanken. Doch falls die hohe Frau auf sein Rufen kam, war sie nicht vor der Nacht zu erwarten, da sie von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang den Forst von Arkarion bewachte. Am nächsten Abend konnten sie Kerma, die einzige Stadt zwischen dem Wald der Schwelle und den Bergen, erreichen. Dort wäre es leichter einen möglichen Verfolger abzuhängen, aber im Moment konnte er nicht mehr tun, als wachsam zu bleiben und einen starken Schutzbaum für die Nacht zu suchen.
Tom versuchte die Beklemmung abzuschütteln. Er glaubte nicht, dass sie in unmittelbarer Gefahr schwebten und er wollte die wenige Zeit, die er mit Mirlia hatte, genießen. Sobald sie Kerma erreichten, würden sich ihre Wege trennen.
Mirlia sah Tom erstaunt an, als er sie ohne Vorwarnung an sich zog, sobald er sie eingeholt hatte.
„Tom“ flüsterte sie. „Tom, ich bin doch noch da.“ Sie lachte leise und löste sich leicht von ihm. Tom küsste sie auf die Stirn, verbannte den Schmerz in sein Inneres und lächelte. Wenn er so weitermachte, verwirrte er nicht nur Mirlia, sondern verletzte auch Felice. Diese hatte den Blick abgewandt und war weitergegangen, als ob sie nichts bemerkt habe.
Sie wanderten den ganzen Tag weiter, ohne dass etwas Nennenswertes passierte. Nachdem sie am Nachmittag die Hauptstraße Richtung Kerma betreten hatten, verschwand auch das Gefühl, beobachtet zu werden.
Mirlia hatte ein so fröhliches Wesen, dass Felice und Tom von ihrer guten Laune angesteckt wurden. Allerdings fiel Tom auf, dass Felice zwar munter mit Mirlia redete, ihm jedoch auswich und am Nachmittag hinter ihnen zurückzufallen begann. Gegen Abend wichen sie von der Straße ab und Tom fand ein Stück querfeldein, was er suchte: eine schöne starke Eberesche, die ihnen genügend Schutz vor magischen Angriffen in der Nacht bieten würde.
Felice entschuldigte sich gleich nach dem Essen, dass sie müde sei und legte sich schlafen. Doch Mirlia war aufgedreht und neckte Tom wie ein kleines Mädchen so lange, bis er hinter ihr herrannte, während sie lachend davonsprang. Eine Weile spielten sie Haschen wie Kinder, doch schließlich zog Tom Mirlia neben sich ins Gras. Sie lehnte ihren Kopf schwer atmend an seine Schulter.
„Mirlia“, sagte er leise.
„Hm?“ fragte sie. Sie hob den Kopf und sah ihm ins Gesicht. „Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass du dich von mir verabschieden willst“, flüsterte sie. Es fiel Tom nicht leicht, weiterzusprechen, doch wie würde sie sich fühlen, wenn er einfach nicht mehr auftauchte? Und wie würde er sich fühlen?
In der Ferne versank die Sonne blutrot hinter den Bergen. Er betrachtete sie und sann über den Zyklus von Leben und Tod, Kommen und Gehen, Werden und Vergehen nach.
„Mirlia, ich werde gehen“, sagte er mit ruhiger Stimme. „Und vermutlich werde ich nicht zurückkommen – aber niemand, außer dir, darf es erfahren.“ Schweigend starrten sie beide in den farbenprächtigen Abendhimmel.
„Warum?“, wollte sie endlich wissen. Tom zuckte mit den Schultern.
„Alles muss zu Ende gehen... So wie dieser Tag. Das ist das Schicksal aller vergänglichen Dinge.“
Forschend sah sie ihn an. „Wirst du sterben?“, fragte sie. Tom lächelte und strich ihr sanft die Haare aus dem Gesicht. „Irgendwann werde ich sterben.“ antwortete er. „Aber ich denke, das dauert noch eine Weile.“
Eine Zeit lang schwiegen sie.
„Ich glaube, dies ist unser letztes Wiedersehen“, sagte er schließlich.
Tiefe Traurigkeit ergriff Besitz von seinem Herz. Er kannte Mirlia so lange; sie war seine liebste Freundin und jetzt war es zu Ende. Sie bettete ihren Kopf an seine Brust und er spürte, dass sie weinte.
Als sie sich schließlich erhoben und zum Lager zurückgingen, wo Felice tief und fest schlief, war es bereits dunkel und die ersten Sterne standen am Himmel. Tom ließ Mirlia dort zurück und schritt noch einmal in die Nacht hinaus.
„Minerva“, rief er in Gedanken.
„Ich bin hier“, antwortete sie. In Eulengestalt flog sie dicht über ihn hinweg, streifte ihn mit einer Flügelspitze und ließ sich, da es keinen anderen Landeplatz gab, auf seiner Schulter nieder.
„Du denkst, du hast mich umsonst gerufen“, erklang ihre Stimme in seinem Kopf, bevor er etwas sagen konnte.
„Habt Dank, dass Ihr gekommen seid“, antwortete Tom ehrerbietig. „Ich glaubte, mit Hilfe von Magie beobachtet zu werden. Doch mein Verdacht scheint sich in Luft aufgelöst zu haben. Es war nur ein vages Gefühl“, teilte er ihr mit.
Minerva lachte. „Du hast mich nicht gerufen, weil jemand euch beobachtet haben könnte, sondern weil du Angst hattest, Angst um...“ Sie ließ den Satz unvollendet.
Tom senkte den Kopf. Er wusste, dass sie Recht hatte. Er wechselte das Thema. „Vergile hat mich in die Falle gelockt“, meinte er. „Ich verstehe nicht, wieso er Felice vergiftet hat, aber ich bin mir sicher, dass er wusste, dass ich rechtzeitig kommen würde. Dass er später nach ihrem Namen fragte, diente nur dazu, mich auf sie aufmerksam zu machen. Ich sollte sicher mitbekommen, dass er sie ins Herrenhaus lockte.“ Tom konnte seine Wut nur schwer bändigen. „Vergile ist viel zu mächtig, als dass es mir so leicht fallen konnte, Felice zu retten. Alles, was er wollte, war, mich dazu zu zwingen, ihm das Amulett zu bringen. Das hat er jetzt erreicht. Ich habe seine Pläne nicht durchkreuzt, sondern ihm in die Hände gespielt.“
„Vergile kennt dich gut“, erwiderte Minerva. „Doch auch wenn du Recht hast, ändert das nichts an den Tatsachen. Hättest du Felice nicht geholfen, wäre sie jetzt tot oder Schlimmeres.“ Sie schwiegen. Die Nacht lag wie eine dunkle Decke über ihnen und es waren kaum Geräusche zu hören.
„Vertraue auf dein Gefühl, sonst wird es dich eines Tages im Stich lassen!“, hallte Minervas Stimme in seinem Kopf. Sie erhob sich mit zwei Flügelschlägen in die Lüfte, dann war sie verschwunden.
„Vertraue auf dein Gefühl…“, hieß das, das tatsächlich eine Gefahr bestand? Müde und in Gedanken versunken kehrte Tom zum Lagerplatz zurück. Dort angekommen blieb er stehen. Auf den ersten Blick fiel ihm auf, dass Felices Schlafplatz leer war.
„Felice?“, rief er leise, doch er bekam keine Antwort. Im Dunkeln konnte er auch nicht weit schauen.
Für einen kurzen Augenblick stieg Angst in ihm hoch. Doch dann zog sein Verstand mit seinen Gefühlen gleich. Mirlia schlief noch seelenruhig. Hätte jemand versucht Felice mit Gewalt zu entführen, wäre sie aufgewacht. Vor magischen Angriffen bot die Eberesche, unter der sie schliefen, genügend Schutz, außerdem konnte er keine fremde Magie spüren. Das konnte nur bedeuten, dass Felice das Lager freiwillig verlassen hatte.
Lauschend verharrte er einen Moment und machte sich dann Richtung Norden auf den Weg. Er brauchte nicht weit zu gehen. Felice saß etwas entfernt mit dem Rücken zu ihm auf einem flachen Stein. Ihr Haar schimmerte matt im Mondlicht. Lautlos, wie es seiner Gewohnheit entsprach, näherte Tom sich ihr. Erschrocken zuckte sie zusammen, als er plötzlich neben ihr auftauchte.
„Psst, Felice, ich bin es nur“, beruhigte er sie.
„Oh“ sagte sie mit brüchiger Stimme und wischte sich verstohlen über das Gesicht, um die Tränen zu beseitigen, die darauf glitzerten. Tom betrachtete sie.
„Wie schön sie ist“, dachte er, doch laut sagte er nur: „Du hast wieder geweint.“
Sie zuckte mit den Schultern und wandte das Gesicht ab. Geschmeidig ließ er sich vor ihr zu Boden gleiten.
„Willst du nicht mit mir darüber sprechen?“, fragte er in dem Bewusstsein, dass sie es ablehnen würde. Sie schüttelte den Kopf. „Ich kann nicht“, stieß sie hervor und neue Tränen rannen ihr über das Gesicht.
„Du fühlst dich einsam“, drängte er sanft. Da sie erneut mit den Schultern zuckte, fuhr er fort: „Und du hast... nicht mit Mirlia gerechnet.“ Felice vergrub das Gesicht in den Händen.
„Oh Gott, Tom, bitte fragt nicht“, flüsterte sie gequält. „Es ist egal, wie es mir geht. Schließlich ist es meine eigene Schuld. Wäre ich nicht so dumm gewesen auf Vergiles Zauber hereinzufallen, läge ich jetzt zu Hause in meinem Bett und wir wären noch fremde Nachbarn.“ Sie hielt inne und biss sich auf die Lippen, als ob sie zu viel gesagt hätte.
„Felice, sieh mich an.“ Tom griff ihr sanft unters Kinn und drehte ihren Kopf so, dass sie ihn ansehen musste. „Du bist nicht Schuld an der Situation. Vergile ist ein mächtiger Zauberkünstler und wenige vermögen seinen Listen zu widerstehen. Auch ich bin mehr als einmal auf ihn hereingefallen.“ Felice war aufmerksam geworden, doch die genauen Umstände würde er ihr heute nicht erklären. Vielleicht ein anderes Mal. „Und wegen Mirlia...“, fuhr er fort und Felice senkte den Kopf. „Sie ist sehr wichtig für mich...“
„Ich verstehe, dass sie wichtig für Euch ist. Jeder würde sich freuen, seine Verlobte zu treffen“, erwiderte Felice.
„Verlobte?“, fragte Tom völlig perplex. Wovon redete sie?
„Ihr wollt Mirlia doch heiraten“, meinte sie etwas unsicher. Heiraten? Tom vermutete, dass sie mit Berla oder Makian gesprochen hatte. „Du glaubst, ich wollte Mirlia heiraten?“, fragte er und konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Hilflos zuckte Felice mit den Schultern.
„Ich kenne Mirlia seit langer Zeit und ich liebe sie. Sie ist für mich wie meine Schwester und meine beste Freundin. Aber ich hatte nie vor, sie zu heiraten“, sagte er. „Und damit“, dachte er. „habe ich dir eindeutig zu viel erzählt.“ Viele Menschen vertrauten sich ihm an, doch er vertraute wenigen. Tom seufzte. Minerva hatte ihm vor vielen Jahren gesagt, dass es irgendwann so kommen würde und dann musste er gehen, ohne Wiederkehr.
Entschlossen schob er den Gedanken beiseite und wandte seine Aufmerksamkeit wieder Felice zu, die ihn verwirrt ansah. „Ich weiß, dass diese Reise nicht leicht für dich ist“, sagte er mit weicher Stimme und strich ihr über die Wange. Ihre Haut fühlte sich unter seinen Fingern weich und warm an. Tom hätte sie gerne in den Arm genommen, doch dazu ließ er sich nicht hinreißen. Stattdessen erhob er sich, nahm ihre Hand und half ihr aufzustehen.
„Morgen fangen wir an, uns mit Magie zu beschäftigen“, versprach er, als sie zum Lager zurückgingen.