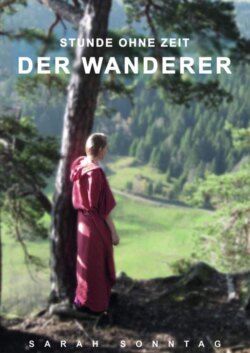Читать книгу Stunde ohne Zeit Der Wanderer - Sarah Sonntag - Страница 9
5
ОглавлениеMit einem Seufzer stellte Felice ihren Rucksack ab und ließ sich daneben zu Boden fallen. Tom warf ihr einen belustigten Blick zu, legte das Brennholz ab, das er auf dem Weg gesammelt hatte, und begann die Feuerstelle mit Steinen einzugrenzen.
Seit drei Tagen liefen sie durch den Wald von Arkarion und Felice wünschte sich, dass sie endlich ihr Ziel erreichten oder zumindest die Landschaft sich veränderte. Sie hatte das ewige Braungrün des Frühlingswaldes und den schmalen Trampelpfad, der immer wieder zwischen Farnen und Moosen verschwand, gründlich satt. Allmählich hatte sie das Gefühl blind zu werden. Außerdem waren sie keiner Menschenseele begegnet, was bedeutete, dass sie unter freiem Himmel schlafen mussten und das war im April nicht gerade ein Vergnügen. Zwar hatten sie Decken mitgenommen, aber die konnten die Kälte nicht völlig abhalten, der Boden bestand nicht gerade aus Schaumstoff und satt wurde sie auch nicht.
Tom schien sich von den Umständen nicht beeindrucken zu lassen. Ruhig ging er immer im selben Schritt vorwärts, war stets freundlich, sprach jedoch kaum ein Wort.
„Wandert Ihr oft hier?“, fragte Felice, als das Feuer in Gang gekommen war und sie ihre kärgliche Mahlzeit einnahmen.
Tom nickte. „Ich kenne dieses Land gut“, sagte er leise.
Felice hatte das Gefühl, dass es zu diesem Satz noch einige Gedanken mehr gab, doch er redete nicht weiter. Sie hätte das Gespräch gerne ins Laufen gebracht, einerseits weil Tom nie etwas über sich erzählte und jede Andeutung eine Errungenschaft war, andererseits weil sie fürchtete, dass er sie nach dem Essen wieder für mehrere Stunden alleine lassen würde. Er tat das jeden Abend und sie gruselte sich allein im dunklen Wald, auch wenn sie das nicht zugeben würde.
„Wo geht Ihr hin?“, fragte Felice, bevor sie sich bremsen konnte, als er sich erhob.
Er sah sie an. „Ich bleibe in der Nähe, du brauchst keine Angst zu haben“, antwortete er sanft.
„Ich habe keine Angst“, erwiderte sie hastig und wurde rot. „Bingo“, dachte sie, als er sie spöttisch ansah. Natürlich wusste er, dass sie log und sie hatte sich lächerlich gemacht.
Tom wandte sich ab und verschwand im Wald. Sofort fühlte Felice sich beobachtet. Mit sturem Blick starrte sie ins Feuer und versuchte den Wald um sich her auszublenden. Die Geräusche allerdings konnte sie nicht ignorieren. Es raschelte und knackte und in der Ferne begann ein Wolf zu heulen.
„Der hat bestimmt noch nicht zu Abend gegessen“, überlegte Felice. Sie fragte sich, was Tom machte und ob er gegen Angst immun war, da er kein Problem damit hatte, alleine abseits der Wege im Dunkeln umherzustreifen.
Ein zweiter Wolf stimmte in das Geheul ein und verdrängte Tom aus ihren Gedanken. Es schien ihr, dass das Heulen deutlich näher klang und sie begann sich auszumalen, wie die Wölfe auf lautlosen Pfoten heranschlichen. Das Heulen verstummte jäh, ein Windstoß fuhr durch die Zweige der Bäume und ließ Felice erschauern.
„Hör auf damit! Sonst fängst du noch an, an Geister zu glauben“, befahl sie sich. Zwei Minuten später fiel ihr ein, dass die unsichtbaren Wächter auch Geister gewesen waren. Unruhig rutschte sie auf ihrem Platz hin und her. Doch sie war erschöpft und allmählich verwebte sich das Rascheln der Blätter mit ihren Gedanken und ging dann in chaotische Träume über.
Das Nächste, was sie mitbekam, war ein trüber Morgen und die ersten Tropfen des nahenden Regens, die ihr ins Gesicht fielen. Tom war bereits aufgestanden und Felice war sich durchaus nicht sicher, ob er überhaupt geschlafen hatte. Sie rappelte sich hoch und begann zerstreut ihre Sachen zusammenzupacken.
„Bald erreichen wir den Waldrand und gegen Mittag kommen wir in ein Dorf, wo wir einen Tag Rast einlegen können“, munterte Tom sie auf. Die Aussicht, den Wald endlich hinter sich zu lassen, war tatsächlich eine Nachricht, die ihre Laune hob. Obwohl es unter den Bäumen wahrscheinlich trockener blieb, sollte es anfangen zu regnen.
Doch der Regen ließ auf sich warten. Erst als sie die Baumgrenze erreichten entlud er sich wolkenbruchartig über ihnen.
„Na, perfektes Timing!“, dachte Felice sarkastisch, während sie hinter Tom her stolperte, der in seinem schwarzen Umhang auch im Regen noch beeindruckend wirkte. Innerhalb weniger Minuten waren sie bis auf die Haut durchnässt und der Weg glich einem Schlammbad.
Schwer und Kalt klebte das Kleid an Felices Körper, schlang sich um ihre Beine und machte das Vorwärtskommen schwierig. Ihre Schuhe und der Saum des Kleides waren völlig mit Schlamm durchtränkt, der beim Gehen unangenehm über die Haut scheuerte. „Super! Ganz große Klasse!“, schimpfte sie leise vor sich hin und dachte an imprägnierte Regenkleidung, eine heiße Badewanne und Zentralheizung. Aber was auch immer sie im nächsten Dorf erwartete, diese Dinge waren ganz sicher nicht dabei.
Nach einer Weile ließ der Regen nach und als sie das Dorf erreichten, hörte er schließlich ganz auf. Eine breite, unbefestigte Straße, die nach dem Unwetter Sumpfqualitäten angenommen hatte, führte zwischen den dicht an den Boden geduckten Häusern entlang. Die Gebäude waren einstöckig und entbehrten jeden Luxus. Die Bewohner mussten entweder sehr arm sein oder hatten die Unterkünfte nur zweckmäßig zum Schlafen errichtet und hielten sich tagsüber woanders auf.
Tom schritt zu einem kleinen Platz, wo sich mehrerer Wege trafen und der die Mitte des Dorfes darzustellen schien. Dort stand ein größeres Haus, das sogar über ein zweites Stockwerk verfügte.
Auf ihr Klopfen öffnete sich die Tür und der erstaunte Ausruf eines Kindes erklang.
„Meister Tom!“ Ein Junge von etwa neun Jahren, mit blonden Locken und strahlend blauen Augen, stand im Eingang.
„Sei gegrüßt, Makian“, erwiderte Tom freundlich. „Lauf, sag Berla und Varandil, dass wir gekommen sind.“
Der Junge verschwand und eine Frau mittleren Alters erschien kurze Zeit später. Sie trug ein langes hellblaues Kleid, dem Felices sehr ähnlich und auf ihrem Arm saß ein Kind, das sie absetzte, als sie ihre Besucher erblickte.
„Meister Tom“, sagte sie, nahm seine Hand und küsste sie. „Ihr kommt zur rechten Zeit. Mein Mann ist schwer verletzt.“ Ihre großen, braunen Augen strahlten voll Dankbarkeit. „Doch kommt herein. Ihr seid durchnässt und müde von der Reise. Ich werde euch geben, was wir haben, auch wenn es nicht viel ist.“ Sie trat zurück ins Haus und führte sie in ein kleines Zimmer mit zwei Betten und einem Kamin. Sofort machte sie sich am Kamin zu schaffen, doch Tom hielt sie auf.
„Geht, Berla. Sagt Eurem Mann, dass ich gleich nach ihm sehen werde. Wenn Ihr könnt, bringt meiner Begleiterin hier etwas sauberes Wasser und erwärmt welches für Euren Mann. Ich kümmere mich um das Feuer.“
Berla verließ das Zimmer mit einem Blick auf Felice und Tom beugte sich über den Kamin. Felice konnte nicht sehen, was er tat, doch ein paar Sekunden später brannte dort ein munteres Feuer.
„Du solltest die nassen Sachen ausziehen“, bemerkte Tom sanft, während er sich selbst seines Umhangs entledigte. Die Kleidung darunter schien einigermaßen trocken zu sein. „Ich werde nach Berlas Mann sehen und dann schauen, ob ich etwas Trockenes für dich bekomme. Allerdings könnte es etwas länger dauern. Dort liegen Decken, die du bis dahin nehmen kannst.“ Er wies auf einen Stapel Decken, die sorgfältig zusammengelegt auf einem der Betten lagen und verschwand mit einer geschmeidigen Bewegung aus dem Raum. Einen Augenblick später erschien Berla mit einem Wassertrog, den sie mit einem stummen Kopfnicken vor dem Kamin abstellte, um dann Tom nachzueilen.
Langsam begann Felice das Kleid auszuziehen, was nicht ganz einfach war, da es klamm an ihrem Körper klebte. Zähneklappernd wusch sie sich mit kaltem Wasser den Schlamm vom Leib und reinigte das Kleid, bevor sie es zum Trocknen an den Kamin hängte. Sie wickelte sich in mehrere Decken und setzte sich möglichst nah ans Feuer. Es dauerte trotzdem eine ganze Weile, bis sie ihre tauben Zehen wieder spürte und aufhören konnte zu zittern. Ganz allmählich entspannten sich ihre Muskeln.
Sie begann sich zu fragen, wo Tom war. Kümmerte er sich immer um die Kranken? Ob sie deshalb hier wohnen durften? Sie hatte kein Geld in dieser seltsamen Welt, was bedeutete, dass, sollte sie nicht irgendeinen Weg finden, welches zu bekommen, Tom für sie aufkommen musste, solange sie unterwegs waren. Diese Vorstellung gefiel ihr nicht besonders. Sie wunderte sich auch, warum er überhaupt mit ihr reiste. Immerhin war es ihr Problem, dass sie nicht zurück konnte, nicht seines. Und er beklagte sich weder darüber, dass er sich um ihre Verpflegung kümmern, noch dass er ihretwegen diese Reise auf sich nehmen musste.
Und jetzt würden sie zusammen in einem Zimmer schlafen. Es war ihr am Anfang nicht ganz geheuer gewesen, mit einem fremden Mann durch den Wald zu wandern und auch nachts mit ihm alleine zu sein. Aber sie hatte sich daran gewöhnt. Doch es war noch etwas anderes, mit ihm in einem geschlossenen Raum schlafen zu müssen.
„Ich sollte nicht so viel über ihn nachdenken. Er wird mich schon nicht angreifen“, dachte sie träge und versuchte, ihn aus ihren Gedanken zu verbannen.
Felice war nahe daran einzuschlafen, als es leise an der Tür klopfte und Tom eintrat. Er reichte ihr ein sauberes Kleid und, wie sie dankbar feststellte, warme Socken. „Ich warte vor der Tür. Es gibt gleich etwas zu Essen“, teilte er ihr mit und zog die Tür hinter sich zu.
Müde kleidete Felice sich an und folgte ihm in den Essraum, wo die Familie bereits versammelt war. Der Mann saß in Decken und Kissen gehüllt neben seiner Frau, die das kleine Kind auf dem Schoß hatte. Auf ihrer anderen Seite saß der blond gelockte Junge.
„Setzt Euch“, bat Berla sie sanft. Die Blicke der ganzen Familie waren neugierig auf Felice gerichtet, die sich etwas unsicher auf einem Stuhl niederließ.
Plötzlich spürte sie Toms Hand mit sanftem Druck auf ihrer Schulter. Die Berührung ging wie ein Blitz durch ihren Körper. Seit er sie bei Minerva davor bewahrt hatte, mitsamt dem Stuhl umzukippen, hatte er sie nicht mehr angefasst. Deutlich konnte sie jetzt seine Präsenz hinter sich wahrnehmen.
„Das ist Felice. Sie begleitet mich auf meiner Wanderung“, sagte Tom und setzte sich auf den Stuhl neben ihr. Felice spürte, wie seine Hand ihren Arm entlang glitt, bevor sie sich löste. Einen Moment lang starrte sie wie benommen auf den Tisch, bis sie in der Lage war, ihre Gedanken zu ordnen und sich wieder der Familie zuzuwenden.
An diesem Abend ließ Felice ihr bisheriges Leben vor ihrem inneren Auge vorbeiziehen.
Alles was sie gelernt, was sie für richtig und real gehalten hatte, war in den letzten Tagen auf den Kopf gestellt worden. Magie - war ihr beigebracht worden - war ein Produkt der Phantasie, gut genug für Fantasyfilme und Kindergeschichten. Sie erinnerte sich an ihre Kindheit: Als sie noch recht klein gewesen war, hatte sie manchmal geglaubt Zwerge zu sehen, die sie bei einem Waldspaziergang vom Wegrand aus beobachteten. Doch die anderen hatten sie nur belächelt, wenn sie davon erzählte und sie hatte begriffen, dass diese Wesen ihrer Einbildung entsprangen und nichts mit der Realität zu tun hatten. In der Schule hatte sie dann viele nützliche Dinge gelernt, die ihr die Phantasiegestalten aus dem Kopf trieben. Die Erscheinungen waren schließlich auch ausgeblieben und sie hatte die Erinnerung an sie bis zu diesem Abend erfolgreich verdrängt.
Und jetzt fragte sie sich, ob wirklich alles nur Einbildung gewesen war. Was war dann mit Vergile? Die Welt in der sie sich jetzt befand und ihre ganze Reise mit Tom? Lag sie in Fieberträumen und phantasierte sich alles nur zusammen?
Soweit sie wusste, war sie nicht das einzige Kind, das „Wesen“ sah, doch sie hatte sich angewöhnt, diese Kinder, wie alle anderen Erwachsenen, zu belächeln. Wer bestimmte eigentlich, was real war und was nicht? Wenn die meisten Menschen blind waren und es nur wenige gab, die sehen konnten, musste die blinde Menge die Sehenden notwendigerweise für Lügner halten. Doch nur weil sie in der Mehrzahl waren, bewies das noch nicht, dass die Blinden Recht hatten. Und würden nicht einige der Sehenden ihre Augen verschließen und verdrängen, was sie gesehen hatten, nur um nicht ausgestoßen als Verrückte leben zu müssen?
Unruhig wälzte sich Felice in ihrem Bett herum und versuchte, diese Gedanken, die ihr Weltbild zerstörten, zur Seite zu schieben. Doch es gelang ihr nicht und plötzlich bekam sie Angst. Die Realität, die ihre Eltern ihr gezeigt hatten, schien sich aufzulösen. Aber gab es überhaupt eine feste Realität? Oder war das alles nur ein riesiger Traum, in dem am Ende alles und nichts möglich war? Zweifel nagten an ihr und sie fühlte sich klein und verloren.
Ihre Gedanken gingen in unruhige Träume über.
Sie irrte durch einen unwegsamen Wald. Die Sonne drang kaum durch die dichten Zweige der Bäume und wilde Tiere lauerten im Halbdunkel hinter Sträuchern und Stämmen. Hastig stolperte sie vorwärts, vor den Gefahren fliehend, die sie nur vage im Schatten erahnte. Doch der Wald wurde immer düsterer und das Vorwärtskommen immer schwieriger. Mit vor Angst flachem Atem eilte sie weiter, obwohl sie wusste, dass sie in die falsche Richtung lief.
„Felice!“, rief eine Stimme hinter ihr. Erschrocken drehte sie sich um. Da stand Tom mit wehendem schwarzem Umhang, wenige Schritte von ihr entfernt.
„Ich kann den Weg nicht finden und hier ist es gefährlich“, keuchte Felice.
„Wenn du den Weg finden willst, musst du nur hinschauen“, erwiderte er. Und plötzlich konnte sie sehen, dass er auf dem Weg stand, der im strahlenden Sonnenlicht, nicht weit von ihr, durch den Wald verlief.
Felice erwachte mit einem brennenden Gedanken: Sie wollte von Tom lernen.
Es war ihr peinlich, dass sie von ihm geträumt hatte, doch immerhin hatte er ihr Leben völlig über den Haufen geworfen und daher war es wahrscheinlich nur natürlich.
Da es noch dunkel war und er regungslos in dem Bett neben ihr lag, drehte sie sich auf die andere Seite und schlief traumlos bis zum Morgen.
Als Felice wach wurde, hatte Tom das Zimmer bereits verlassen. Sie beeilte sich mit dem Anziehen und ging in den Essraum, wo sie ihn allein am Tisch sitzend fand. Freundlich schob er ihr eine Schale mit Brei zu, der allerdings nicht sehr Appetit anregend aussah.
Auf einmal fühlte sie sich unsicher und wusste nicht, ob sie ihn tatsächlich fragen sollte, sie zu unterrichten. Um Zeit zu gewinnen, schob sie sich Brei in den Mund, ohne wirklich etwas zu schmecken. Halb hoffte sie, dass Tom aufstehen würde und sie ihre Frage auf später verschieben musste. Doch er blieb sitzen und schließlich war ihre Schale leer.
Sie räusperte sich und begann zögernd zu sprechen: „Kann ich Euch etwas fragen?“ Tom sah sie an und nickte. Obwohl er eine abwartende Haltung einnahm, hatte sie das Gefühl, dass er bereits wusste oder zumindest erahnte, was sie wollte.
„Vor ein paar Tagen habt Ihr gesagt, was Ihr tut, sei... lebendige Mathematik“, begann Felice und errötete bei dem Gedanken, dass ihre Absicht leicht zu durchschauen war. Doch Tom hörte schweigend zu. Da er nichts sagte, fuhr sie fort: „Mathematik kann man lernen... was Ihr tut auch?“
Tom lächelte. „Man kann alles lernen. Wenn man den Willen dazu hat“, antwortete er.
„Und würdet Ihr mich unterrichten?“, fragte Felice nervös, da er nicht weitersprach.
Er beugte sich leicht zu ihr vor und sah ihr mit funkelndem Blick in die Augen. Felice hatte das Gefühl, dass er bis auf den Grund ihres Seins schaute. Verlegen schlug sie die Augen nieder und plötzlich, ohne dass sie einen Grund dafür nennen oder es verhindern konnte, spürte sie, wie Tränen über ihre Wangen liefen. Sie wusste nicht warum, aber sie war auf einmal traurig. Sie wollte sich abwenden, davonlaufen, um den unerklärlichen Schmerz zu verbergen, doch Tom fasste ihre Hand und hielt sie zurück.
„Schäme dich nicht für deine Tränen“, sagte er leise. „Sie zeigen, wer du bist.“ Er strich eine Haarsträhne, die ihr ins Gesicht gefallen war, sanft hinters Ohr. Seine Finger berührten dabei leicht ihre Haut und sie erschauerte.
„Sieh mich an. Hab keine Angst. Es liegt nicht in meinem Bestreben dir weh zu tun“, fügte er sanft hinzu. Felice versuchte zu lächeln und ihn anzusehen, es kamen jedoch immer neue Tränen und sie konnte seinem Blick nicht standhalten.
„Magie hat nichts mit Harry–Potter–Zauberei zu tun“, begann Tom ernst. „Es dauert viele Jahre und fordert viel Selbstdisziplin, wenn man wirklich etwas erreichen will.“ Er hielt inne. Felice spürte die Wärme, die seine Hand, die die ihre immer noch umfasst hielt, ausstrahlte.
„Ich kann dir in der kurzen Zeit, die unsere Reise dauert, ein paar Grundsätze zeigen. Doch Vieles wirst du erst später wirklich verstehen. Und es gibt eine Bedingung“, fuhr er mit ruhiger Stimme fort. „Der Umgang mit Magie ist kein Spiel. Wenn ich dich unterrichte, bin ich dein Lehrer und trage Verantwortung für dich. Deshalb musst du meinen Anweisungen bedingungslos Folge leisten.“
Tom sah sie durchdringend an. „Egal was es ist, egal wie unsinnig es dir erscheint und egal was es dich selbst kosten mag, du musst gehorchen. Ich will, dass du begreifst, was es bedeutet. Du wurdest zu einem Menschen erzogen, der seine eigenen freien Entscheidungen trifft. Du musst auf diese Freiheit verzichten. Kannst du das?“
Obwohl Felice ihn nicht ansah, spürte sie die Blicke, die sie durchdrangen. Tom hatte ihre Hand losgelassen.
„Du gibst mir viel Macht über dich. Das heißt, du musst dir sicher sein, dass du mir vertraust“, sagte er leise.
„Ich vertraue Euch“, erwiderte Felice prompt. Toms Worte waren nicht sehr ermutigend gewesen, aber sie übten einen eigenartigen Sog auf sie aus.
„Versprich mir, dass du mir gehorchst!“, forderte er, mit einem scharfen Unterton in der Stimme.
Felice zögerte. „Wenn ich irgendwann meine Meinung ändere...“, fragte sie vorsichtig.
„Bist du frei“, beendete Tom den Satz für sie. „Ich will nicht deinen Willen brechen, sondern dich schützen.“
„Gut. Ich verspreche, Euren Anweisungen zu folgen“, sagte Felice. Halb war sie erleichtert, halb fragte sie sich bereits, ob sie nicht doch einen Fehler gemacht hatte, solch ein Versprechen abzugeben. Ihr Verstand sagte ihr, dass sie verrückt war, einem Menschen, den sie kaum kannte, soviel Vertrauen entgegen zu bringen. Sie war sich sicher, dass er die Macht hatte, sie an ihr Versprechen zu binden und sie es nicht einfach brechen konnte.
Schulterzuckend schob sie den Gedanken beiseite.
„Vermutlich hatte er auch ohne das Versprechen zu viel Macht über mich“, dachte sie verdrossen.
Männer wie Tom faszinierten sowohl Männer als auch Frauen mit ihrem Charisma. Sie schenkten allen Menschen gleichermaßen ihre Aufmerksamkeit, hatten jedoch nur wenige enge Freunde. Die Menschen erzählten ihnen ihre tiefsten Geheimnisse, doch aus ihnen waren kaum persönliche Informationen herauszubekommen. Es war nicht klug sein Herz an einen Menschen wie ihn zu verlieren, denn entweder hatte er seine Dame bereits gewählt, hatte nur kurze oberflächliche Rendezvous mit einzelnen Frauen oder ging dem weiblichen Geschlecht völlig aus dem Weg.
„Meister Tom!“ Makian, der blonde Junge ihrer Gastgeber, kam in den Raum gestürmt. Lächelnd wandte Tom ihm seine Aufmerksamkeit zu.
Der Junge blieb ehrerbietig vor ihm stehen. Es war ihm anzusehen, dass es ihm schwer fiel, seine Begeisterung zu zügeln. „Darf ich Euch bei Eurer Arbeit zuschauen?“, fragte er, nach Atem ringend. Er musste ein ganzes Stück gerannt sein, um noch rechtzeitig zu Hause anzukommen.
„Ein wenig“, nickte Tom freundlich. Geschmeidig stand er auf und bedeutete Felice mitzukommen.
„Die alte Worna hat Schmerzen in den Fingern und in den Knien. Onkel Berland sagt, er hat die Schlafkrankheit und will am liebsten gar nicht mehr aufstehen und Marlia bekommt bald ein Baby. Aber sonst weiß ich nichts“, erzählte der Junge fröhlich, während sie das Haus verließen und einer schmalen Gasse durch das Dorf folgten.
„Gut“, erwiderte Tom. „ Dann gehen wir zuerst zu Worna.“
Worna war, wie sich herausstellte, ein altes Mütterchen, das alleine in einer Hütte am Rand des Dorfes wohnte. Während Tom mit ihr sprach, warteten Makian und Felice vor der Tür. Die Sonne schien und sie machten es sich auf dem Gartenmäuerchen bequem. Makian sah sie von der Seite an.
„Wart Ihr traurig, vorhin, als ich gekommen bin?“, fragte er zaghaft.
„Das hast du gemerkt?“, lächelte Felice.
Makian zuckte mit den Schultern. „Meister Tom sagt, man muss immer darauf achten, wie es den Menschen geht, dann erzählen sie einem auch etwas. Und nur dann kann man ihnen helfen.“ Mit einem Seufzer sah er Felice an. „Ich möchte auch mal werden wie Meister Tom.“ Seine Augen begannen bei der Vorstellung zu leuchten.
Felice nickte. „Das glaube ich dir gerne“, erwiderte sie. In diesem Augenblick rief Tom nach Makian und der Junge sprang davon. Es dauerte eine ganze Weile, bevor sie wieder aus der Hütte traten und sie sich zusammen auf den Weg zu Marlia, der schwangeren Frau, machten.
So ging es bis zum späten Nachmittag weiter. Sie statteten den meisten Dorfbewohnern einen Besuch ab. Meistens sprach Tom allein mit ihnen, manchmal rief er Makian dazu und in einigen wenigen Fällen bat er auch Felice, ihm Hilfe zu leisten und etwas zu holen, Wasser zu erwärmen oder ähnliche Kleinarbeiten zu erledigen. Felice fühlte sich gekränkt. Warum bevorzugte Tom Makians Hilfe vor ihrer? Warum musste sie draußen warten, während der Junge den Gesprächen zuhören durfte? Sie war verletzt und fühlte sich überflüssig. Die wenigen Arbeiten, die sie verrichtete, hätte Tom auch gut selbst machen können.
Als sie endlich auf dem Rückweg waren, löste sich eine junge Frau aus dem Schatten eines Hauses.
„Tom!“, rief sie und lief leichtfüßig auf sie zu. Ihr braunes Haar und der Saum ihres Kleides flatterten im Wind hinter ihr her.
„Mirlia!“, erwiderte Tom freudig überrascht, fing sie in seinen Armen auf und drehte sie im Kreis um sich herum. „Mirlia“, wiederholte er leiser und drückte sie an sich.
Felice spürte einen Stich, als sie sah, mit welcher Liebe Tom die junge Frau betrachtete. Das war zu viel für sie an einem Tag. Sie war den ganzen Tag sinnlos hinter Tom hergelaufen, sie war müde und jetzt war da zu allem Überfluss auch noch diese Frau. Mal abgesehen davon, dass sie seit Tagen einem fremden Mann durch eine völlig fremde Welt folgte, in der die Menschen noch wie im Mittelalter lebten: Konnte ihr nicht mal jemand sagen, dass sie das gut machte? Und konnte nicht jemand sie so anschauen, wie Tom jetzt diese Mirlia anschaute? Sie bereute, dass sie so leichtsinnig ein Versprechen abgegeben hatte, dass sie an diesen Mann binden würde.
„Du wusstest, dass es so kommen könnte! Und es ist besser, dass du jetzt erfährst, dass er bereits vergeben ist, als erst, wenn du dich schon richtig in ihn verliebt hast. Außerdem ist er eh nichts für dich“, versuchte sie sich zu trösten, doch sie musste zugeben, dass sie gehofft hatte, dass er seine Wahl noch nicht getroffen hatte.
„Makian“, sagte Tom. „Zeige doch Felice deinen Schatz. Ich komme später nach.“
Begeistert griff der Junge nach ihrer Hand und zog sie mit sich fort. Felice achtete sorgfältig darauf, dass Tom ihr Gesicht nicht sehen konnte, als sie Makian folgte. Doch sie konnte nicht verhindern, sich vorzustellen, wie sich die beiden hinter ihrem Rücken küssten. Am liebsten wäre sie alleine gewesen, aber wenn sie nicht wollte, dass Tom merkte, dass sie verletzt war, musste sie sich zusammenreißen.
Makian führte sie nach Hause in sein Zimmer, wo er eine Holzschatulle unter seinem Bett hervorzog.
„Die hat mir Meister Tom geschenkt“, erklärte er stolz. Felice nickte abwesend.
Vorsichtig öffnete Makian die Schatulle und legte die Gegenstände, die sich darin befanden, nebeneinander auf das Bett.
„Seht“, sagte er und ergriff einen geschnitzten Ast. „der Eichenstab für den Osten und die Luft. Die Goldsichel“ er zeigte auf eine Sichel, die er gelb angemalt hatte „für den Süden und das Feuer. Der Muschelkelch“ er deutete darauf. „für den Westen und das Wasser. Und der Stein für den Norden und die Erde“, endete er und hielt den Stein hoch.
„Aha. Schön“, sagte Felice ein wenig ratlos. „Hast du die Sachen selber gemacht?“ fragte sie, um noch etwas anderes zu sagen. Der Junge nickte. „Am schwersten war der Muschelkelch“, erzählte er. „Ein Händler hat sie mir gegeben, aber er wollte dafür alle Holztiere, die mein Vater mir geschnitzt hat, haben“, fügte er mit leichtem Bedauern hinzu. Dann schien er zu bemerken, dass Felice nicht richtig bei der Sache war. „Seid Ihr jetzt wieder traurig?“, fragte er.
„Kennst du Mirlia?“, wollte Felice statt einer Antwort wissen. Sie versuchte die Frage nebensächlich und unwichtig klingen zu lassen.
„Sie ist ganz schön, stimmt´s?“ Makian sah Felice an. „Sie hat Meister Tom sehr lieb. Mama sagt, er wird sie mal heiraten“, verriet er ihr flüsternd mit Verschwörermiene.