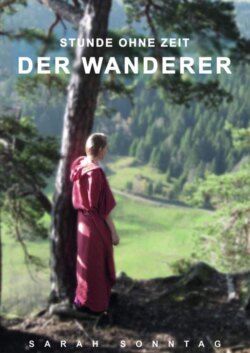Читать книгу Stunde ohne Zeit Der Wanderer - Sarah Sonntag - Страница 6
2
ОглавлениеIm Nachhinein wusste Felice nicht mehr, wie sie die folgenden drei Wochen und die Prüfung hinter sich gebracht hatte. Ihre Klausurnoten waren ganz gut ausgefallen, die Grundschule erteilte ihr eine Absage.
Sie genoss die freie Zeit, die sie hatte, wenn sie nicht gerade in der Buchhandlung half und war viel draußen in der Natur. Und als ihre Eltern eine Weile ohne Bella wegfahren wollten, nahm sie den Hund zu sich. Die Oktobertage blieben warm und trocken und so verabredete sich Felice für den letzten Samstag des Monats mit ihrer Freundin Andrea. Sie wollten ein Stück von der Stadt entfernt einen Rundwanderweg ausprobieren, den sie beide noch nicht kannten.
Vorsorglich ließ sie an dem Tag ihr Handy zu Hause, um sich nicht durch irgendwelche Anrufer, zum Beispiel ihren Chef - der es auch fertig brächte, sie von einem Waldspaziergang abzukommandieren - stören zu lassen. Sie nahm Bella und fuhr mit dem Zug zu dem Dorf, wo der Rundweg begann. Andrea wartete schon auf sie. Es war ein schöner Tag, der noch viel von der Wärme des vergangenen Sommers in sich trug und so machten sie sich gut gelaunt auf den Weg. Die Bäume um sie her leuchteten golden im Sonnenlicht, am Wegrand wuchsen rote Beeren und Vogelscharen waren am Himmel zu sehen. Nach den Prüfungen und der Trennung von Eric fühlte sich Felice federleicht. Sie lachte und alberte mit Andrea, die auch glänzender Laune war. Gegen Mittag machten sie auf einer kleinen Bank Rast, aßen ihr mitgebrachtes Proviant und plauderten. Über die Hälfte des Weges war geschafft und so gingen sie erst am späteren Nachmittag weiter. Etwa eine halbe Stunde, nachdem sie wieder aufgebrochen waren, kamen sie zu einer Weggabelung, die auf der Wanderkarte nicht eingezeichnet war.
„Ich würde vorschlagen, wir gehen nach links“, sagte Felice, da sie keinen Wegweiser entdecken konnten.
„Der Sonne nach zu schließen müssten wir nach rechts“, entgegnete Andrea mit einem Blick zum Himmel.
„Du mit deinen Himmelskenntnissen, da kommen wir am Ende noch am Nordpol raus“, spöttelte Felice. Sie selbst nicht sagen können, warum, aber der linke Weg übte eine starke Anziehung auf sie aus. Halb unbewusst machte sie einen Schritt in seine Richtung. Empört sah Andrea sie an. „Okay, mal sehen, wer zuerst zu Hause ist“, sagte sie herausfordernd.
„Gut“ erwiderte Felice lachend „aber ich habe Bella.“
„Ich habe die Hundekuchen“, versetzte Andrea feixend. „Komm Bella!“, fügte sie an den Hund gewandt hinzu und machte sich mit der Hundekuchentüte raschelnd auf den Weg. Bella lief ihr hinterher.
„Ich bin trotzdem zuerst zu Hause“, rief Felice ihr vergnügt nach. Sie macht sich sofort auf den Weg, immer dem linken Pfad nach. Wenige Minuten später hatte sie Andrea schon fast vergessen. Leise vor sich hin summend überquerte sie von Stein zu Stein springend einen Bach, der ihren Weg kreuzte. Sanft wogten die Baumwipfel über ihrem Kopf. Die Vögel sangen und alles war friedlich. Manchmal tauchten Baumstämme oder sperrige Äste vor ihr auf, die ihr den Weg versperrten. Dann kletterte und balancierte sie darüber, wie sie es als junges Mädchen getan hatte. Einmal beobachtete sie ein Eichhörnchen, das in einem Busch flink von Ast zu Ast sprang, um dann laut schimpfend den glatten Stamm eines Baumes hinaufzurennen. Felice lachte ihm hinterher. Das Ganze erschien ihr fast wie ein Abenteuer. Es kam ihr merkwürdig vor, dass die Zeit verging, ohne dass sie andere Wege kreuzte oder der Wald sich lichtete. Aber etwas trieb sie an weiterzugehen und so schob sie die Zweifel beiseite.
Der Nachmittag ging allmählich zur Neige und der Pfad, dem Felice folgte, wurde immer schmaler, bis er sich schließlich ganz auflöste. Als sie merkte, dass sie ihn verloren hatte, war es unter den Bäumen schon ziemlich schattig. Ratlos lief sie ein Stück zurück, doch sie war sich nicht sicher, ob sie richtig ging und im Dämmerlicht konnte sie nicht weit sehen.
„Hurra, verloren in der Wildnis!“, dachte sie sarkastisch und musste unwillkürlich grinsen. Doch als sie den Pfad nach mehreren Minuten noch immer nicht gefunden hatte, war ihr ganz und gar nicht mehr zum Lachen zu Mute. Nach dem warmen Tag war es nun unangenehm kühl und der Wald wurde ihr langsam unheimlich. Da sie wenig sehen konnte, schienen alle Geräusche umso deutlicher zu werden. Eine leichte Brise kam auf und ließ Felice frösteln. Die Bäume stöhnten leise, wenn der Wind durch die Kronen strich. Es wurde dunkler und der Wald erwachte zum Leben. Fledermäuse flatterten über Felice hinweg. Es raschelte und knackte, und es gab noch andere Geräusche, die sie nicht zuordnen konnte. „Wenn ich immer in eine Richtung gehe, muss ich doch irgendwo rauskommen“, murmelte sie und stapfte aufs Geratewohl los. Um sich Mut zu machen, trat sie fester auf als nötig. Plötzlich brach sie mit dem linken Fuß durch ein paar Zweige in ein Erdloch und knickte um. Sie stürzte. „Aua, aua, aua“, jammerte sie halblaut und Tränen schossen ihr in die Augen. Stechende Schmerzen durchzuckten ihren Fuß. Sie versuchte ihn aus dem Loch zu ziehen, doch das ließ sie schnell wieder bleiben. So gut es ging, setzte sie sich auf und betrachtete den entstandenen Schaden. Ihre Hände waren von dem Sturz aufgeschürft und ihre Jeans am Knie zerrissen. Während sie versuchte die Äste von dem Loch, in welchem ihr Fuß steckte, wegzuziehen, schimpfte sie leise vor sich hin. Schließlich gelang es ihr, den Fuß zu befreien. Vorsichtig zog sie ihn aus dem Loch und betastete ihn. Missmutig dachte sie an ihr Handy, das sicher verwahrt zu Hause auf dem Küchentisch lag, als der Fuß zu stechen begann. „Hilfe“, rief sie kläglich. Aber natürlich würde niemand sie hören. „Hilfe“, versuchte sie es noch einmal lauter. Doch der Wald verschluckte ihre Rufe. Nur die schweigende Dunkelheit dröhnte ihr entgegen.
Mühsam versuchte Felice sich aufzurichten, ohne den verletzten Fuß zu belasten.
„So komme ich nie nach Hause“, dachte sie resigniert. „Vielleicht werde ich erfrieren.“ Sie schauderte. Schon jetzt war ihr ziemlich kalt und die Temperatur sank in den Oktobernächten bis an den Gefrierpunkt. Sie hatte nur einen dünnen Pullover an. Immerhin hatte sie vorgehabt, vor der Dämmerung zu Hause zu sein. Ihr Magen knurrte. Ungeschickt hüpfte sie vorwärts und holte sich dabei Schrammen und Kratzer. Nach wenigen Schritten fiel sie hin. Unwirsch rappelte sie sich wieder auf und hüpfte weiter. Nachdem sie das dritte Mal aufgestanden und wieder hingefallen war, konnte sie nicht mehr. „So geht das nicht“, dachte sie leicht panisch. „Kann mir jemand helfen… irgendjemand…“, fügte sie hoffnungslos hinzu. Wer ging schon um diese Uhrzeit in der Natur spazieren?
Inzwischen war rund und voll der Mond über dem Wald aufgegangen und tauchte alles in sein gespenstisches Licht. Schatten sprangen über den Boden. Felice saß zusammengekauert an einen Baum gelehnt und lauschte. Die Bäume knarrten, das Laub raschelte wie Geflüster. Tiere huschten immer wieder an ihr vorbei. Sie zitterte vor Kälte und sie hatte Hunger. Wie sollte sie wieder nach Hause kommen? Sie dachte an ihre Eltern. Was würden sie tun, wenn sie Bella holen wollten und ihre Tochter nicht da war? Und Andrea? Sie würde vielleicht die Polizei alarmieren, wenn Felice nicht nach Hause kam. Es konnte allerdings dauern, bis etwas passierte… So schnell schickte man keine Suchtrupps durch den Wald. Inzwischen war sie vielleicht erfroren. Sie schauderte.
Schweres Federgeraschel ließ Felice aus ihren Gedanken aufschrecken. Sie sah nach oben. Ein großer Vogel landete auf einem Ast des nächsten Baumes. Er schuhute traurig.
„Was mache ich hier eigentlich?“, dachte Felice. „Ich muss aufstehen und mich bewegen! Ich kann nicht hier rumsitzen und warten, dass irgendwer kommt oder ich zur Eisleiche erstarrt bin.“ Da sie es nicht schaffte aufzustehen, begann sie auf Händen und Knien vorwärts zu kriechen. Der Vogel beobachtete sie und flog ihr nach. Felice ignorierte die Schrammen, die sie sich zuzog und kroch immer weiter. Doch sie war erschöpft vom Tag und nach etwa 200 Metern, die ihr eher wie zwei Kilometer vorkamen, ließ sie sich fallen und blieb liegen. Der Vogel flatterte auf einen Ast in ihrer Nähe und sah stumm auf sie herab.
„Hilfe“, sagte Felice matt und dann schrie sie noch einmal lauter: „Hilfe!“ Mit geschlossenen Augen lag sie zusammengerollt am Boden und malte sich ihr Schicksal aus. Langsam glitt sie in einen Halbschlaf.
Sie erwachte jäh, als helles Licht durch ihre Lider drang. „Hilfe“, murmelte sie und öffnete die Augen. Wegen des grellen Lichts einer Taschenlampe, das ihr ins Gesicht schien, konnte sie nur ungenau die Gestalt eines Menschen erkennen, der vor ihr stand.
„Hallo? Können Sie mich hören?“, fragte eine Stimme, die ihr vage bekannt vorkam. Die Gestalt kniete sich zu ihr, die Taschenlampe wurde abgeblendet und Felice erkannte den Mann aus dem Nachbarhaus ihrer Eltern.
„Hallo“, erwiderte sie leise. „Wie haben Sie mich gefunden?“
„Ich war zufällig in der Nähe und hörte sie rufen“, sagte er sanft. „Sie sehen nicht gut aus. Können Sie laufen?“, fügte er hinzu. Vorsichtig versuchte Felice sich aufzurichten. Doch der Fremde schüttelte den Kopf. „Nein, so kommen wir nicht vorwärts. Warten Sie!“ Er schob seine Arme unter ihren Körper und hob sie einfach vom Boden hoch. Dann trug er sie mit federnden, kaum hörbaren Schritten durch den Wald. Felice hatte nicht mehr die Kraft verlegen zu sein. Sie war einfach nur dankbar, dass jemand sie gefunden hatte und sie nicht allein im Wald lag und fror.
Vielleicht war sie eingeschlafen, jedenfalls war das nächste, was sie mitbekam, dass sie auf ein Bett gelegt und eine Decke über sie gebreitet wurde. Das Bett war weich, ihr war wohlig warm und der Schmerz in ihrem Fuß war zu einem dumpfen Pochen abgeflaut. Am liebsten hätte sie einfach weiter geschlafen, aber sie dachte an Andrea, die sich bestimmt Sorgen machte. Sie öffnete die Augen und richtete sich auf. Sie befand sich in einem kleinen Raum, der einfach eingerichtet war: In einer Ecke gegenüber ihrem Bett stand ein schmaler Tisch mit einem Stuhl davor, eine Kommode war an der Wand platziert. Der Nachbar ihrer Eltern stand mit dem Rücken zu ihr an einem Waschbecken.
Er trocknete sich sorgfältig die Hände ab, bevor er sich ihr zuwandte. „Sie sind wach“, sagte er ruhig, nahm sich den Stuhl und setzte sich zu ihr ans Bett. „Wie geht es Ihnen?“, fragte er und musterte sie. Felice hatte das unangenehme Gefühl, dass sein Blick durch ihren Körper hindurch bis in ihr Unterbewusstsein drang und sich ihm alle ihre Geheimnisse offenbarten. Verlegen sah sie weg und betrachtete stattdessen die Hände des Mannes. Sie waren groß, braungebrannt und sahen sehr gepflegt aus.
„Gut“, versuchte sie zu sagen, doch sie brachte nur ein heiseres Krächzen heraus. Sie räusperte sich und bemerkte, dass ihr Hals rau war und brannte. „Gut“, wiederholte sie.
„Ich bin Arzt.“ Der Mann lächelte. „Sie sehen ziemlich mitgenommen aus. Es könnte sein, dass Sie ein wenig Fieber bekommen werden. Sie waren ganz schön ausgekühlt, als ich Sie gefunden habe.“ Er schwieg einen Moment und sah sie an. Dann fuhr er fort: „Wenn Sie sich kräftig genug fühlen, möchten Sie vielleicht duschen. Und ich würde gerne Ihren Fuß untersuchen. Er sieht ein wenig... lädiert aus.“ Seine Stimme hatte einen warmen, beruhigenden Klang.
Felice nickte. „Danke für Ihre Hilfe. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn Sie mich nicht gefunden hätten“, sagte sie leise. Das Reden strengte sie an und verursachte ihr Schmerzen im Hals. „Dann hätte es vielleicht ein anderer getan“, erwiderte der Mann, doch seine dunklen Augen blieben ernst und er lächelte nicht.
Felice wusste nicht, was sie dazu sagen sollte. Beim besten Willen konnte sie sich nicht vorstellen, wer sie sonst hätte finden können. Es grenzte schon an ein Wunder, dass er sie gefunden hatte. Schließlich gingen nicht haufenweise Leute nach Einbruch der Dunkelheit im tiefsten Wald spazieren, noch dazu abseits der Wege. Aber das zu erklären kam ihr viel zu umständlich und anstrengend vor. Stattdessen fragte sie: „Meine Freundin wartet auf mich. Könnte ich mal kurz mit ihr telefonieren? Oder“, fügte sie halbherzig hinzu „komme ich von hier aus irgendwie nach Hause?“
„Ja, Sie können telefonieren. Nein, Sie kommen von hier aus nicht nach Hause, außer Sie haben Lust auf einen mehrstündigen Fußmarsch. Außerdem sind Sie zu schwach. Ich werde Sie morgen nach Hause bringen, wenn Ihr Zustand es erlaubt.“ Ein scharfer Unterton lag nun in seiner sanften Stimme und in seinen Augen flackerte es. Felice war ein wenig erschrocken über seine Reaktion. Eigentlich musste er doch froh sein über jede Gelegenheit, sie loszuwerden. Der Mann verschwand und erschien fast sofort wieder mit einem Telefon in der Hand. Er reichte es Felice und ließ sie dann allein, damit sie ungestört reden konnte.
Es hatte kaum einmal getutet, als Andrea abnahm.
„Andrea Siebenlist.“
„Hallo, ich bin´s“, antwortete Felice.
„Oh Gott sei Dank, Felice! Ich habe mir schon solche Sorgen gemacht! Wo steckst du denn? Ist was passiert?“, tönte es ihr entgegen.
„Äh, ich habe mich verlaufen. Mein Nachbar hat mich aufgegabelt und da bin ich jetzt“, antwortete sie. Sie musste sich mehrmals räuspern und es strengte sie an, in halbwegs verständlicher Lautstärke zu sprechen. „Dein Nachbar. Heißt das, du bist zu Hause? Hat er auch einen Namen? Und wie hörst du dich überhaupt an?“, fragte Andrea misstrauisch.
„Ich hatte noch keine Gelegenheit ihn zu fragen.“ Felice runzelte die Stirn. „Nein, ich bin nicht zu Hause. Er scheint mehrere Wohnungen zu haben. Er ist Arzt. Du, ich erzähl´s dir, wenn wir uns sehen. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen.“ Das Telefonat und Andreas Aufregung strengten sie an.
„Gut“, sagte Andrea skeptisch. „Aber melde dich morgen wieder. Wenn ich nichts von dir höre, rufe ich die Polizei.“
„Okay. Danke“, antwortete Felice matt und legte auf.
Einen Moment blieb sie sitzen, dann stand sie auf, um den Mann zu suchen. Sie machte einen unsicheren Schritt nach vorne und blieb stehen. Ihr Kopf dröhnte, schwarze Flecken tanzten ihr vor den Augen und ihr schwindelte. Alles drehte sich. Erfolglos suchte sie mit der Hand nach einem Halt. Ihr Fuß begann heftig zu stechen, als sie ihn belastete. Sie taumelte vorwärts. In dem Augenblick kam der Mann herein und fing sie auf.
„Langsam, langsam“, sagte er und setzte sie auf das Bett zurück. Felice wartete, bis der Schwindel vorüber war. „Oh Gott“, stöhnte sie und strich sich mit der Hand über die Stirn.
Der Mann sah sie besorgt an und legte ihr eine Hand auf die Stirn. Sie fühlte sich weich und kühl an. „Geben sie ihrem Körper Zeit“, meinte er sanft. „haben Sie mit Ihrer Freundin gesprochen?“
„Ja“, antwortete Felice. „Sie hat schon einen ziemlichen Wirbel veranstaltet und will die Polizei holen, falls ich mich nicht melde.“ Sie war bemüht ihrer Stimme einen beiläufigen, etwas entnervten Ton zu geben, aber er durchschaute sie sofort.
„Und jetzt soll ich Ihnen sagen, ob das nötig ist“, stellte er mit leichtem Spott fest. Er schwieg und sah sie durchdringend an. Seine Augen schienen zu glühen. Ein Schauer lief ihr über den Rücken.
„Was denken Sie denn?“, fragte er leise.
Hilflos zuckte sie mit den Schultern. „Ich kenne nicht einmal Ihren Namen“, erwiderte sie.
„Würde mein Name denn etwas ändern?“, wollte er wissen und beugte sich leicht zu ihr vor.
Felice errötete. Sie wollte woanders hinsehen, doch er hielt sie mit seinem Blick gefangen. „Glauben Sie, ich bin gefährlich?“, fragte er und klang sanft und bedrohlich zugleich.
„Vielleicht“, hauchte sie und wurde noch röter.
Er lehnte sich von ihr weg, seine Stimme bekam wieder ihren beruhigenden Klang und der Bann brach. „Ja, vielleicht bin ich gefährlich. Aber Sie können unbesorgt sein. Als Arzt habe ich den Eid geleistet, Leben zu schützen, nicht sie zu zerstören. Ich heiße Tom Andarin.“
Bei dem Namen regte sich etwas in Felices Kopf, doch sie kam nicht darauf, wo sie den Namen schon gehört hatte. Und Herr Andarin ließ ihr keine Zeit nachzudenken.
„Kommen Sie!“, sagte er und half ihr auf. Diesmal flaute das Schwindelgefühl schnell wieder ab. Auf wackeligen Beinen folgte sie ihm über den kleinen Flur zum Badezimmer.
„Ich habe Ihnen saubere Schlafkleidung und Handtücher rein gelegt. Duschen Sie nur kurz und rufen Sie, wenn Sie Hilfe brauchen“, wies er sie an. „In zwanzig Minuten komme ich und schaue nach Ihnen.“ Felice spürte, wie sie erneut von Schwindel ergriffen wurde. Hitze und Kälte spielten mit ihrem Körper und der Fußboden schien sich zu verselbstständigen. „Ich schaue in fünfzehn Minuten nach Ihnen“, korrigierte sich Herr Andarin und stützte sie. Sie wartete, bis sie wieder alleine stehen konnte, dann humpelte sie ins Badezimmer und schloss die Tür hinter sich.
Als erstes bemerkte sie, dass es keinen Schlüssel gab, als zweites den mannhohen Spiegel. Erschrocken sah sie ihr Spiegelbild an. Ihre Kleidung war zerrissen, sie hatte überall Kratzer, war kreidebleich und dreckverschmiert. Sie ließ sich auf den Toilettendeckel sinken und warf einen Blick zur Tür. Langsam begann sie sich auszuziehen. Sie hoffte, dass Herr Andarin nicht hereinplatzen würde, während sie unter der Dusche stand. Doch nachdem sie es geschafft hatte, sich ihrer Kleidung zu entledigen - was nicht leicht war, da sie versuchte, weder ihren Fuß, der inzwischen deutlich angeschwollen war, zu belasten, noch vor Schwindel vom Stuhl zu fallen - war es ihr egal. Immerhin war er Arzt.
Mühsam stand Felice auf, humpelte zur Dusche und kletterte hinein. Drinnen lehnte sie sich gegen die kühle Wand und wartete bis die Welle von Schwindel und Übelkeit vorüber war. „Oh Gott“, dachte sie. „Wie kann es einem innerhalb so kurzer Zeit so schlecht gehen.“ Sie drehte die Dusche auf und ließ sich das heiße Wasser über den Körper laufen.
Wie sich herausstellte, war ihre Sorge, Herr Andarin könnte hereinkommen, unbegründet gewesen. Er klopfte erst, als sie gerade fertig angezogen war. „Ja, herein“, antwortete Felice.
„Jetzt erkenne ich Sie wieder“, bemerkte er lächelnd und half ihr, zurück in ihr Zimmer zu humpeln. Dankbar ließ sie sich auf dem Bett nieder und wollte sich hinlegen.
„Halt, ich würde mir gerne noch Ihren Fuß ansehen“, hielt Herr Andarin sie auf. Er nahm eine Tasche mit Verbandszeug vom Tisch, setzte sich wieder auf den Stuhl vor ihrem Bett und hob den Fuß vorsichtig auf seinen Oberschenkel. Sanft betastete er ihn, mit kaum spürbaren Berührungen. Dann hielt er in der Bewegung inne und schloss die Augen. „Er scheint angebrochen zu sein“, erklärte er, als er sie wieder öffnete. „Ich werde ihn stützen. Sie können ihn gipsen lassen, wenn Sie in die Stadt kommen.“ Er sah sie an. „Achtung“, fügte er hinzu, verstärkte seinen Griff und drückte. Ein scharfer Schmerz schoss durch Felices Knöchel. Sie zog hörbar die Luft ein und Tränen schwammen ihr in den Augen.
„Tut mir Leid. Jetzt ist es vorbei. Dafür wird Ihr Fuß wieder gesund und schön“, entschuldigte sich Herr Andarin mit sanfter Stimme. Er griff nach dem Verbandszeug, schmierte eine dicke Paste auf den Fuß und bandagierte ihn. „So, jetzt können Sie schlafen“, meinte er, als er fertig war.
„Danke“, seufzte Felice. Ihr war schon wieder schwindlig, ihr Hals und ihr Fuß taten ihr weh und sie wünschte sich nichts sehnlicher, als endlich ihre Ruhe zu haben. Sie ließ sich auf ihr Kissen sinken, zog die Decke über sich und schlief ein, noch ehe Herr Andarin den Raum verlassen hatte.
Später erwachte Felice, weil sie fror. Dämmerlicht sickerte durch die zugezogenen Vorhänge ihres Fensters. Sie versuchte sich aufzurichten, ließ sich jedoch sofort wieder zurücksinken. Ihr war speiübel und in ihrem Kopf hämmerte es. Eine Weile wälzte sie sich herum und suchte nach einer Position, in welcher ihr weniger kalt sein würde, dann sank sie in einen unruhigen Schlaf.
Sie irrte durch ein Labyrinth auf der Suche nach etwas, das sie nicht finden konnte. Ständig lief sie in Sackgassen oder Hindernisse versperrten ihr den Weg und sie musste umkehren. Es schien keinen Ausweg aus dem Irrgarten zu geben und ihre Hoffnung schwand, jemals zu finden, was sie suchte und plötzlich wusste sie auch nicht mehr, was es war. Das einzig Sichere war, dass sie nicht aufgeben durfte. Sie litt schrecklichen Durst, ihr Kopf schmerzte und sie war zum Umfallen müde. Nebel begann sich in den Gängen auszubreiten und nahm ihr jede Orientierung. Erschöpft ließ sie sich zu Boden sinken, doch da wurde er glühen heiß. Trotz ihrer Müdigkeit stemmte sie sich hoch und schleppte sich weiter. Der Nebel wurde dichter und sie hatte das Gefühl zu ersticken. „Ich bekomme keine Luft“, murmelte sie.
„Dann atme!“, befahl eine gebieterische Stimme. Plötzlich stand Herr Andarin neben ihr und nahm sie an der Hand. Der Nebel lichtete sich. Vor ihr lag frei und schnurgerade der Weg zum Ausgang.
Felice erwachte. Sie lag noch immer in dem kleinen Zimmer und Herr Andarin saß vor ihr. Als er sah, dass sie wach war, nahm er eine Tasse von der Kommode und hielt sie ihr an die Lippen. „Trink!“, befahl er. Die Flüssigkeit schmeckte bitter und sie versuchte sich zu weigern. Aber Herr Andarin flößte ihr sanft alles ein, bevor sie wieder einschlief.
Diesmal war ihr Schlaf tief und traumlos und als sie erwachte, fühlte sie sich besser.
Die Vorhänge waren zurückgezogen worden und die Strahlen der Herbstsonne fielen in ihr Zimmer. Eine Weile blieb Felice liegen. Draußen sang ein Vogel, doch im Haus waren keine Geräusche zu hören. Sie setzte sich auf und bemerkte, dass der Schwindel ausblieb. Umsichtig stand sie auf und ging ein paar Schritte hin und her. Erstaunt realisierte sie, dass nicht nur der Schwindel verschwunden war, sondern auch die Schmerzen in ihrem Fuß.
Ein leises Klopfen ließ sie zur Tür blicken. Herr Andarin lehnte im Türrahmen. „Wie ich sehe, geht es Ihnen wieder besser“, sagte er freundlich.
„Ja“, erwiderte Felice lächelnd. „Danke, dass Sie sich seit gestern um mich gekümmert haben.“
„Gern geschehen“, entgegnete er. „Wenn auch nicht seit gestern, sondern seit drei Tagen.“
„Was?“, fragte sie erschrocken. „Was ist heute für ein Tag?“
„Dienstag, der erste November“, antwortete er. Bei näherem Hinsehen wirkte er erschöpft. Dunkle Schatten unter seinen Augen betonten die Blässe in seinem Gesicht.
„O nein!“, stöhnte Felice. „Es tut mir Leid. Warum haben Sie nicht einfach einen Krankenwagen gerufen und mich abholen lassen?“
„Das war nicht nötig. Ich bin Arzt und mir hat es nichts ausgemacht, mich um Sie zu kümmern. Sie waren hier sicher“, gab Herr Andarin schulterzuckend zurück. „Und ich habe mir erlaubt, Ihre Freundin daran zu hindern, die Polizei loszuschicken“, fügte er hinzu. Erstaunt sah Felice ihn an. Es wunderte sie, dass es ihm gelungen war, Andrea zu überzeugen.
An diesen Nachmittag fuhr Herr Andarin sie nach Hause. Felice staunte, wie weit sie von Freiburg entfernt waren. Obwohl die Straßen frei waren, brauchten sie fast drei Stunden, bis sie die Stadt erreichten. Als sie aussteigen wollte, hielt Herr Andarin sie zurück. „Versprechen Sie mir, dass Sie nicht allein im Wald spazieren gehen und überhaupt nicht nach Einbruch der Dunkelheit“, bat er.
„Hm. Gilt Bella als Person?“, fragte sie. „Sie gilt“, erwiderte er. „Aber nur, wenn Sie auf ihre Warnungen hören.“
„Okay. Klar“, versprach sie leicht verwirrt. „Ich habe erst mal genug.“
Stirnrunzelnd sah sie ihm nach, als er davonfuhr.