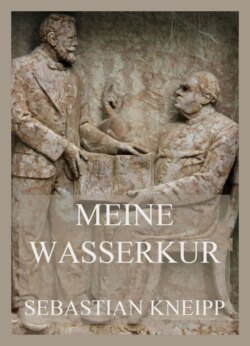Читать книгу Meine Wasserkur - Sebastian Kneipp Kneipp - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV. Vollbäder oder Ganzbäder.
ОглавлениеAuch diese Bäder werden unterschieden in kalte und warme Vollbäder. Jede Art dient sowohl den Gesunden als den Kranken.
1. Das kalte Vollbad
kann auf zweifache Weise genommen werden: entweder steht oder liegt man mit dem ganzen Körper in das kalte Wasser, in die Badewanne; oder man geht, um den fühlbaren Druck des Wassers auf die Lunge zu vermeiden (obgleich nie eine Gefahr ist), nur bis unter die Arme ins Wasser, so daß die Lungenspitzen frei bleiben, und wäscht den Oberkörper mit der Hand oder einem rauhen Linnen (Handtuche) rasch ab.
Die kürzeste Dauer eines solchen kalten Vollbades ist eine halbe Minute, die längste, welche nicht überschritten werden soll, drei Minuten.
Auf diese meine Sonderanschauung werde ich im folgenden noch einige Male zurückkommen müssen. Hier stehe nur die Bemerkung, daß ich vor ungefähr 20 Jahren selbst noch anderer Meinung war, Bäder von längerer Dauer anriet und im Glauben lebte, die Wasserheilanstalten könnten von der besten Methode nicht weit abirren.
Die langjährige Erfahrung und die tägliche Praxis an mir und an anderen haben mich seit langer Zeit, wie ich glaube, eines Besseren belehrt. Diese Lehrmeisterinnen brachten mich zu der festen Überzeugung, daß bei Kaltwasserbädern der Grundsatz der richtige und wahre ist:
Je kürzer das Bad, desto besser die Wirkung. Wer eine Minute im kalten Vollbade bleibt, handelt klüger und sicherer als derjenige, welcher fünf Minuten darinnen bleibt.
Mögen Gesunde oder Kranke dieses Bad gebrauchen, ich verwerfe ein jedes, das über drei Minuten dauert.
Diese Überzeugung, die unzählige Tatsachen gebracht und seitdem bestätigt haben, macht es erklärlich, daß ich über die schroffen Anwendungen in Wasserheilanstalten, auch über das vielfach unüberlegte Baden zur Sommerszeit meine eigenen Anschauungen habe.
Was den letzten Punkt angeht, so gibt es Leute, welche einmal, ja zweimal im Tage je eine halbe Stunde und darüber im Wasser bleiben. Bei tüchtigen Schwimmern, die starke Bewegung machen und nach dem Baden gute, kräftige Nahrung zu sich nehmen können, sage ich weniger. Die kräftige Natur wird schnell ersetzen, was das Bad ihr genommen. Den Landratten aber, die ohne rechte Bewegung wie mühsam gehende Schildkröten eine halbe Stunde im Wasser herumkriechen, nützt so ein Badmartyrium nicht nur nichts (die Reinigung der Hautwäsche hätten sie billiger haben können), es schadet, und wenn es öfters, gar zu oft wiederkehrt, schadet es viel: derlei Bäder machen schlaff und müde. Statt daß sie der Natur, dem Organismus nützen, ziehen sie ihn aus; statt daß sie kräftigen und nähren, zehren sie.
a) Das kalte Vollbad für Gesunde
Öfters kamen mir von bekannter und unbekannter Seite Warnungen zu des Inhalts, ich möchte doch bedenken, daß die Anwendung des kalten Wassers gleichbedeutend sei mit Wärme-Entziehung, daß Wärme-Entziehung blutarmen Personen sehr schade und die Nervenreizbarkeit in hohem Grade steigere.
Ich unterschreibe jedes Wort, wenn es sich um allzu schroffe Anwendungen der oben beschriebenen Art handelt; meine Anwendungen aber, an dieser Stelle die kalten Vollbäder, empfehle ich vorerst allen Gesunden zu jeder Jahreszeit, im Sommer und Winter, und behaupte, daß gerade diese Bäder zur Erhaltung und Kräftigung der Gesundheit wesentlich beitragen; sie reinigen die Haut, befördern die Hauttätigkeit, erfrischen, beleben und stärken den ganzen Organismus. Im Winter sollen die Bäder in der Woche die Zahl zwei nicht leicht überschreiten; eines genügt alle acht, unter Umständen alle vierzehn Tage.
Noch zwei Punkte seien hier berührt.
Eine wichtige Rolle im Gesundbleiben spielt das Abgehärtetsein gegen die verschiedenen Einflüsse, den Wechsel der Temperatur (Witterung, Jahreszeiten). Unglücklich der Mensch, dem jeder Windhauch, jedes Lüftchen die Lunge, den Hals, den Kopf verdreht, der das ganze Jahr aufmerken muß, wie heute und morgen die Windfahne gerichtet ist. Dem Baum in der freien Natur kann es gleichgültig sein, ob Sturm, ob Windstille, ob Hitze, ob Kälte herrscht. Er trotzt Wind und Wetter, er ist abgehärtet. Der Gesunde probiere unser Bad, er wird dem starken Baume gleichen.
Ein Grund der Angst und Besorgnis vor den Kaltwasser-Anwendungen ist vielen sehr schwer zu benehmen; ich möchte denselben bezeichnen als die fixe Idee von der Wärme-Entziehung. Die Kälte schwächt und muß schwächen, sagen sie, wenn nicht auf deren Anwendung alsbald das Gefühl der Wärme folgt. Ganz gewiß, ich stimme bei, aber ich behaupte entgegen, daß, abgesehen von der vielen Bewegung, die nach unseren Grundsätzen mit jeder Anwendung von kaltem Wasser strenge und vorschriftsmäßig verbunden ist, unsere Kaltwasserbäder der Natur die Wärme nicht rauben, vielmehr dieselbe erhalten und pflegen. Statt allem die Frage: Wenn ein geschwächter, durch fortwährendes Stubensitzen verweichlichter Mensch, welcher zur Winterszeit nur im äußersten Notfalle noch einen Ausgang wagen darf, durch die Bäder oder durch die Waschungen auf einmal so abgehärtet ist, daß er ohne Furcht bei jeder Witterung ausgeht, die empfindsame Kälte selbst kaum mehr empfindlich spürt, muß bei einem solchen die Naturwärme nicht gewonnen haben? Sollte dieses alles Schein und Trug sein?
Ein Beispiel von vielen möge doch hier Platz finden!
Ein hoher Herr, über 60 Jahre alt, war wasserscheu aufs äußerste. Seine größte Sorge bei Ausgängen bestand darin, ja nicht eines der unentbehrlichen Wollstücke zu vergessen; alle möglichen und unmöglichen Erkältungen usw. könnten ja die Folge solch’ unverzeihlicher Vergeßlichkeit sein. Der Hals des Herrn war vor allen andern Kopf-, Rumpf- und Gliederteilen so empfindlich, daß er ihn kaum mehr entsprechend zu pflegen, zu umhüllen wußte. Da kam der „Barbar“ dahinter. Mit einer gewissen Schadenfreude verordnete er unsere kalten Vollbäder. Der Herr gehorchte. Und die Folgen? Dieselben waren außerordentlich günstige. Nach wenigen Tagen schon vollzog sich die erste Häutung; dem ersten Woll- und Flanellhemd folgte bald das zweite und die Wollseile des Halses gingen bald denselben Weg. Jeden Tag, an dem er kein Vollbad nehmen konnte, hielt er für keinen geordneten Tag; so sehr stählte es fühlbar gegen Klima und Witterung. Und er nahm die Bäder nicht bloß im erwärmten Zimmer, er nahm dieselben im Oktober noch beim täglichen Spaziergange in einem Flusse, dessen kalte Wasser ihm willkommener waren als das Wasser der zu Hause stehenden Badewanne. —
Die Hauptfragen, die wir zu beantworten haben, sind folgende:
In welchem Zustande, in welcher Disposition (Beschaffenheit) muß der gesunde Körper sein, daß er solche kalte Vollbäder mit gutem Erfolge gebraucht? Ferner:
Wie lange darf ein Gesunder im Bade bleiben? Endlich:
Zu welcher Jahreszeit beginnt man am leichtesten diese Abhärtungskur?
Die gute Disposition für die kalten Vollbäder erfordert wesentlich, daß der ganze Körper vollkommen warm sei.
Wer somit durch den Aufenthalt im warmen Zimmer, wer durch Arbeiten oder durch Gehen vollständig durchwärmt ist, befindet sich in der richtigen Verfassung.
Wem kalt ist, wer an kalten Füßen leidet, wen fröstelt, der soll bei solchem Kältezustande nie ein kaltes Vollbad nehmen, er habe sich denn zuvor durch Gehen usw. gehörig erwärmt.
Umgekehrt: wer schwitzt, wer erhitzt (ich rede von gesunden Menschen), im größten Schweiße wie gebadet ist, nehme ruhig unser Vollbad.[6]
Kaum wird irgend etwas selbst von ruhigen, besonnenen, einsichtsvollen Männern so sehr gefürchtet, als in der Hitze, im Schweiße sich ins kalte Wasser zu begeben. Und doch, nichts ist schuldloser. Ja, ich stelle kühn die wohlüberlegte und langjährig erprobte Behauptung auf: Je ärger der Schweiß, um so besser, um so wirksamer das Bad.
Bei Unzähligen, die früher geglaubt hatten, es müsse sie bei solcher „Roßkur“ sofort der Schlag treffen, war nach einem einzigen Versuche, nach der ersten Probe alle Furcht, alle Angst, alles Vorurteil geschwunden.[7]
Wer hat denn je, wenn er schwitzend nach Hause kommt, wenn ihm der salzige Saft übers Gesicht rinnt und die Finger wie mit Klebstoff zusammengeleimt erscheinen, Bedenken und Furcht, Hände und Gesicht zu waschen, wohl auch noch Brust und Füße? Das tut ein jeder, denn es macht behaglich und wohl. Muß die Wirkung für den ganzen Körper — das ist die notwendige Folgerung — nicht dieselbe sein? Sollte eine Sache, die einzelnen Teilen vortrefflich zustatten kommt, für dieselben eine Wohltat ist, für das Ganze ein Nachteil, ein Verderben sein?
Ich glaube, die Angst vor der schädlichen Wirkung der kalten Bäder für Schwitzende rührt meistens her von der Wahrnehmung, daß Personen, die, von Schweiß triefend, plötzlich an die Kälte kommen oder der frischen Luft, besonders der Zugluft sich aussetzen, sich manchmal schon für ihr ganzes Leben gründlich verdorben haben. Das ist ganz wahr.
Ich gebe noch mehr zu, daß sich nämlich auch schon manche Schwitzende im kalten Wasser die Keime zu schweren Leiden holten. Was trägt die Schuld: der Schweiß oder das Kaltbad? Keines von beiden! Wie bei allem im Leben, so kommt es auch hier in erster Linie nicht auf das Was, sondern auf das Wie an, in unserem Falle, wie die Menschen im Schweiße das kalte Wasser gebrauchen. Mit dem einfachen Taschen- und Brotmesser kann ein Rasender namenloses Unheil anrichten. Unvernünftige Anwendung kann das höchste Gut in das größte Übel verkehren. Merkwürdig bleibt nur, daß man dann stets das Gut und nicht die zu verurteilenden Mißbräuche desselben verdammt.
Auf das Wie des Gebrauches also kommt es an. Wer in diesem Stücke seinem Kopfe nachgeht, der mag auch die Folgen, an denen er leichtfertigerweise selbst die Schuld hat, allein tragen.
Damit stehen wir bei der Beantwortung der zweiten Frage: Wie lange darf ein Gesunder im kalten Vollbade bleiben?
Ein Herr, dem ich wöchentlich zwei solcher Bäder verordnet hatte, kam nach 14 Tagen zu mir und jammerte, daß sein Zustand sich bedeutend verschlimmert habe, er sei wie ein Eisklumpen. Das Aussehen war sehr leidend, und ich begriff nicht, daß das Wasser mich auf einmal so im Stiche gelassen. Auf meine Frage, ob er die Anwendung genau nach Weisung gemacht, antwortete der Herr: „Aufs genaueste; ich habe noch mehr getan, als Sie befohlen haben; statt einer Minute bin ich fünf Minuten im Wasser geblieben, dann aber kaum mehr oder nicht mehr warm geworden.“ Er machte es die folgenden Wochen richtig und hatte in Bälde die frühere Naturwärme und Frische.
Dieser eine Fall illustriert (bildet ab) alle Fälle, in denen das Wasser geschadet haben soll. Nicht das Wasser, nicht die Anwendung fällt aus der Rolle; die unvorsichtigen und ungenauen Menschen sind die Missetäter. Wie nun aber einmal die Gewohnheit besteht, muß ihre Schuld das unschuldige Wasser tragen.
Wer das kalte Vollbad nimmt, kleide sich rasch aus und lege sich eine Minute in die bereitstehende Badewanne. Wer es im Schweiße nimmt, setze sich in die Wanne, d. h. gehe nur bis an die Magengegend ins Wasser und wasche sich schnell und kräftig den Oberkörper ab. Dann tauche er einen Augenblick bis zum Halse unter, gehe ungesäumt aus dem Wasser und kleide sich, ohne abzutrocknen, in tunlichster Eile an. Der Hand- oder Feldarbeiter kann sofort wieder seine Arbeit aufnehmen; andere müssen (mindestens eine Viertelstunde) so lange Bewegung machen, bis der Körper trocken und normal erwärmt ist. Ob dieses im Zimmer oder im Freien geschieht, bleibt sich ganz gleich; ich für meine Person gebe selbst im Herbst und Winter stets der frischen Luft den Vorzug.
Was du tust, mein lieber Leser, das tue vernünftig und überschreite nie das rechte Maß! Auch die Anwendung des Vollbades soll in der Woche die Zahl von drei in der Regel nicht übersteigen.
Wann soll ich am besten diese Bäder beginnen?
Die wichtige Arbeit, den Körper abzuhärten oder, was gleichbedeutend ist, ihn gegen Krankheit zu schützen, widerstandsfähig zu machen, kann nie früh genug begonnen werden. Fange gleich heute noch an, aber fange an mit leichteren (s. Abhärtungsmittel), nicht gleich mit schwereren Übungen! Du könntest sonst leicht den Mut verlieren! — Unsere kalten Vollbäder wirst du beginnen können, wenn du kräftig bist, vielleicht nach kurzer Vorbereitung, wenn du schwach bist, unter Umständen erst nach längerer Vorübung.
Es ist dieses ein sehr wichtiges Kapitel. Nur nicht unvermittelt, plötzlich, mit den strengsten Mitteln etwas forcieren, erzwingen wollen! Das ist zum mindesten Unverstand.
Ein Arzt riet einem am Nervenfieber Erkrankten, er soll eine Viertelstunde ins kalte Wasser gehen. Der Kranke tat es, bekam aber darnach solchen Frost, daß er in Zukunft von einem solchen Heilbade natürlich nichts mehr wissen wollte, es verwünschte und verfluchte. Die Erklärung des Sachverständigen ging einfach dahin: nach solchen Erfahrungen sei klar, man könne bei dem Kranken das Wasser nicht ferner in Anwendung bringen, der Kranke sei im übrigen verloren. Mit diesem Todesurteil kam man zu mir. Ich gab den Rat, der Aufgegebene solle doch nochmal das Wasser probieren, aber statt einer Viertelstunde nur zehn Sekunden (hinein und hinaus) im Wasser bleiben, der Erfolg müsse ein anderer sein. Gesagt, getan; in wenigen Tagen erholte sich der Kranke.
Bei derartigen Vorkommnissen drängte sich mir stets die Meinung auf, man wende das Wasser absichtlich in solch’ schroffer, unbegreiflich gewalttätiger Weise an, um das Volk, anstatt mit Vertrauen, mit Schrecken vor diesem nassen Wauwau zu erfüllen. Ich bin ein sonderbarer Mensch, ich weiß es; drum wird man mir solche Einfälle nicht hoch anrechnen.
Solche, denen es ernst ist, mögen nach Anwendung der Abhärtungsmittel zuerst noch die Ganzwaschungen (s. Waschungen) beginnen und dieselben, wenn sie das Waschen vor Schlafengehen nicht aufregt und wach erhält, abends vor dem Bettgehen, sonst in der Frühe beim Aufstehen vornehmen. Abends verliert man gar keine Zeit auch früh ist in einer Minute alles fertig. Wer nicht gleich zu tüchtiger Handarbeit oder in kräftige Bewegung kommt, soll sich nochmals (bis zur Trocknung und Erwärmung) ein Viertelstündchen niederlegen.
Diese Übung, wöchentlich zwei- bis viermal vorgenommen, was genügt, oder täglich praktiziert, bildet die beste Vorbereitung zu unserem kalten Vollbade. Man versuche es nur einmal! Dem ersten Unbehagen wird bald ein bis ins Innerste hinein wohltuendes Behagen folgen, und was früher gescheut und gefürchtet war, wird bald fast Bedürfnis werden.
Ein mir bekannter Herr ging 18 Jahre hindurch allnächtlich in sein Vollbad. Ich hatte es ihm nicht vorgeschrieben; aber er wollte die Übung durchaus nicht lassen. In den 18 Jahren war er keine Stunde lang krank.
Andere, die in einer Nacht zwei- bis dreimal in die Badewanne stiegen, mußte ich zurückhalten, es ihnen verbieten. Wäre die Übung sie hart oder unausstehlich angekommen, wie man so oft ausschreit und ausheult, sie hätten es sicherlich bleiben lassen. —
Wer es mit der Abhärtung, mit der Erhaltung seiner Gesundheit, mit seiner Kräftigung ernst meint, fasse das kalte Vollbad recht ins Auge,[8] lasse es aber bei dem guten Vorsatze allein nicht bewenden.
Kräftige Völker, Geschlechter, Familien sind stets treue Freunde des kalten Wassers, gerade unseres Vollbades gewesen. Je mehr unser Zeitalter den Charakter und Namen des verweichlichten bekommt, um so höhere Zeit ist’s, zurückzukehren zu den gesunden, natürlichen (nicht verkünstelten und unnatürlichen) Anschauungen und Grundsätzen der Alten.
Noch gibt es manche, besonders hochadelige Familien, angesehene Männer, welche gerade unsere Wasseranwendung gleichsam als Haustradition und als ein zur Gesundheitspflege überaus wichtiges Erziehungsmittel ansehen und ihrem Stamme, ihren Nachfolgern gesichert wissen wollen.
Wir brauchen uns also unserer Sache nicht zu schämen.
b) Das kalte Vollbad für Kranke
Bei Beschreibung der einzelnen Krankheiten (im dritten Teile) wird genau angegeben werden, wann und wie oft es zur Verwendung kommen soll. Nur einige Bemerkungen von mehr allgemeiner Natur mögen hier ihre Stelle finden.
Eine kräftige Natur, ein gesunder Organismus ist imstande, die Krankheitsstoffe, welche sich ansetzen wollen, selbst auszuscheiden. Dem kranken und durch Krankheit geschwächten Körper muß man beispringen, ihn unterstützen, daß er anfange, diese Arbeit selbst wieder zu tun. Vielfach geschieht diese Unterstützung durch das kalte Vollbad, das in solchem Falle als vortreffliche Krücke oder Stab, als Kräftigungsmittel dient.
Die Hauptanwendung findet es indessen bei den sogenannten „hitzigen Krankheiten“, d. h. bei all’ jenen Krankheiten, welche als Vorboten und Begleiter heftige Fieber haben. Die Fieber von 39–40° und darüber sind am meisten zu fürchten; sie rauben alle Kraft, brennen die Hütte des menschlichen Körpers gleichsam elendiglich nieder. Mancher, den die Krankheit verschont, wird ein Opfer der Schwäche. Zusehen und Zuwarten, was sich aus einem so schrecklichen Feuerbrande wohl entwickeln möge, scheint mir bedenklich und folgenschwer zu sein. Was soll da „alle Stunden einen Eßlöffel voll“, was das teuere Chinin, was das wohlfeile Antipyrin, was die giftige Digitalismixtur, deren Folgen für den Magen wir alle kennen? Medikamente sind und bleiben bei solchen Bränden doch recht schwache Hilfs- oder Fieberstillungsmittel. Was sollen endlich jene künstlichen Berauschungsmittel, die man dem Kranken eingibt oder einspritzt, die ihn in der Tat berauschen, daß er nichts mehr weiß, nichts mehr fühlt, nichts mehr empfindet? Ganz abgesehen vom moralischen und religiösen Standpunkte ist es wahrlich erbärmlich, so einen halb eingeschlummerten, vielmehr berauschten Kranken zu sehen, wie er daliegt mit entstellten Zügen, mit verdrehten Augen. Wird das helfen? Bei solchem Fieberfeuer hilft gar nichts als das Löschen. Feuer und Brände löscht man mit Wasser, den allgemeinen Körperbrand, wo gleichsam alles in hellen Flammen steht, am gründlichsten durch das Vollbad. Bei jedem neuen Aufflackern, d. h. so oft die Hitze, die Bangigkeit groß wird, vielleicht im Anfange des Fiebers jede halbe Stunde erneuert, wird es, früh genug angewendet, bald Herr des Feuers sein (s. Entzuendungen, Scharlach, Typhus u. a.).
Früher schon hörte ich, daß man in großen allgemeinen Krankenhäusern für arme Kranke, welche das teuere Chinin nicht auftreiben konnten, häufig die Badewanne gebrauchte, in den letzten Zeiten durchlief manche Zeitungen die mir freudige Kunde, daß man besonders in großen Militärspitälern Österreichs wieder angefangen habe, gewisse Krankheiten wie den Typhus mit Wasser zu behandeln. Warum, so möchte ich fragen, nur den Typhus? Warum nicht mit logischer Notwendigkeit all’ jene Krankheiten, die als giftige Früchte aus den Fieberpilzen hervorwachsen? Wer A sagt, muß B sagen. Mit Spannung warten viele auf das B, darunter auch manche Leute vom Fach.
Eine Bemerkung, die vielleicht besser bei den Waschungen stünde, möge gleichwohl hier sich anreihen. Nicht alle Kranken sind imstande, die Vollbäder zu benützen; manche sind vielleicht schon derart geschwächt, daß sie weder selbst sich heben und wenden, noch aus dem Bette gehoben werden können. Müssen solche Kranke der Kaltwasseranwendung verlustig gehen? Durchaus nicht. Unsere Wasser-Anwendungen sind so mannigfaltig, und jede einzelne Anwendung hat wieder so viele Grade und Stufen, daß der Gesündeste wie der Schwerkranke das für ihn und seinen Zustand Passende finden kann. Nur darum handelt es sich, die Anwendung gut auszuwählen.
Für einen Schwerkranken, der wegen zu großer Schwäche unfähig ist, die kalten Vollbäder zu gebrauchen, dienen als Ersatz die Voll- oder Ganzwaschungen, die bei jedem, auch dem schwächsten Kranken leicht im Bette vorgenommen werden können. Wie sie zu geschehen haben, sehe man bei den Waschungen. Sie werden wie die Vollbäder so oft wiederholt, als der Hitze- oder Bangigkeitszeiger einen hohen Grad, eine hohe Ziffer aufweist.
Gerade bei solchen ans Bett gefesselten Schwerkranken hüte man sich doppelt vor dem großen Fehler einer zu schroffen Anwendung. Man würde stets das Übel ärger machen.
Ich könnte jemanden nennen, der elf Jahre bettlägerig und ebensolange Zeit in ärztlicher Behandlung war. Auch Wasser-Anwendungen waren versucht worden; alles scheiterte. Nach der Heilung dieser Person, die in sechs Wochen erfolgte, erklärte der Arzt selbst, die Sache komme ihm wie ein Wunder vor. Er besuchte mich persönlich und wollte wissen, was denn geschehen. Der ganze Hergang sei ihm um so unbegreiflicher, als nach seinem Dafürhalten nicht mehr die geringste Tätigkeit in dem Körper vorhanden war und seine sämtlichen Anwendungen mit Wasser ohne Erfolg blieben. Ich nannte dem Herrn den einfachen Hergang und die noch einfacheren Wasserübungen. Wir beide sahen ein, einen glimmenden Kienspan löscht man nicht mit der Feuerspritze aus; sein Wasser war zu schroff, das meinige sachte, langsam, den Fassungskräften des elenden Körpers entsprechend zur Anwendung gekommen.
Mich hat es oft erbarmt, daß man hören und lesen muß, wie in manchen Anstalten und Häusern Leute zehn, zwanzig und mehr Jahre das Bett nie mehr verlassen können. Das sind bedauernswürdige Geschöpfe. So etwas begreife ich übrigens nicht und habe es nie begriffen, ganz wenige Ausnahmefälle abgerechnet; es hat ja auch die heilige Schrift ihren 38jährigen Kranken. Ich bin der festen Überzeugung, daß gar vielen dieser Betthüter und Betthüterinnen durch die einfachsten, mit Ausdauer und Pünktlichkeit fortgesetzten Wasseranwendungen wieder auf die Beine zu helfen wäre.