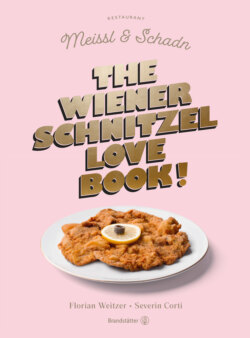Читать книгу The Wiener Schnitzel Love Book! - Severin Corti - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеWas ein echter Wiener ist, hat eine religiöse Beziehung zu seinem Schnitzel - behauptet
SEVERIN CORTI
Schnitzel ist Religion
Wenn der Pfarrer in der Sonntagsmesse den heiligen Ritus der Wandlung zelebriert, dann hebt er das Brot mit den Worten „Dies ist mein Fleisch“. Für ordentlich katholische Wiener – und die erdrückende Mehrheit ist zumindest als solche groß geworden – erscheint diese Wandlung keineswegs so wundersam wie für den Rest der Menschheit. Schließlich gehört es zum Wesen des definierenden Gerichts ihrer Heimatstadt, zwar wie Brot auszusehen, tatsächlich aber Fleisch zu sein. Im Wiener Schnitzel wird der zentrale Glaubenssatz des Christentums Realität, zumindest aus kulinarischer Sicht: Aus Fleisch Brot zu machen – oder war es umgekehrt? – ist für einen Koch in Wien sozusagen tägliches Geschäft.
Der Katholizismus mit seinen zahlreichen Fastenregeln und der durchaus definierenden Aversion gegen die allzu fleischlichen Freuden des Lebens erwies sich in Wien aber auch aus einem anderen Grund als idealer Nährboden, um einer Köstlichkeit wie dem Schnitzel ans Licht zu helfen: In die Hülle aus Ei und Brösel gepackt wird die Sünde des Fleisches gnädig verhüllt, sodass sie keusch und doch knusprig den Gaumen des Genießers erfreue. In Wien wird nämlich bei Gott nicht nur Fleisch in Ei und Brösel gehüllt herausgebacken: Von Fisch über Leberkäse und sogar Wurst bis zu dicken Ziegeln vom Emmentaler Käse, von allerhand Gemüse wie Karfiol (vulgo Blumenkohl), Spargel, Champignons oder blanchiertem und in Scheiben geschnittenem Knollensellerie bis zu Gulasch und Frikadellen wird in Wien so gut wie alles paniert, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. In Zeiten, da die Fastengesetze noch etwas galten, war dem Verwirrspiel somit Tür und Tor geöffnet – wer konnte schon sicher sein, ob das goldbraun panierte Etwas, das der Nachbar am Fasttag so lustvoll zu einem Teil seiner Selbst machte, nun wahrhaftig kein Fleisch war?
Aber auch sonst bietet das Wiener Schnitzel, diese aus Kalbfleisch, Mehl, Ei und Weißbrotbröseln (sowie, ganz wichtig, reichlich Frittierfett) bestehende Legende der österreichisch-ungarischen Küche Stoff zur religiösen Auseinandersetzung. Nicht wenige Wiener würden sogar dafür plädieren, ihm den Status einer eigenen Religion zu verleihen, inklusive Gotteslästerung, Schisma und allem, was dazugehört. Daraus zu schließen, dass es sich um einen biblischen Tanz um das Goldene Kalb handle, nur weil das Wiener Schnitzel aus Kalbfleisch besteht und, wenn korrekt paniert, einen goldenen Schimmer hat, wäre freilich zu billig. Während der Rest der zivilisierten Welt sich dem Schnitzel nicht mehr als zwei-, dreimal im Jahr hingibt, tut dies der durchschnittliche Wiener zwei-, dreimal die Woche. Dementsprechend familiär ist sein Umgang mit dem Allerheiligsten: Im täglichen Sprachgebrauch wird das Wiener Schnitzel denn auch zum Bröselteppich oder gar Bröselfetzen verunglimpft – erst in der Gotteslästerung wird die Kraft des Glaubens schließlich offenbar.
Schön langsam aber wird es Zeit zu definieren, was genau das Objekt der Anbetung eigentlich darstellt und wie es orthodox zuzubereiten ist. Das Ausgangsmaterial ist eine nicht zu dünn, aber keinesfalls dick geschnittene, etwa 140 Gramm schwere Scheibe aus dem Schlögel des Milchkalbs, konkret aus den nach Wiener Fleischhauer-Tradition Fricandeau, Nuss oder Schale genannten Teilstücken. Dieses Schnitzel wird mittels Plattiereisen oder der nicht schraffierten Seite eines Schnitzelprackers (vulgo Fleischhammers) auf etwa einen halben Zentimeter Dicke geklopft. Keinesfalls dünner, da es ansonsten beim Backen austrocknet und zu nichts weiter als einer faserigen Trägermasse für die Panade aus Mehl, Ei und Bröseln würde. Diese wird auf gut Wienerisch „Panier“ genannt. Dass Fleisch nach des Wieners Verständnis ohne sie unangenehm nackt wäre, lässt sich nicht zuletzt daran erkennen, dass ein besonders kleidsamer Anzug auf Wienerisch bis heute als „Einser-Panier“ bezeichnet wird.
Der legendäre Wiener Küchenchef Franz Ruhm, dessen Standardwerk „Was koche ich heute? Rezepte der Wiener Küche“ in zahllosen Auflagen als das Standardwerk der österreichischen Küche gelten darf, beschreibt das weitere Vorgehen mit der ihm eigenen, hoch präzisen (wenn auch etwas umständlichen) Diktion: „Das Panieren geht der Reihenfolge nach so vor sich, dass das Schnitzel zuerst gesalzen und von beiden Seiten bemehlt wird, sodann zieht man es durch Ei, wozu auf ein Ei eine halbe Eischale voll Wasser und ein Kaffeelöffel voll Öl kommt und gut verquirlt wird. Nun hüllt man das Schnitzel in möglichst gleichkörnige Semmelbrösel ein, wobei die Brösel lediglich ein wenig angedrückt, nie aber angeklopft werden dürfen, wie das so häufig geschieht. Das Panieren soll immer erst knapp vor Tisch vor sich gehen, da durch zu langes Liegen in den Bröseln diese den Fleischsaft anziehen und beim Backen dann nie mehr mürbe und knusprig werden können. Im Gegenteil passiert es häufig, dass in solchen Fällen die Bröseldecke beim Backen vollends aufweicht und abfällt. (...) Das Backfett muss so heiß sein, dass eine nassgemachte Gabelspitze, die man darein taucht, ein empörtes Zischen verursacht. Ferner soll so viel Fett in der Pfanne sein, dass das Schnitzel ‚schwimmen‘ kann, mindestens aber den Boden der Pfanne daumenhoch bedeckt. Ein Schnitzel, das in gut erhitztes Fett gelegt wird, kann schon nach 1½ Minuten goldgelb geworden umgedreht werden, worauf man es an der anderen Seite ebenso lange fertig bäckt, gut abtropfen lässt und, mit Zitronenspalte und etwas gezupfter Petersilie garniert, sobald als möglich zu Tisch bringt. Werden mehrere Schnitzel für eine Mahlzeit gebacken, dürfen sie nicht übereinander gelegt und auch nicht zugedeckt warm gehalten werden, da dadurch die Bröseldecke aufweicht. Zum Warmhalten stellt man die Schnitzel am besten ins offene mittelheiße Rohr.“
Die Orthodoxie des Rezepts als Mittlerin der Wahrheit ist wohl wichtig - in der stillen Kammer der Küche wird aber die Realität des Glaubens noch einmal ganz persönlich zusammengesetzt.
Das ist nun eine besonders detaillierte Anleitung, wie man sie von den anderen, meist nur wenige Zeilen langen Rezepten Ruhms kaum kennt. Das Schnitzel ist Ruhm eben das Herzstück der Wiener Küche. Gleichzeitig aber lässt das Rezept durch erstaunliche Auslassungen schon erkennen, dass Ruhm wohl weiß, auf welch umkämpftem Gebiet er sich bewegt und wie er sein Bestes gibt, nur ja nicht in eine der Schlingen zu treten, die seine Autorität in Geiselhaft nehmen könnten.
Welches Fett? Welche Beilage? Bei einer Speise von solch identitätstiftender Notorietät sollte derlei eigentlich längst geklärt sein. Die persönliche Nahebeziehung des Wieners zu seinem Schnitzel bringt mit sich, dass er in wesentlichen Details auf Individualität besteht: Die Orthodoxie des Rezepts als Mittlerin der Wahrheit ist wohl wichtig – in der stillen Kammer der Küche aber wird die Realität des Glaubens noch einmal ganz persönlich zusammengesetzt. In der feinen Wiener Küche gilt gemeinhin Butterschmalz als das Fett der Wahl, manchen aber ist der daraus resultierende Geschmack der Panier schlicht zu kuchenähnlich, weshalb die meisten Wiener Restaurants mittlerweile auf Pflanzenöl umgeschwenkt sind und das fertig gebackene Schnitzel bestenfalls mit Nussbutter einpinseln, um so von hinten herum eine Idee von Buttrigkeit in die Komposition zu schwindeln. Am Land und in vielen Familien gilt aber bis heute Schweineschmalz als Backfett der Wahl, das bis vor wenigen Jahrzehnten das weithin gebräuchlichste Backfett war und eine dezidiert rustikale, unvergleichlich reichhaltige Nuance einbringt. Über das richtige Backfett werden an den Tischen der Wiener Beiseln sehr ernsthafte und langwierige Diskussionen geführt – seit Generationen und wohl noch bis in ferne Zukunft.
Die Österreicher haben zwar keinen Kaiser mehr, irgendwie hängen sie den goldenen Zeiten der Monarchie aber schon noch nach. Da tut es gut, dass zumindest das Wiener Schnitzel noch weltberühmt ist und von gekrönten Häuptern hoch geschätzt wird. Von Elvis Presley etwa ist bekannt, dass er der King war, seinen Militärdienst in Deutschland abdiente und dabei nur vier Wörter Deutsch lernte. Die aber waren „Auf Wiedersehen“ und „Wiener Schnitzel“. Das freut die Wiener bis heute. Dass er die Worte manchmal verwechselte und sich hin und wieder mit „Auf Wiener Schnitzel“ verabschiedete, werten sie als besonderes Kompliment.
Davon abgesehen aber ließe sich das Schnitzel-Verständnis unserer amerikanischen Freunde noch ein wenig ausbauen. Als besonders merkwürdiger Hinweis dafür gilt die Website www.wienerschnitzel.com, wo in altdeutscher Schrift ein Delivery-Service beworben wird. Das allein würde dem echten Wiener durchaus schmeicheln. Was ihn jedoch verstört, ist, dass unter diesem Namen keine Schnitzel, sondern vielmehr Hotdogs verhökert werden. Das sind Verirrungen vom rechten Weg des Glaubens, die durch nichts zu entschuldigen sind!