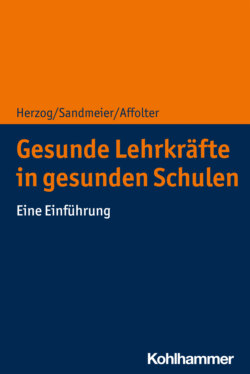Читать книгу Gesunde Lehrkräfte in gesunden Schulen - Silvio Herzog - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1.2 Belastungen, Ressourcen, Bewältigung und Beanspruchung
ОглавлениеIm Modell gemäß Abbildung 2.1 ( Abb. 2.1) werden kontextuelle Einflussfaktoren (Belastungen und soziale Ressourcen), individuelle Einflussfaktoren (individuelle Ressourcen, Bewältigung) und individuelle Reaktionen (positive und negative Beanspruchung) unterschieden.
Belastungen sind dabei »diejenigen physischen, psychischen, sozialen oder organisatorischen Aspekte der Arbeit, die eine anhaltende physische und/oder psychische (d. h. kognitive oder emotionale) Anstrengung erfordern und daher mit bestimmten physiologischen und/oder psychologischen Kosten verbunden sind« (Schaufeli & Bakker, 2004, S. 296). Der Begriff bezieht sich auf Eigenschaften des Kontexts und nicht des Individuums und ist grundsätzlich neutral konnotiert. Belastungen können sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf das Individuum haben.
Ressourcen umfassen Aspekte im beruflichen Umfeld oder der arbeitenden Person, die a) funktional sind für das Erreichen von beruflichen Zielen, b) Belastungen bewältigen helfen und c) die Motivation, die Gesundheit und die persönliche Entwicklung fördern (Bakker & Demerouti, 2014, S. 9). Sie können in soziale und individuelle Ressourcen differenziert werden: Soziale Ressourcen befinden sich im Umfeld des Individuums und sind auf der Ebene der Organisation (z. B. Verdienst, Karrieremöglichkeiten, Sicherheit der Stelle), der sozialen Beziehungen (z. B. Unterstützung durch die Führungsperson, Team-Support, geteilte Werthaltungen), der Arbeitsorganisation (z. B. Rollenklarheit, Partizipation in Entscheidungsprozessen) oder der Aufgabe (z. B. Kompetenzerleben, Vielfältigkeit, Autonomie) zu lokalisieren (Bakker & Demerouti, 2014). Individuelle Ressourcen sind Merkmale des Individuums, die für die Bewältigung der beruflichen Belastungen und die Selbstverwirklichung funktional sind. In Kapitel 3.3 ( Kap. 3.3) gehen wir vertiefend auf diejenigen individuellen Ressourcen ein, die für den Lehrberuf grundlegend sind.
Unter Bewältigung verstehen wir mit Lazarus (1993, S. 8) das Bemühen des Individuums, subjektiv mit bedeutsamen Belastungen umzugehen, indem es problemlösend in seinen Kontext eingreift oder indem es seine Emotionen reguliert, die mit der Belastung zusammenhängen.
Die aus den Wechselwirkungen von Ressourcen und Belastungen resultierende Beanspruchung kann positiv oder negativ sein. Rudow (2011) unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen kurzfristigen Beanspruchungsreaktionen, die unmittelbar mit dem Vollzug der Arbeitstätigkeit verbunden sind und unmittelbar in Gegenwart der betreffenden Belastung erlebt werden, und mittel- und langfristigen Beanspruchungsfolgen, die zeitlich anhaltende, verfestigte psychische und physische Reaktionen auf Belastungen darstellen ( Tab. 2.1).
Tab. 2.1: Kurz-, mittel- und langfristige Beanspruchung (in Anlehnung an Affolter, 2019)
Kurzfristige BeanspruchungsreaktionenMittel- und langfristige Beanspruchungsfolgen
Positive Beanspruchungsreaktionen äußern sich kurzfristig in positiven Emotionen wie Aktivierung, Freude, Ruhe, Gelassenheit und Flow und werden durch Belastungen hervorgerufen, für deren Bewältigung ausreichende Ressourcen vorhanden sind ( Kap. 2.2.). Eine mittel- und langfristige positive Beanspruchung führt zu Wohlbefinden, Sinnerleben und Begeisterung für die Arbeit. Kognitiv resultieren daraus Arbeitszufriedenheit, Commitment gegenüber dem Beruf und ein positives Selbstbild (Selbstkognitionen).
Kurzfristige negative Beanspruchungsreaktionen hingegen zeigen sich in psychischer Ermüdung, Denkblockaden oder grüblerischen Gedankenkarussellen, die infolge Über- oder Unterforderung entstehen. Damit verbunden sind Emotionen wie Angst vor Versagen, Unsicherheit, Ärger oder Frustration (Krause, Dorsemagen & Baeriswyl, 2013) und auf der körperlichen Ebene Symptome wie eine erhöhte Herzschlagfrequenz, ein erhöhter Blutdruck und/oder ein erhöhter Cortisolspiegel (Wettstein, Kühne, Tschacher & La Marca, 2020). Stress, von dem im Alltag oft gesprochen wird, ist theoretisch gesehen ein solcher Zustand erhöhter Aktiviertheit, der durch das Erleben einer Bedrohung hervorgerufen wird und mit unangenehmen Emotionen verbunden ist (Rudow, 2011, S. 52). Ein solcher Stresszustand kann sich im Verhalten beispielsweise in motorischer Unruhe, unkoordiniertem Arbeitsverhalten (mangelnde Planung, Übersicht und Ordnung, Vergesslichkeit) oder gereiztem Verhalten im Umgang mit anderen zeigen (Kaluza, 2015).
Negative Beanspruchungsreaktionen können sich verfestigen, wenn sie über längere Zeit hinweg anhalten, und zu nicht mehr einfach rückgängig zu machenden Beanspruchungsfolgen wie körperlichen Erkrankungen, Schlafstörungen, Burnout oder Depressionen führen.
»Burnout« ist wie »Stress« ein Begriff, der in der alltäglichen Diskussion um berufliche Belastung und Bewältigung allgegenwärtig ist. Die bekannteste Definition von »Burnout« stammt von Maslach, Jackson und Leiter (1996). Dieser Definition zufolge kann ein Burnout als ein sich langsam entwickelndes Belastungssyndrom aufgefasst werden, das sich durch drei grundlegende Komponenten beschreiben lässt: 1) Die emotionale Erschöpfung lässt sich als Zustand beschreiben, in dem sich Menschen in ihrer täglichen Berufsausübung dermaßen ausgelaugt fühlen, dass sie weder Begeisterung noch Interesse für ihre Berufstätigkeit zeigen. 2) Depersonalisation meint das Gefühl der Verhärtung und Abstumpfung gegenüber anderen Menschen. Dies kann zu einem zynischen Verhalten und einer negativen Einstellung gegenüber Mitmenschen führen. 3) Die (reduzierte) persönliche Leistungsfähigkeit bezieht sich auf das Gefühl, nicht mehr so viel wie vorher leisten zu können und den Ansprüchen nicht mehr zu genügen. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass »Burnout« eher ein Alltagsbegriff als ein wissenschaftlich präzise gefasstes Konstrukt ist, was sich auch in Verlaufsbeschreibungen des Burnoutsyndroms zeigt ( Kap. 6.2.1). Eine zurückhaltende Verwendung ist deshalb angezeigt.
Nachdem wir die zentralen Begriffe geklärt haben, stellt sich die Frage, wie diese zusammenhängen.