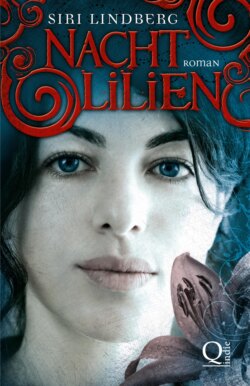Читать книгу Nachtlilien - Siri Lindberg - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
***
ОглавлениеWas Kiéran sah, war kein Gesicht, wie er es kannte. Es war ein Schatten, nur eine Winzigkeit heller als die Dunkelheit, die ihn noch immer umgab. Seine Umrisse waren leuchtende Linien. Augen, Nase und Mund besaß es nicht. Um die ganze seltsame Gestalt zog sich eine Art azurner Lichtkranz, wie der blaue Schimmer auf gehärtetem Stahl. Jetzt bewegte sich die Gestalt, griff mit einem geisterhaften Arm nach ihm. Entsetzt wich Kiéran zurück.
„Alles in Ordnung?“ sagte das Wesen mit Rinalanias Stimme.
„Nein“, stieß Kiéran hervor, er wich der Berührung aus und taumelte den Gang entlang. Nach ein paar Schritten begann er zu rennen. Er brauchte die Finger nicht mehr an der Wand entlangzuführen, er sah deutlich, wo die Wände begannen und endeten, auch die kleinen Unebenheiten des Bodens. Doch dort, wo die Fackel in der Wandhalterung steckte, erkannte er nur die Umrisse des Metallrahmens. Keine Spur von Helligkeit. Er roch den Rauch, doch das Licht der Fackel blieb ihm verborgen.
Es fühlte sich an, als griffen kalte Klauen nach ihm. Kiéran rannte weiter. Zum Archiv. Er musste es wissen. Jetzt. Sofort!
Die metallne Tür war nicht verschlossen, und Kiéran stemmte sich grob mit der Schulter dagegen, so dass sie vor ihm aufschwang. Ein schneller Blick in die Runde – ja, da waren sie, die Regale, die Tische, die Bücherstapel, endlich sah er mit eigenen Augen, was ihm so oft Abschürfungen und blaue Flecken beschert hatte. Schwer atmend griff Kiéran nach einem Buch, irgendeinem Buch, schlug es mit zitternden Händen auf – und blickte auf eine flimmernde Fläche, auf der er mit Mühe undeutliches Gekrakel erkennen konnte. Dabei spürte er an der Art, wie sich das Pergament und der geprägte Ledereinband anfühlten, dass er ein prächtiges Werk hielt, handgedruckt und in mühsamer Arbeit illustriert. Was darin geschrieben stand, würde er wahrscheinlich nie erfahren. Wie Säure brannte die Enttäuschung in ihm.
„Rattendreck!“ brüllte Kiéran und schleuderte das Buch zu Boden. Er zerrte ein anderes Werk aus dem Regal, schlug es auf, erkannte nichts darin und warf es beiseite.
„Das, was du da gerade an die Wand geknallt hast, war Dichtung aus Khelgardsland und stammt aus dem Achten Zeitalter. Ich fürchte, der Einband ist hinüber.“ Kiéran hatte nicht gewusst, wie Yllsa klang, wenn sie wütend war. Ihre Stimme wurde tief und kehlig dabei.
Dann war auch Dinesh da, eine Gestalt mit einem intensiven, rötlich-orangefarbenen Strahlenkranz und blendend hellen Glanzlichtern darauf. „Ganz ruhig, Kiéran. Ihr braucht Zeit, um Euch daran zu gewöhnen, das ist alles. Kommt mit, wir reden darüber und ich erkläre Euch, wie Ihr mit dem Geschenk des Oscurus umgehen könnt.“
„Das ist alles?“ schrie Kiéran, und die furchtbare Wut, die schon so lange in ihm schwelte, brach hervor, ließ sich nicht mehr bändigen. „Ich sehe alles und nichts, Menschen sind Geister und Bücher ein Nichts! Was soll das bedeuten? Erst habt Ihr mir Hoffnung gemacht, und jetzt das! Ihr habt mich betrogen, das ist es doch. Wahrscheinlich werde ich die Welt jetzt für immer so sehen, wie dieses verdammte Oscurus sie wahrnimmt, oder?“
„Ich fürchte schon.“ Dineshs Stimme klang bedauernd, aber nüchtern. „Ich weiß, im Moment fällt es Euch schwer, es zu schätzen, dass Ihr Euch jetzt selbst orientieren könnt. Aber wir alle –“
„Kein einziges Mal werde ich mehr die Sonne sehen können. Das ist kein Geschenk, das ist ein Fluch! Wahrscheinlich ist es in Wahrheit ein Dämon, dem ihr huldigt!“
Auch Dinesh klang jetzt ärgerlich. „Es ist kein Dämon! Wir Priester des Schwarzen Spiegels sind Hüter der alten Mächte, das ist unsere Aufgabe.“
Doch Kiéran hörte nicht mehr zu, er ließ die Worte von sich abgleiten wie Wassertropfen vom Gefieder eines Falken. Mit schnellen Schritten hastete er zu seiner Kammer zurück. Diesmal folgte ihm niemand.
Kiéran machte sich daran, seine Sachen zu packen. Er riss sich die Robe vom Leib und streifte sich das einfache Leinenhemd über, das er in den ersten Tagen seiner Krankheit getragen hatte und das jetzt gewaschen und gefaltet im Schrank lag. Weg mit der Tempelkleidung, sie gehörte nicht zu ihm. Zum Glück war die graue Uniformhose halbwegs heil geblieben, ebenso die Stiefel und der Umhang. Mit der Geschicklichkeit langer Übung legte er seinen Lederpanzer an, doch er hatte kaum die Geduld, die Schnallen zu schließen. Den zerbeulten Helm konnte er an Reyns Sattel befestigen. Dann war er auch schon fertig, sehr viel mehr Besitztümer hatte er hier nicht.
Es war inzwischen Mitternacht, doch das war gleichgültig, mit seiner neuen Sicht würde er Nacht und Tag sowieso nur mit Mühe unterscheiden können. Und Pferde sahen gut im Dunkeln. Kiéran marschierte zum Pferdestall, um Reyn zu satteln.
Dort wartete schon jemand auf ihn. Im ersten Moment dachte Kiéran, dass der Schatten Zarius sein musste; doch an den vogelgleich ruckartigen Bewegungen erkannte er Gerrity. Als sein Gesicht – ein leeres, dunkles Oval, von einem dünnen violetten Strahlenkranz umgeben – sich ihm zuwandte, schauderte Kiéran, und er schloss die Augen, um es nicht sehen zu müssen. Jetzt hörte er nur noch Gerritys Stimme, alles war wie zuvor, und die völlige Dunkelheit erschien ihm fast schon vertraut.
„Jetzt heißt es also Lebewohl sagen“, sagte Gerrity niedergeschlagen. „Es tut mir wirklich leid, dass alles so gekommen ist. Ich dachte wirklich, dass Dinesh dich warnen würde.“
„Nein. Hat er nicht“, erwiderte Kiéran schroff. „Vielleicht hätte ich auch genauer nachfragen müssen. Und jetzt ist es zu spät.“
„Du kannst es wieder abnehmen, das Amulett. Aber dann verlierst du die Sicht wieder.“
Kiéran antwortete nicht. Schwer und warm lag das Amulett auf seiner Brust. Zum ersten Mal hob er die Hand, um es zu betasten. Es war aus einem glattpolierten Metall gefertigt, nur am Rand verlief eine winzige, kreisrunde Schriftzeile. In der Mitte hatte es eine kleine Erhebung. Wahrscheinlich befand sich dort der Tropfen Spiegelflüssigkeit, auf irgendeine magische Art befestigt.
Kiéran wandte sich Gerrity zu, auf einmal spürte er einen Anflug von Wehmut. „Xatos schütze dich. Und danke für alles.“
„Pass auf dich auf.“ Gerrity streckte die Hand aus, und sie umfassten gegenseitig ihre Ellenbogen, so dass ihr Unterarm eine Linie bildete. Der Brudergruß.
„Ich soll dir noch etwas geben. Von Dinesh. Es soll dir ein Andenken sein, an deine Zeit hier, und vielleicht kann es dir einmal helfen.“
Kiéran sah, dass Gerrity ihm etwas entgegenstreckte, einen schmalen Gegenstand, und mit seinen neuen Augen sah er die Umrisse eines Messers. Mit den Fingerspitzen strich Kiéran über die Klinge mit der unverwechselbaren schmalen Blattform und dem tief eingeprägten Zeichen des Schwarzen Spiegels. Es war eins der Tempelmesser, für deren Anfertigung die Priester berühmt waren. Vielleicht hatte Kiéran den Griff während seiner Arbeit in der Waffenkammer sogar selbst geschnitzt.
Kiéran steckte das Messer in seinen Gürtel. „Richte Dinesh und Rinalania meinen Dank aus“, sagte er und hatte zum ersten Mal ein schlechtes Gewissen wegen der Art, wie er sich verhielt. Doch dann hörte er Reyn wiehern, und der Drang, dem Tempel den Rücken zu kehren, wurde übermächtig. Schnell sattelte er den Hengst, den er nur als schwachen Schatten sehen konnte, einen Strahlenkranz hatte er nicht. Dafür nahm Kiéran ihn umso stärker mit seinen anderen Sinnen wahr: Reyns großen, warmen, nach Heu riechenden Körper, dessen Hufe auf dem Kopfsteinpflaster des Hofs Funken zu schlagen schienen, seine schiere Ausstrahlung von Stolz und Kraft. Der Hengst schnaubte und riss immer wieder unruhig den Kopf hoch; er spürte wohl, dass etwas nicht stimmte.
Kiéran schwang sich auf seinen Rücken. Der Hengst bäumte sich auf, doch Kiéran war darauf vorbereitet und brachte ihn schnell wieder unter Kontrolle. Er lenkte ihn auf die Handelsstraße nach Osten, dann warf er noch einen kurzen Blick zurück. In diesem gedrungenen Klotz von einem Tempel hatte er also die letzten Wochen verbracht! Staunend sah er, dass die Mauern silbrig schimmerten wie fließendes Wasser. Vielleicht gab es nur eine Handvoll Menschen, die sie je so gesehen hatten. Plötzlich ahnte Kiéran, warum die Priester nur so wenige Wachen aufstellten, warum sie sich aus seiner Sicht so sorglos verhielten. Sie geboten über eine Macht, die jedem bewaffneten Angreifer überlegen war.
Reyn zerrte heftig an den Zügeln, er wollte rennen – und jetzt durfte er endlich. Kiéran gab ihm den Kopf frei und beugte sich dicht über seinen Hals, als sie über die menschenleere Handelsstraße galoppierten. Es war ihm fast schon unheimlich, wie schnell sie den Ort Daressal passierten, an dem er mit seinen Gefährten gegen Cerdus Maharir gekämpft hatte. Den Ort, an dem sein Leben zerfallen war. Schon nach ein paar Momenten hatten sie ihn hinter sich gelassen. Wiedererkannt hatte Kiéran ihn sowieso nicht – alles sah so anders aus, so furchtbar fremdartig. Häuser waren für ihn nur noch düstere Umrisse, und Landschaften konnte er fast nicht sehen. War das da eine Wiese, oder doch nur schwarzer Nebel?
Kühl strömte die Dunkelheit über ihn und Reyn hinweg, und nur die Augen einer Eule folgten ihnen noch eine Weile.
Er ließ Reyn so lange galoppieren, wie dieser wollte; es dauerte fast eine Stunde, bis er sich ausgetobt hatte und bereit war, in Trab zu fallen.
Kiéran war entsetzlich müde, und er sehnte sich danach, zu schlafen und für eine Weile alles zu vergessen – seine unheimlichen neuen Augen, den hässlichen Abschied aus dem Tempel, seine schwierige Zukunft. Er brauchte lange, um einen guten Platz für die Nacht zu finden. Schließlich fand er etwas, das er als kleines Wäldchen erkannte, und als er auf eine Kulmesnuss trat, wusste er auch, welche Bäume dort wuchsen. Sehen konnte er die Nüsse nicht. Gegenstände aus Metall dagegen, zum Beispiel das Tempelmesser, zeichneten sich als blasse Umrisse ab, wie Schatten in einer mondhellen Nacht.
Kiéran konzentrierte sich auf das Gefühl der Luft, die ihn umströmte, um zu erkennen, auf welcher Seite er im Windschatten der Bäume war. Schließlich hatte er eine gute Stelle gefunden, und nachdem er Reyn versorgt hatte, machte er es sich unter einer Kulme halbwegs bequem und rollte sich in seinen Umhang. Oft genug hatte er auf Patrouille so geschlafen, und es erschien ihm derart vertraut, dass er schnell wegdämmerte.
Einen Sonnenaufgang gab es für ihn nicht. Er wachte erst auf, als er die Geräusche von Ochsenkarren auf der Handelsstraße hörte. Mit knurrendem Magen saß Kiéran im taufeuchten Gras, aß ein paar Kulmesnüsse vom letzten Jahr, die er mehr durch Zufall ertastet hatte, und blickte hinab auf eine Schar von farbgesäumten Schatten, die über die Straße zog. Waren das wirklich ganz gewöhnliche Menschen, die ihren alltäglichen Geschäften nachgingen? Ja, es musste so sein. Er scheute noch davor zurück, ihnen zu begegnen. Vielleicht kann ich sie gar nicht als normale Menschen begreifen, so wie sie für mich jetzt aussehen. Und was werden sie an mir spüren, werden sie vor mir zurückschrecken? Werden sie merken, dass ich noch immer irgendwie blind bin?
Es gab nur einen Weg, es herauszufinden. Seinen nächsten Abend würde er in einem Gasthaus verbringen.