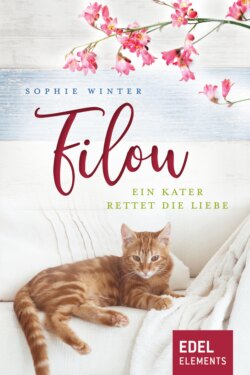Читать книгу Filou - Ein Kater rettet die Liebe - Sophie Winter - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ZWEI
ОглавлениеWenn man selbst von seinem besten Freund nicht mehr verstanden wird, hat das Leben seinen Sinn verloren, dachte Filou. »Du bist das Problem«, hatte Fidel gesagt. Ungeheuerlich! Und zutiefst ungerecht.
Während er lustlos am Platz hinter dem Kriegerdenkmal vorbeitrottete, hörte er die alten Männer des Dorfs Pétanque spielen. Normalerweise provozierte ihn das »Klack!« der Kugeln, wenn sie auf dem harten Boden aufprallten und gegeneinanderstießen. Ihn überkam dann stets der unwiderstehliche Drang, hinterherzulaufen und eine der Kugeln zu fangen. Aber diesmal ließ ihn das kalt.
Er kam sich unendlich allein vor. Dass er mit Josephine über ihren gemeinsamen Sohn nicht reden konnte, verstand sich von selbst. Eine Mutter ließ auf ihren Sohn nichts kommen. So war das auch mit seiner Maman gewesen. Sie hatte ihn vergöttert, umschnurrt und umschmeichelt, sodass er sich als der schönste und glücklichste Kater auf Erden fühlte. Bis es eines schrecklichen Tages passiert war. Er hatte sie im Straßengraben gefunden, noch warm und weich, aber reglos. Stunden hatte er neben ihrem erkaltenden Körper ausgeharrt und darauf gewartet, dass sie wieder aufwachte. Bis Lucrezia ihn fand. »Deine Mutter ist tot. Hör auf zu heulen und komm mit«, hatte sie barsch befohlen.
Nein, er war wirklich nicht verzärtelt, nicht so wie Felix. Er hatte das Überleben gelernt, oh ja, auf die harte, die ganz harte Tour. Alles hatte er sich erkämpfen müssen. Doch sein Sohn lachte nur, wenn er ihm von den alten Zeiten erzählte, als sich die Katzen von Beaulieu und Umgebung um die Überreste prügelten, die am Ende des Markttags liegen blieben, um schleimige Fischreste und knochenharte Käserinden. Felix kannte nur feinstes Tütenfutter. Und die Katzen von Beaulieu und Umgebung zankten sich schon lange nicht mehr, seit Maurice, Garibaldi und Diabolo das Kommando übernommen hatten. Die drei schwarzen Brüder führten ein strenges Regime, in dem jeder seinen Platz hatte, und unterdrückten jeden Versuch, sich davon zu befreien. In Beaulieu herrschte seither Ruhe. Friedhofsruhe.
Filou überquerte gedankenverloren die Grande Rue, die zwar nicht wirklich groß war, aber groß genug für regen Straßenverkehr. Fast hätte ihn ein Auto erwischt, dessen Fahrer ihm wütend hinterherhupte. Der große Bottich mit dem Oleander lockte mit allerhand Duftspuren. Doch die interessierten ihn heute nicht. Auch der köstliche Geruch nach frischem Brot, der aus der Bäckerei strömte, vermochte ihn nicht zu reizen. Aus der offenen Tür von Brunos Bar quoll wie immer ein hässlicher Gestank nach Zigaretten und Pastis; dort lief er schneller und bog links ab, in die Ruelle des Camisards. Vor dem Haus mit den leuchtend rot gestrichenen Fensterläden lag Yapper, der alte Quälgeist, der sich nicht ein einziges Mal dankbar dafür gezeigt hatte, dass Fidel und er ihm im letzten Sommer das Leben gerettet hatten. Früher hatte es der Dackel für seine Pflicht und Schuldigkeit gehalten, andere Lebewesen mit wildem Gekläffe durch die Gassen zu jagen. Heute ignorierte er alles, sogar Katzen. Er wurde alt.
Links ab in die Rue Basse. Hier, im Keller eines alten Steinhauses, hatte Filou einst gewohnt, mit Lucrezia, dem großen grauen Scheusal, das ihn aufgenommen hatte nach Mamans Tod. Aus reiner Herzensgüte, wie sie nicht müde wurde zu behaupten. In Wirklichkeit hatte sie ihn gnadenlos ausgebeutet. Die alte Luc war ein gerissenes Miststück, die nur eine Kreatur auf dieser Welt liebte: sich selbst. Dabei hatte sie es ihm, nur ihm zu verdanken, dass sie heutzutage im warmen Nest hockte. In Paris. Bei Marla.
Der Gedanke an Marla peinigte ihn mit Bildern von glücklichen Zeiten, als er noch jung und unschuldig war. Eines Tages war er in einem verwunschenen Garten aufgewacht, gebettet auf weiches Gras unter einem duftenden Mimosenbaum, geweckt von einer Mädchenstimme, die geheimnisvolle Worte deklamierte. Passiflora caerulea. Arbutus unedo. Nepeta cataria. Filou bildete sich ein, den betörenden Geruch der Katzenminze in der Nase zu haben, vermischt mit dem Duft der Mimosen, deren Blüten während der Nacht auf ihn herabgeregnet waren.
Marla, die eigentlich Marla Lara hieß – aber wer wollte schon so heißen? Die ihn mit Erdbeeren und Möhren fütterte, weil das gesund war. Die Bällchen warf, die er fangen musste. Die mit ihm floh, als ihre Eltern ihn kastrieren lassen wollten. Und die er verlassen hatte, als sie mit den Eltern nach Paris ging. Ja, er war zurückgeblieben, damals, hatte sich aus dem Auto gestohlen, heimlich, damit alle anderen Tiere bei Marla bleiben konnten. Das hatte er nicht nur einmal bereut.
Marla hatte ihn aus tiefster Armut gerettet, ihn und leider auch Lucrezia, mit der er im finsteren Kellerloch gehaust hatte. Aber das alles war lange her, und das Haus in der Rue Basse hatte neue Besitzer, die es so gründlich renoviert hatten, dass weder Katz noch Maus ein Löchlein finden würden zu einer Herberge, die vor den Herbststürmen und den Winterfrösten schützte.
Er überquerte die Gasse und lief hinüber zu den Gemüsegärten, in denen die Tomatensträucher jeden Tag größer wurden. Hinter den Gärten führte ein gepflasterter Weg den Berg hinauf. Hier war es feucht und kühl, Moos schimmerte zwischen den Pflastersteinen, und vertraute Gerüche stiegen ihm in die Nase. Fast hätte er der Versuchung nachgegeben und sich jedem einzelnen Duft gewidmet, um seine Botschaft zu entziffern. Früher waren Maultiere hier hinaufgelaufen, hieß es, mit schweren Lasten auf ihren Rücken. Doch deren Gerüche hatten keine Spuren hinterlassen.
Der Pfad wand sich den Berg hoch, bald wuchs kein Moos mehr zwischen den Steinen, sondern wilder Thymian. Am Wegesrand wucherte der Buchs, der wie ein halbtoter Marder stank. Buchs war giftig, das hatte Maman ihm eingeschärft, so giftig wie Christrosen und Goldregen und Efeu. Oben, auf dem Plateau unterhalb der Felsspitze namens »Roche du Diable«, reckten Wacholderbüsche ihre dornigen Zweige in die Höhe. Auch die waren giftig. Felix hatte ihn ausgelacht, als er ihn vor solchen Pflanzen warnen wollte. »Was soll ich denn mit den stacheligen Dingern und den stinkenden Büschen? Die schmecken doch gar nicht, Dad!« So ein kleiner Klugscheißer.
Filou machte es sich auf seinem Lieblingsplatz bequem, auf einer von der Sonne erwärmten Felsnase, von der aus er ganz Beaulieu überblicken konnte. Hier pflegte er Wache zu halten über alles, was er liebte. Ja, das Leben war schön. Ach was: Es war großartig. Er hatte eine Familie, Josephine, seine große Liebe, und den gemeinsamen Sohn Felix. Und er hatte eine Heimat: ein Haus mit dicken Mauern, in dem Marla und ihre Eltern gewohnt hatten und in dem heute Henri und Isabelle lebten, der Musiker und die schöne Isabo aus dem Café am Markt. Ja, er mochte auch Henri und Isabelle, er und Josephine und vor allem der kleine Felix hatten die beiden schließlich erfolgreich verkuppelt. Alles war gut.
Wenn nur diese verdammte Unruhe nicht wäre. Diese Unzufriedenheit. »Du bist das Thema«, hatte Fidel gesagt. Das saß wie ein Stich mitten ins Herz.
Die Sonne stand schon tief. Filou legte den Kopf auf die Vorderpfoten und schaute zu, wie sie in einem rotgoldenen Rausch versank. Und langsam, ganz langsam, wagten sich die ersten Sterne vor. Erst der eine, der besonders hell leuchtete, er nannte ihn den Abendstern. Dann die unzählig vielen anderen. Und endlich stand der Mond am Himmel, ganz schmal war er geworden; er lag auf dem Rücken, wie ein Faulenzer in der Hängematte. Wie Felix, dachte Filou und lachte das erste Mal an diesem Tag über sich selbst. Wahrscheinlich hatte Fidel recht. Der Kleine würde seinen Weg gehen, und es war doch eigentlich schön zu wissen, dass es ihm nicht so schwer gemacht werden würde wie seinem Vater.
Und doch – man musste Gefahren kennen, um sie zu erkennen. Man musste wissen, wann man entspannt bleiben konnte und wann man wachsam sein musste. Es hatte in Beaulieu einen hübschen blaugrauen Kartäuserkater gegeben, der nicht nach rechts noch nach links schaute, wenn er die Straße überquerte. Er war der festen Überzeugung, die Autos würden wie von Geisterhand stehen bleiben, wenn er sich nahte. Lange Zeit ging das gut. Immer wenn man quietschende Bremsen, lautes Hupen und ärgerliche Menschenstimmen hörte, hieß es: »Dion ist wieder unterwegs!« Doch eines Tages hatte ihn Monsieur Eveque übersehen, der war schon alt und trug eine Brille – und vielleicht hatte er auch nur die Bremse verfehlt.
Das war’s dann für den schönen Dion. Filou hatte die Geschichte oft erzählt, damit Felix daraus lernte. Doch der wollte nicht lernen.
»Aber sie bleiben immer stehen, wenn wir kommen«, pflegte der Kleine zu krähen. »Weil wir so schön sind!«
Ja, das hatte Dion ebenfalls geglaubt.
Filou sog die kühle Nachtluft tief in sich hinein. Es stimmte, alle standen still, wenn er und Felix ihre Runde durchs Dorf machten. Die Nachbarn riefen »Minouminouminou«, die Touristen schnalzten mit der Zunge und lockten sie mit Stückchen von ihren Schinkenbaguettes. Doch auf solche Freundlichkeit konnte man sich nicht verlassen.
Wie also konnte er Felix zeigen, woran man Gefahren erkennt und wie man sie vermeidet?
Das Gewitter der Zikaden, das lauter und lauter geworden war, ebbte ab. Ein Käuzchen rief. Unten im Tal, von den Teichen her, übertönte der Ruf des Glockenfiroschs das Quarren der Kröten. Nur ein Geräusch fehlte völlig. Kein Schrei einer empörten Katze oder eines kämpferischen Katers war zu hören.
Das hatte Beaulieu seinen geheimen Herrschern zu verdanken. Alle Katzen ächzten unter dem Regime von Maurice, Garibaldi und Diabolo. »Groß, schwarz, stark – mehr Kater braucht es nicht«, lautete ihr Wahlspruch. Als der große Magnifico noch lebte, war ihre Herrschaft gemildert durch seine Weisheit. Doch nach seinem Tod setzten sie mit brutaler Unterdrückung durch, was sie Ruhe und Ordnung nannten. Sie beanspruchten die besten Happen an Markttagen. Sie duldeten keinen Widerspruch und keinen Widerstand, Ausreißer wurden gebissen und geschlagen, bis sie kuschten. Keiner wagte, gegen ihre Herrschaft aufzustehen. Und während die drei Brüder immer frecher und fetter wurden, wanderten andere aus, bevor sie so dünn und struppig wie Mignon wurden, die man eines Tages tot vor dem Kirchenportal gefunden hatte. Verhungert.
Filou schämte sich fast ein bisschen für das gute Leben, das er heute führte. Niemals würde er die mageren Zeiten vergessen, die hinter ihm lagen. Ja, sein Sohn sollte, er durfte es besser haben. Ach was: Alle sollten es besser haben als er, dem damals niemand auch nur eine Fischgräte gegönnt hatte! Vielleicht musste man endlich etwas tun? Wenigstens gegen die eigenen Unterdrücker, wenn man schon nicht die ganze Welt retten konnte?
Was tun, das war gut. Aber was?