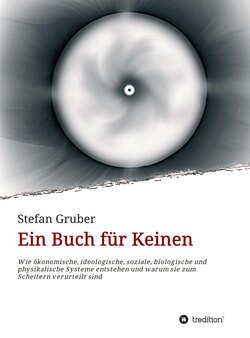Читать книгу Ein Buch für Keinen - Stefan Gruber - Страница 18
ОглавлениеDer Kreis
Die Urschuld
Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß: an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott …
1. Mose 3, 4-5
In den kommenden Unterkapiteln werden die Namen dreier Persönlichkeiten immer wieder fallen: Paul C. Martin – Volkswirt und Wirtschaftsjournalist –, Gunnar Heinsohn – Soziologe und Ökonom –, und Otto Steiger – Wirtschaftswissenschaftler. Im Zentrum der Arbeiten von Heinsohn und Steiger steht die Eigentumsökonomik.1 Auf Grundlage dieser Theorie formulierte Paul C. Martin den sogenannten »Debitismus« und die »Machttheorie«. Gemeinsam bilden die Machttheorie und der Debitismus ein alternatives und in sich schlüssiges ökonomisches Gegenmodell zum längst überholten und dennoch an Universitäten unterrichteten neoklassischen Tauschparadigma2. Wenngleich Martins Modell nicht der Weisheit letzter Schluss sein mag und zur Stunde von Experten an einer allgemeinen Theorie gearbeitet wird, die sowohl die Neoklassik und den Postkeynesianismus, aber gleichzeitig auch Martins Debitismus und Heinsohns/Steigers Eigentumsökonomik jeweils als Spezialfälle einordnen kann3, basiert Martins Modell, anders als die neoklassische Volkswirtschaftslehre, nicht auf unbewiesenen Behauptungen und widerlegten Grundannahmen, die stets nur zu falschen Schlüssen und unzutreffenden Vorhersagen führen können. Dass diese falschen Grundannahmen nicht bloß historischer oder theoretischer Natur sind, sondern sogar dem Prozess der Geldschöpfung und -vernichtung heute eklatant widersprechen, wie jeder leicht anhand von Geschäftsbank- und Zentralbankbilanzen nachprüfen kann, ist der eigentliche Skandal einer Volkswirtschaftslehre, die für sich in Anspruch nimmt, auf dem Boden der Tatsachen und der Wissenschaft zu stehen. Eine Anerkennung der realen Gegebenheiten, wie sie der Debitismus vollzieht, würde dementsprechend mit einem massiven Gesichtsverlust im universitären Betrieb einhergehen. So haben die Anhänger neoklassischer Modelle (zusammen mit allen anderen Tauschtheoretikern von Marx bis zur Schule der österreichischen Nationalökonomie) mit ihrem »Geld ist Tausch- und Schmiermittel«-Paradigma zwar die wesentlich einfacheren (aber falschen) Antworten, gleichzeitig aber waren sie (anders als die Debitisten) nicht in der Lage, die bis heute andauernde Wirtschaftskrise ab 2007 vorherzusehen und ihren Verlauf zu begreifen. Der Keynesianismus1 andererseits schüttet seit Jahrzehnten noch mehr Öl ins Feuer, weil auch er die Zeit/Termin-Problematik des kapitalistischen Systems nicht erklären kann. Ein weiterer – und psychologisch betrachtet vielleicht sogar der eigentliche – Grund, warum sich der Debitismus wohl niemals im universitären Alltag durchsetzen wird, ist der, dass er den Leuten jegliche Hoffnung auf ein funktionierendes Wirtschaftssystem raubt. Derart nihilistische Positionen werden von der Massenpsychologie so gut es geht verdrängt, denn Hoffnung ist der wichtigste Treibstoff für den menschlichen Antrieb; sie erzeugt erst die Dynamik in der Geschichte des Homo sapiens sapiens. Da wir in diesem Buch Mystik2 (die Analogie als Werkzeug zur Beschreibung der Realität) und Wissenschaft (die Kausalität als Werkzeug zur Beschreibung der Wirklichkeit) als gleichberechtigt betrachten, werde ich im Folgenden den Debitismus/die Machttheorie erläutern und auf mystischer Ebene interpretieren.
Am Beginn von Debitismus und Machttheorie steht die menschliche Urschuld. Als Urschuld wird die Schuld bezeichnet, die jeder Mensch sich selbst gegenüber hat. Paul C. Martin und Walter Lüftl schreiben dazu in Der Kapitalismus – ein System, das funktioniert: »Jedes Kind, das auf die Welt kommt, ist verschuldet bis unter seinen süßen Haarflaum. Es sind die Schulden, die der neue Mensch sich selbst gegenüber hat. Schulden, die aufgrund seiner Existenz entstanden sind. Diese Schulden lassen sich überschlägig berechnen: Es sind die Kosten, die der neue Mensch hat, um sein Leben lang am Leben zu bleiben. Die Ausgaben für Nahrung, Wohnung, Kleidung usw., alles abgezinst auf die Gegenwart.«
Was wie selbstverständlich klingt, hat später weitreichende Konsequenzen, weshalb es für das Verstehen des Debitismus entscheidend ist, hier am Ursprung anzusetzen. Sich selbst etwas schuldig zu sein, bedeutet nichts anderes, als dynamisch zu sein, d.h. der Schuldige muss aktiv sein, um seine Schulden, den Zustand »Leben«, bedienbar zu halten.
In vorstaatlicher Zeit musste er sammeln und jagen, um seine Grundbedürfnisse zu tilgen und je weniger der Mensch in der Lage war, seine Urschuld zu tilgen, desto geschwächter wurde er im Zeitablauf und desto schwieriger wurde es für ihn, von dieser Schuld nicht erschlagen zu werden, denn ein Bankrott war und ist gleichbedeutend mit dem physischen Tod. War für den paläolithischen Wildbeuter die Vorratshaltung von Nahrung noch eine Last für sein nomadenhaftes Dasein, versuchen dagegen der sesshafte Stammesgenosse des Neolithikums seine Urschuld und der Kapitalist heute seine Geldschuld durch Hortung von Nahrung bzw. Geld dauerhaft zu tilgen und beide stehen in einem Konkurrenzkampf mit anderen Teilnehmern, anderen Kapitalisten oder anderen Stämmen und Tieren. Dem Kredit (männliche Dynamik) steht dabei immer ein Guthaben (weibliche Ruhe) gegenüber, so wie im Ungleichgewicht der Natur die erlegte oder gehortete Beute des einen die fehlende Beute des anderen im Konkurrenzkampf ist.1 Über der Urschuld des einzelnen Stammesgenossen steht seine Schuld der Natur gegenüber, der er seinen materiellen Körper entliehen hat. Tilgt er zuvor nur die permanent anlaufenden Zinsen, um den Zustand »Leben« zu erhalten, begleicht er mit dem Tod seine Hauptschuld. Das Analogon hierzu im Wirtschaftsleben ist, wie wir später noch sehen werden, die monatliche Steuerschuld dem Staat gegenüber, welche erst die Kontraktschuld des Kapitalisten und mit ihr die Geburt des Zinses evoziert. Sie ist erst mit dem Tod des Kapitalisten/Konsumenten oder der Zersetzung des Staates beglichen. Die nicht zeitgerechte Tilgung der Urschuld wiederum erzeugt einen geschwächten Körper und Geist und erfordert ein Mehr an Nahrung und Ruhe, um sich wieder aufzupäppeln.2 Dieses Mehr im Zeitablauf ist das fraktale Analogon zum Zinseszins im staatlichen Wirtschaftsleben.
Das Sein selbst ist, abstrakter gedacht, ohne Dynamik nicht definierbar, ja Sein ist Dynamik – das ständige Ungleichgewicht des materiellen Seins, das Systeme durch ständigen Anpassungsdruck evolviert, ist damit die Schuld des Seins sich selbst gegenüber. Nur die Leere ist in Ruhe und sich damit nur Erfahrung schuldig, womit sie das Sein aus der Taufe hebt. Jedes System des Seins ist für alle anderen Systeme (die das Milieu bilden) ein Störfaktor und vice versa. Gleichzeitig ist es erst diese Störung, die ein System bedingt und erhält. Jedes System ist sich die Selbsterhaltung schuldig – ist ein Jäger evolutionär bedingt im Überlebensvorteil, so steht die unterlegene Art als Beute unter »Zugzwang«1, d.h. sie muss sich den neuen Bedingungen anpassen. Sie ist sich also Information schuldig, um zu überleben. Passt sie sich an, ist seinerseits der Fressfeind unter Zugzwang. Diese Akkumulation von Information im dynamischen Wechselspiel erzeugt Komplexität – beispielsweise im betreffenden Wirtschaftsraum, der evolutionsgetriebenen Natur, aber auch in einer Ideologie oder Theorie, die permanent nach außen hin verteidigt oder an neue Erkenntnisse angepasst werden muss – und der Grad an Komplexität verläuft zuerst linear und gegen Ende exponentiell. Und das so lange, bis die »Kosten« zur Aufrechterhaltung der Komplexität – in Form von Geld im Wirtschaftsraum, des Energieaufwandes zur Lebenserhaltung der betreffenden Art in der Natur, der Propaganda- und Gewaltmaschinerie zur Aufrechterhaltung einer Ideologie oder der Verteidigung einer Theorie, nachdem sie durch permanente Anpassungen an neue Erkenntnisse und Entdeckungen verwässert wurde – den Nutzen »im Milieu« übersteigen. Dann geht das betreffende System unter, d.h. der Wirtschaftsraum wird von einer schweren Krise heimgesucht, die betreffende Tierart stirbt aus, eine Ideologie scheitert und die axiomatische Basis einer Theorie wird durch Zusatzannahmen so stark ausgehöhlt, dass sie als widerlegt gilt oder als Spezialfall einer größeren, umfassenderen Theorie von dieser einverleibt wird. Diese Form der bilanziellen Interpretation lässt sich innerhalb unseres bekannten Universums2 bis in den subatomaren Bereich nachvollziehen, wo im Vakuum, als Fraktal zur spirituellen Leere als Quelle aller möglichen Formen des Seins, ständig Teilchenpaare (Materie/Antimaterie-Paare) entstehen, indem sie sich Energie aus dem Vakuum leihen, um sich anschließend innerhalb extrem kurzer Zeit3 wieder gegenseitig zu zerstrahlen und die Energie damit zurückzuzahlen.4 Auch hier ist das Vakuum, als Milieu, die Quelle und gleichzeitig Störquelle des dualistischen, virtuellen Teilchenpaares und umgekehrt besteht das Quantenvakuum, das dem virtuellen Teilchenpaar nach der Existenz trachtet, aus genau diesen Vakuumfluktuationen und definiert sich erst durch sie. Auf metaphysischer Ebene schuldet sich das Quantenvakuum die Erfahrung und das Teilchenpaar schuldet sich selbst dem Quantenvakuum. Interessant ist hier, dass es auf der untersten Ebene des materiellen Seins kein Derivat der Zeit mehr geben kann, das auf einer Zeitskala anwächst, da ein virtuelles Teilchen bereits bei seiner Entstehung seine Komplexitätsgrenze erreicht hat. Hier ist die Zeit selbst der limitierende Faktor: Je höher die Energie, die sich das Teilchenpaar aus dem Vakuum borgt, desto kürzer die Zeit, die es existieren darf. Dabei ist »existieren« ein sehr vager Begriff, was virtuelle Teilchen angeht. Denn diese Teilchen sind – sofern man sie überhaupt als »seiend« betrachten kann – mehr mathematische Konstrukte ohne messbare Eigenschaften. Erst wenn einem virtuellen Teilchen die Energie zugeführt wird, die es aus dem Vakuum geborgt hat, wird es zu einem realen Teilchen, d.h. man bezahlt statt der Teilchen die Energie ans Vakuum (die anderswo dann fehlen muss; der Energieerhaltungssatz bleibt unverletzt), um den noch nicht realen Teilchen zur Existenz zu verhelfen. Hier haben wir die Analogie zum Möglichkeitsraum der spirituellen Leere, in der Gott einen Teil beobachten muss, um ihm zur Realität zu verhelfen.1 Der Unterschied ist, dass das Vakuum ein Fraktal der göttlichen Leere ist, das den Fesseln der Naturgesetze unterworfen ist, die es selbst miterzeugt, und das dementsprechend potentiell existieren muss (anstatt nicht real zu existieren, so wie die Leere). Und so wie Gott sich die Erfahrung und das Sein sich die Vollständigkeit schuldig ist, so haftet der Mensch an der Urschuld, auf die wir nach diesem kleinen Ausflug auch wieder zurückkommen. Martin schreibt:
»Jeder Mensch ist sich selbst also etwas schuldig. Dies ist die Urschuld. Dies ist auch jener Umstand, bei dem viele Religionen ansetzen und viele Mythen. Sich selbst etwas schuldig zu sein, setzt ein Erkennen der Schuld voraus. Menschen, die nur in den Tag hinein vegetieren, Menschen, die es in der Vor- und Frühgeschichte zweifellos gegeben hat, lange bevor sich Reflexionen und Selbsterkenntnis entwickelt hatten, wissen nichts von dieser Schuld. Sie leben instinktgesteuert wie ein Tier. Sie nehmen sich ihre Nahrung, wo sie etwas finden, und sie legen sich nieder, wo es gerade geht.«
Martin sieht also den Ursprung der Urschuld in der ersten mentalen Selbstreflexion. Diese erst zeigt dem Menschen, dass er sich etwas schuldig ist, während er zuvor im Paläolithikum unbewusst lebte wie ein Tier. Das Erkennen der eigenen Schuld ist damit gleichzeitig der Startpunkt der Menschwerdung, was uns zwangsläufig zur Erbsünde (= Urschuld) und zum Garten Eden führen wird: »Die Erkenntnis, sich selbst etwas schuldig zu sein, muss zusammenfallen mit der Erkenntnis, dass Zeit vergeht. Tiere kennen dieses ›Zeitgefühl‹ bekanntlich nicht.«1
Der Sündenfall gilt somit als Sinnbild für das Auseinanderbrechen der Zeit in Vergangenheit und Zukunft, sowohl bei der Schöpfung des Seins selbst als Selbstreflexion Gottes (das Ungleichgewicht, das ewigen Wandel hervorbringt und so erst den Zeitbegriff schafft.2) als auch, fraktal weitergesponnen, bei der ersten Selbstreflexion des Menschen (Wer war ich? – Wer bin ich? – Wer will ich sein?). Martin schreibt:
»Es ist die Vertreibung aus dem Paradies. Paradies ist das griechische Wort für ›Garten‹. Es steht in der Erinnerung der Menschen für jenen Zustand, in dem alles zuhanden ist, in dem keine Zeit vergeht und die Menschen daher unsterblich sind. Die Drohung Gottes, ›aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen; denn welches Tages du davon issest, wirst du des Todes sterben‹, ist eine Tautologie, es kommt zweimal das Gleiche zum Ausdruck: ›erkennen‹ und ›sterben müssen‹. Die Erkenntnis ist eben die, dass die Zeit doch vergeht, dass man an ein Morgen denken muss, dass im Zeitverlauf alle Schulden, auch diejenigen, die man sich selbst gegenüber hat, nur größer werden [wer hungert, muss die Kalorien, die ihm fehlen, wieder zuführen, Anm. d. Autors]. Konsequenterweise passiert an der entscheidenden Stelle ein Verzehr. Ein Konsumakt wirft uns aus dem Paradies. Konsumieren müssen nur endliche Menschen – oder eben solche, die erkannt haben, dass sie endlich sind. Wer ewig lebt, wovon im Paradies zunächst auszugehen war (sonst hätte es keine Todes-Drohung geben können!), der lacht über Konsumakte: Warum einen Apfel essen, warum gerade jetzt, warum nicht erst in 100 Millionen Jahren?«
Der Text spricht für sich. Was hier hervorgehoben werden muss, ist die Tatsache, dass mit der ersten Selbstreflexion die Zeit erkannt wird und mit der Zeit die eigene Sterblichkeit und mit ihr die Schuld sich selbst gegenüber, denn: »Wer lebt, ist sündig. Denn wer lebt, ist schuldig.« Die Urschuld ist in unserem spirituellen Modell selbst nur ein Fraktal einer noch tieferen Schuld: dem Mangel an Erfahrung! Existenz an sich (!) existiert nur durch den Willen Gottes, sich selbst zu ergründen und zu erfahren. Die Existenz erzeugt und erhält sich nur dadurch selbst: als der Wille zum Dasein, der sich als Wechselspiel kooperierender und konkurrierender Systeme offenbart. Die Leere (Gott) opfert ihre Vollständigkeit und damit sich selbst, um die Schuld nach Erfahrung zu bedienen und die daraus resultierenden Systeme des Seins wollen wieder vollständig werden und sind im Wechselspiel mit ihrem Milieu auch ständig dazu gezwungen, komplexe Systeme aufzubauen, um den Systemerhalt zu garantieren.1 Alle fraktalen Abspaltungen Gottes, vom Urplasma bis zum Leben, sind schuldig. »Und ihr werdet sein wie Gott« – schuldig wie Gott!
Diese Ur-Urschuld ist der Antrieb für die unaufhörliche Kreation des Existenten in unendlicher Variation, in unendlicher Zahl, in zeitloser Zeit. Die Schuld leitet erst die Dynamik ein, deren inhärente Folge die Schöpfung immer komplexerer Strukturen ist (die Schaffung von Information). Gott selbst – als Leere und Summe aller Möglichkeiten – greift in sich selbst ein (Selbstreflexion), um einen Teil seiner selbst zu erfahren bzw. um überhaupt erst existent zu sein. Leere bedeutet Nullinformation und kann somit nicht erfahren werden; Bewusstsein und Information bedingen einander. Aus diesem Spannungsfeld zwischen der unvollständigen Information (dem Sein) und der totalen Information (die sich zu Leere annihiliert) entsteht die Dynamik des Seins – der Zeitpfeil von Unvollständigkeit (männliches Sein) zur Vollkommenheit (weibliche Leere). Das ist die Dichotomie, die sich im Sein fraktal fortpflanzt: Gott ist die Zeit (männliche Dynamik2) und der Raum (weibliches Gefäß3) – und das Sein kann ohne Dynamik bzw. Wandlung nicht existieren. Stillstehen kann nur die Leere.
Das Tier (Ordnung, d.h. niedrige Entropie) greift allein durch seine bloße Existenz, durch Nahrungsaufnahme, Atmung, Körperwärme etc. ins Gesamtgefüge ein. Es verändert dabei das dynamische Milieu (Chaos, d.h. hohe Entropie), in dem es sich bewegt, sodass es früher oder später, schon allein durch die rekursiven Auswirkungen seiner puren Existenz, zu einer erneuten Anpassung gezwungen ist oder aber aufgrund der fehlenden Flexibilität infolge zu hoher Komplexität ausstirbt.4 Später erscheint dann der Mensch, dem seine Urschuld bewusst wird und der beispiellose Zyklen initiiert, um diese Schuld dauerhaft getilgt zu wissen. Aus dieser Bewusstwerdung der Schuldigkeit sich selbst gegenüber, mithin der Bewusstwerdung seines eigenen Todes und der ablaufenden Zeit, erwächst der Kulturzyklus und mit ihm gigantischer technologischer Fortschritt, Kultur, Kunst, Poesie und Intellektualität, ebenso wie Krieg, Industrialisierung, Massentierhaltung, Raubbau und geistige Degeneration.
Am Rande möchte ich noch eine Interpretation zum Thema Urschuld und Erbsünde anführen, die aus den Weiten des Internets stammt. Dort schreibt ein User, dass das Erkennen der Nacktheit als Auslöser der Urschuld metaphorisch für die Menschwerdung steht, da der Mensch eben kein Fell besitzt, ja nicht einmal Krallen, scharfe Zähne oder sonstige Schutzmechanismen, die ihn im evolutionären Wettstreit als Tier überleben lassen könnten – er ist sprichwörtlich »nackt«. Daher ist er gezwungen, ein selbstreflexives Bewusstsein hervorzubringen, sich zu kleiden (er verdeckt seine Blöße und startet den sexuellen Zyklus1), das Feuer zu entdecken, Nahrung zu horten usw. Hier starten die Erkenntnis der Urschuld und darauf aufbauend der Raffzwang bzw. im Zuge dieser Erkenntnis die erste Selbstreflexion. Dieser zündende Bewusstseinsfunke bedingt das Auseinanderbrechen der Zeit: Der Mensch ist nun zur Planung gezwungen und muss an ein Morgen denken. Es ist also ein evolutionärer »Rückschritt« (Nacktheit), der ihn zum Fortschritt zwang2: die Entstehung des Selbst-Bewusstseins.
Martin greift zum besseren Verständnis den Gedanken des deutschen Sozialisten Carl Hirsch auf, indem er sagt: »Wir sehen den Menschen als eine Einheit von Körper und Kopf. Um das Urschuld-Phänomen besser fassen zu können, empfiehlt es sich aber, beides zu trennen. Der Kopf ist der Ort, wo die Schuld sich selbst gegenüber erkannt und, wenn man so will, ›verbucht‹ wird. Der Körper ist der Gegenstand, der eingesetzt wird, um die Schuld abzuarbeiten. Zugleich aber der Ort, der ursächlich ist für die Schuld, die zur ›Selbst‹ -Erhaltung entsteht.«
Der Dreh- und Angelpunkt zur späteren Beschreibung des Debitismus ist der Termin, der Menschen durch Sanktionsandrohung dazu zwingt, etwas – beispielsweise eine Ware oder Geld – zum Termin oder innerhalb eines Zeitkorridors an jemanden oder an etwas abzutreten. Im Ursprung ist das der Zwang, Nahrung und Wasser »nachzufragen«, d.h. zu finden bzw. zu produzieren, um diese zum Termin (Hunger/Durst) in den Magen überzuführen, um der Sanktion (Verhungern/Verdursten) zu entgehen. Hier kristallisieren sich drei wesentliche Punkte heraus, die uns später das Wesen des Geldes begreiflich machen: Termin, Leistung und Sanktion. Ein unsterbliches Wesen, das folglich keinen Hunger kennt, würde der Nahrung keinen Wert beimessen. Erst der Zwang, etwas zum Termin haben zu müssen, die Urschuld bedienen zu müssen, verleiht der Nahrung ihren Wert. Dasselbe gilt für Geld, gleichgültig in welcher Form es erscheint (Papier, Edelmetall, normierte Bambusstäbe). Es entsteht in einem Akt der Verschuldung und muss zum Fälligkeitstermin an den Emittenten zurückkehren.
Auch ohne den Zwang, Leistung erbringen zu müssen, wäre Nahrung für uns kein kostbares Gut. Würden wir nämlich im Schlaraffenland leben, wo uns die gebratenen Tauben in den Mund fliegen und Nahrung immer und überall allgegenwärtig wäre, dann wäre sie wertlos und die Nahrungsaufnahme würde zu einem automatisierten Akt verkommen. Dasselbe gilt für Geld. Es ist grundsätzlich unmöglich, Geld »gerecht« zu verteilen, weil an jedem Geldschein immer ein Schuldner hängt, der Waren und Dienstleistungen in Höhe des Marktwerts des Geldscheins zu erwirtschaften hat. Wer also Geld in Form von gesetzlichem Zahlungsmittel oder Giralgeld besitzt, der besitzt auch automatisch einen Schuldknecht, der ihm, qua staatlicher Gewalt, durch seine in Zukunft zu erbringende Leistung den Geldwert garantiert. Hätten alle Geld und niemand Schulden in gleicher Höhe, würden auch keine Überschüsse in Form von Waren und Dienstleistungen im Gegenwert dieses Geldes erwirtschaftet werden – das Geld wäre wertlos.
Der dritte Punkt ist die Sanktion: Ohne Qual und Tod als Damoklesschwert gäbe es keinen Grund, seine Urschuld zu bedienen und ohne staatliche Sanktionen (Bankrott, Haft, Schuldknechtschaft, Todesstrafe) gäbe es keinen Grund, Steuerschulden zu bezahlen oder Kredite zu bedienen, die dem Geld bzw. den Guthaben erst ihren Wert und ihre Kaufkraft bescheren.
Abschließen möchte ich dieses Kapitel mit ein paar Worten Martins zur Bedienung der Urschuld im Kapitalismus, auf deren Bedeutung wir später noch einmal im Detail zurückkommen: »Die Schuld des Arbeiters ist die allgemeine menschliche Urschuld ›sich selbst gegenüber‹, ist die Verpflichtung, sich ›erhalten‹ zu müssen. Von dieser Schuld kommt der Arbeiter nur mit Hilfe des Einsatzes von Arbeit herunter: Er ist also in der Tat, wie Carl Hirsch an Engels geschrieben hat, ›das Kapital des Arbeiters‹. Der Arbeiter kommt von seiner (Ur-)Schuld nur herunter, wenn er jemanden findet, der sich seinerseits verschuldet, zum Beispiel einen Kapitalisten, der Schulden macht, um den Arbeiter zu beschäftigen, ihm also die Lebenserhaltungskosten ›vorschießt‹. Der Kapitalist hat nicht nur die menschliche Urschuld, sondern auch noch einen Haufen anderer Schulden, die er seinerseits nur gemacht hat, um von seiner Urschuld herunterzukommen. Das ist das berühmte ›Ich will es ein für allemal ‚geschafft’ und es hinter mir haben‹, was als Motiv für die Übernahme von Produktionsrisiken immer wieder genannt wird.«
Bevor wir Martins Modell vertiefen können, müssen wir einen Exkurs zu vorstaatlichen Gemeinschaften und schließlich zur Entstehung des Staates machen.
Stammesgemeinschaft und Staat
Der Krieg ist der Vater aller Dinge.
Heraklit1
Katastrophen sind der zündende Funken für eine totale Umstrukturierung und Erneuerung eines Systems. In der menschlichen Geschichte sorgte der Krieg, so zynisch das auch klingen mag, immer wieder für einen revolutionären Fortschritt, wobei das Wort »Fortschritt« nur in unserem Bewusstsein existiert. Was heute Fortschritt geheißen wird, wird schon morgen bitter bekämpft2 und jenseits der menschlichen Beurteilung gibt es keinen Fortschritt. Es gibt nur Unterschiede (Information) zwischen einem System (These) und dem unberücksichtigten Rest (Antithese), von dem sich das System abgrenzt um überlebensfähig zu sein. Diese Unterschiede lösen sich irgendwann auf (Synthese) und bringen dabei etwas Neues hervor, das sich seinerseits von einem Milieu abgrenzen muss, um zu sein. Je länger ein Unterschied besteht, auf dem neue Unterschiede aufbauen, desto stärker tritt sein zerstörerischer Gegenpart in den Vordergrund, der sich als Ausnahme einnistet und die Unterschiede letztendlich zersetzt. Schöpfung und Zerstörung treten also immer paarweise auf, bzw. ist die Zerstörung der Schöpfung inhärent, ja wird erst von ihr gespeist, da ein erschaffenes System immer unvollständig ist und im Prozess des Unterscheidens, d.h. der Ausdifferenzierung (= Komplexitätszuwachs), letztendlich selbst Störungen im Milieu hervorbringt, auf die es nicht mehr angemessen reagieren kann, ohne die eigene Basis, auf der es aufbaut, in Frage zu stellen. Wir kommen darauf noch oft genug im Detail zu sprechen, doch will ich hierfür zum Verständnis ein paar Beispiele geben: Der unverfälschte Kapitalismus im libertären Sinne beruht auf einer klaren Theorie mit klaren Prämissen, wie ein schlanker Staat als Machtmonopol, der Steuern einhebt, um damit das Eigentumsrecht zu installieren und die Vertragsfreiheit zu wahren. Die Prämissen sind also schlanker Staat, Eigentum und Vertragsfreiheit. Liest man die durchaus plausiblen Theorien diverser liberaler und libertärer Ökonomen vorurteilsfrei, müsste sich dieses System im Gleichgewicht befinden und damit der Weisheit letzter Schluss sein. Startet man jedoch ein solches System, kommt es aber nach einigen Jahrzehnten zu ersten Problemen. Schnell führt das System zur Bewertung des Menschen und damit zu Ausbeutung und Sklaverei. Dann aber muss der Staat zum ersten Mal die Vertragsfreiheit, eine der Hauptannahmen, beschneiden, um die Menschenrechte zu installieren. Hierfür wächst der Staat – bereits sind zwei Prämissen verwässert. Gleichzeitig kommt es zu einem Kampf um das Steuertilgungsmittel, das natürlich seinerseits knapp sein muss, um einen Wert zu haben und damit zum Bewertungsschema für Waren und Dienstleistungen zu werden bzw. um Staatsbedienstete zu bezahlen, die das Eigentumsrecht und die Vertragsfreiheit garantieren. Dieser Kampf führt zu Verschuldungsorgien, die dazu dienen, größere Unternehmen auf die Beine zu stellen, um durch das Anbieten von Waren und Dienstleistungen an das Steuertilgungsmittel (Geld) zu gelangen, das der Kreditnehmer im Verschuldungsakt erzeugt. Damit also der Kapitalist seine Produkte an den Mann bringen kann, muss sich ein anderer verschulden. Es entsteht ein Konkurrenzkampf wie im evolutionären Selektionsprozess der Natur, die sich ihrerseits nie im Gleichgewicht befinden kann, da wir sonst niemals entstanden wären. Letztendlich führen mehrere Faktoren, auf die wir im Folgenden noch detailliert eingehen werden, dazu, dass der Kapitalismus an seinen eigenen Prämissen scheitert. Die Steuer führt zu Geld und Zins, das Eigentumsrecht zu Verschuldungsorgien, um an dieses Geld zu gelangen und die Vertragsfreiheit zu einem gigantischen Raubbau an der Natur. Die Prämissen haben damit ein System erschaffen und erzeugen gleichzeitig im dynamischen Wechselspiel Probleme, die mit diesen Prämissen nicht mehr lösbar sind. Dasselbe gilt natürlich auch für den Kommunismus/Sozialismus. Auch hier sind die Prämissen klar beschrieben und liest man die Bücher kommunistischer/sozialistischer Theoretiker, so scheint das System zu funktionieren. Doch hier fehlen exakt jene Mechanismen, wie die Lösung des Informationsproblems und die Kompensation der menschlichen Schwächen u.a., die nur der Kapitalismus lösen kann und vice versa. Das permanente Ungleichgewicht in einem Staatssystem erfordert letztendlich permanente Eingriffe des Staates, die Komplexität gebären, die immer schwerer zu kontrollieren ist. Und da auch jeder Eingriff seine duale Schattenseite hat, erwachsen die Eingriffe in immer kürzeren Intervallen. Es ist das Streben nach Stabilität bzw. beim menschlichen Individuum nach Zufriedenheit, das natürlich auch dem Staat inhärent ist und das für ständige Eingriffe ins »Milieu« verantwortlich ist. Dadurch wird das Milieu so verändert, dass es auf das System rekursiv zurückwirkt und es so zu weiteren Handlungen zwingt – so lange, bis der kritische Wert erreicht ist und das System an seiner eigenen Komplexität erstickt. Alles was in einem Spannungsfeld der Unterschiede möglich ist, wird verwirklicht bis zur Auflösung der Unterschiede.1 Daher muss der Kapitalismus schließlich sein sozialistisches Pendant assimilieren und endet in quasi-sozialistischen und quasi-feudalistischen Strukturen einer Bananenrepublik, ebenso wie der Sozialismus stets in quasikapitalistischen Strukturen endet, wenn er sein Leben verlängern will. Doch die Synthese aus Kapitalismus und Sozialismus baut ihrerseits auf einer Hauptprämisse auf: dem Staat. Auch Staatssysteme müssen scheitern, wie wir noch sehen werden, denn sie beruhen auf der Unterscheidung zwischen Kultur und Natur. Und auch diese Unterscheidung wird letztendlich eine Synthese finden, die aber ihrerseits wieder unvollständig sein muss. Alles verläuft in Zyklen. Die Historie des menschlichen Individuums ebenso wie die einer Kultur oder die der Menschheit. Sie werden als Kinder geboren, erleben als Erwachsene ihre Blüte und gehen im Alter unter, wenn alles erfahren ist, was es im Rahmen eines Zyklus zu erfahren gibt.
Eine Ideologie sorgt damit immer durch ihre alleinige Existenz für das Aufkommen von oppositionellen Kräften und das Gute, was auch immer das im kulturellen Kontext ist, ist ohne das Böse nicht erfahrbar. Das straft auch alle Zeitgeist-Esoteriker Lügen, die von perfekten Systemen oder perfekten Menschen träumen und sich vom Fehlerhaften und Schlechten abzugrenzen versuchen. Jedes theoretische Konstrukt grenzt sich immer von dem ab, das nicht dazugehören darf, beginnt aber über die Zeit hinweg zu wuchern, zu verwässern und das »nicht-Zugehörige« nach und nach zu assimilieren, was einerseits die Selbstdefinition des Systems zerstört, aber andererseits eine Synthese emergieren kann, die als Basis für Neues fungiert. Ein Teil des Ganzen verlangt über die Zeit hinweg nach dem Rest. Entweder der ideologische Rebell versteht im Alter die Intention der Feindesideologie, integriert sie in seine Psyche und wird weise oder aber er wehrt ihre Argumente zeitlebens fanatisch ab, verkrustet in selbstherrlichem Narzissmus und mutiert zur Karikatur seiner selbst. Die Ideologie selbst jedenfalls hat ein Ablaufdatum - gleichgültig, ob der Rebell ihr Scheitern erlebt oder seine körperliche Systemgrenze schon zuvor dem Tod opfert. Die Ursache ist überall, dass ein System aus einer axiomatischen Basis besteht und diese Axiome oder Prämissen scheiden das System von der Ganzheit ab, d.h. lassen notwendigerweise den anderen Teil unberücksichtigt und diese Unterschiede werden über die Zeit hinweg abgebaut, so wie Energiegefälle sich abbauen, kommunizierende Gefäße ihren Flüssigkeitspegel angleichen, ein System dem thermodynamischen Gleichgewicht entgegenstrebt bzw. die Entropie ihrem Maximum.
Axiome, Prämissen bzw. die Fundamente, auf denen Systeme aufbauen, nähren und erschaffen diese erst und sind gleichzeitig die Ursache ihrer Zerstörung. Dieses »Problem« ist allerdings keines, das man in neu-esoterischer Manier lösen könnte, wie uns das die Verfechter verschiedenster Pseudoganzheitslehren und Paradiesverheißungen weismachen wollen. Dieses »Problem« ist vielmehr überhaupt die Ursache für unsere Existenz, die Existenz des Universums und die Existenz alles Existierenden im Allgemeinen. Nur dieses Ungleichgewicht erzeugt die Dynamik des Seins und damit Schöpfung und Zersetzung der Dinge – den ewigen Wandel. Die Unvollständigkeit treibt alles an, weil alles nach Vollständigkeit sucht und diese doch nie erreicht. Der Drang nach Vollständigkeit und dauerhafter Stabilität sorgt erst für die ständige Reaktion eines Systems und damit für neue Unterscheidungsoperationen und neue Kreationen. Der Drang des Menschen die Welt vollständig zu entschlüsseln, gebiert erst die Ausdifferenzierung der Welt im menschlichen Bewusstsein und die Analyse der Einzelteile wirft ihrerseits neue Fragen bzgl. des Zusammenspiels auf und muss diese auch bis in alle Ewigkeit aufwerfen, wie an späterer Stelle noch zu erläutern sein wird. Ein System, wie der Mensch, kann als Teil des Ganzen eben immer nur Teile des Ganzen begreifen und wie wir noch sehen werden, ist diese selektive Blindheit überhaupt erst die »Ur-Sache« für den Akt des Beobachtens und die Erzeugung von Wissen, denn wer alle Farben des Regenbogens sieht, der sieht nur weiß und wer allwissend ist, der weiß gar nichts. Wissen definiert sich überhaupt erst durch die Unvollständigkeit – die Ausdifferenzierung des Ganzen durch Beobachtung bei gleichzeitiger Abtrennung des Unbeobachteten, ja bereits die Wissenschaft, die »Wissen schafft«, beruht auf den Prämissen der Beobachtbarkeit und Reproduzierbarkeit und muss sich deshalb zwangsläufig von all dem abgrenzen, das nicht beobachtbar und nicht reproduzierbar ist. Die Wissenschaft beschreibt also die »Wirk-lichkeit«, d.h. alles, das auf das System Mensch (über seine Sinnesorgane) und seine Messgeräte »wirkt« und konstruiert auf Basis dieser Daten ein Modell der »Wirk-lichkeit«, das mit der Vorstellungskraft, den kognitiven Fähigkeiten und den kulturspezifischen Glaubenssätzen eines knapp 1400 Gramm schweren Gehirns eines Homo sapiens sapiens kompatibel ist. Die Beschreibung der »Wirk-lichkeit« hat also nichts mit der Realität zu tun – was auch immer man unter Letzterer verstehen mag. Ebenso werden wir im Laufe des Buches begreifen lernen, warum eine Weltformel ein Widerspruch in sich ist bzw. warum sie, die ihrerseits auf Axiomen beruhen muss, auch deshalb immer unvollständig bleibt, ja beim Einsetzen bestimmter Werte auch Ergebnisse hervorbringen muss, die durch die Formel nicht mehr erklärbar sind bzw. den Rahmen dessen sprengen, was die Formel zu erklären im Stande ist – auch wenn das in der Anfangseuphorie vermeintlich »Alles« ist.
Diese Ausnahme ist jedem System immanent, und diese Ausnahme, die dem nicht berücksichtigten bzw. nicht beobachteten Teil entspricht, bestätigt nicht nur die Regel, d.h. erhält im dynamischen Wechselspiel mit dem Rest das System, sondern zerstört sie auch am Ende. Ein physikalisches oder biologisches System erhält damit, ebenso wie ein ideologisches, seine Existenz durch den nicht vollständig »beobachteten« Rest, auf den es ständig reagiert – ein physikalisches System durch Wechselwirkung, ein biologisches durch Anpassung, eine ideologische oder physikalische Theorie durch Erweiterung der Axiome. Es saugt dabei ständig Informationen auf (es differenziert aus) und geht letztendlich an seiner eigenen Komplexität zugrunde, v.a. weil es immer auf einer Basis aufbauen muss, die über die Zeit hinweg ständig starrer und unflexibler wird. Das ist ein irreversibler Prozess, der das System ständig dazu zwingt, neue innere Hierarchien zu errichten, welche die Komplexität verwalten, was die Instabilität weiter beschleunigt.
Die »Höherentwicklung« eines Systems innerhalb eines dabei immer notwendigen Energiegefälles bedeutet nichts anderes als den Export von Komplexität durch Subsysteme auf Kosten der Komplexitätserhöhung des Gesamtsystems. So lagern Unternehmen im Kapitalismus immer mehr Aufgaben aus, um den Preis eines hochkomplexen, hochnvernetzten und deshalb hochgradig störanfälligen Wirtschaftssystems, von dem sie immer abhängiger werden. Einzeller differenzieren zu hochkomplexen Vielzellern mit spezialisierten Zellen aus und sind hernach alleine - unabhängig vom Zellverband, von dem sie ein Teil sind - nicht mehr lebensfähig. Diese Ausdifferenzierung eines Systems geht stets mit einer Einschränkung der Freiheitsgrade der Subsysteme, mit Fragilität, geringerer Resilienz und damit einer Zunahme des Zerstörungspotentials einher. Der menschliche Körper als komplexes Produkt der Evolution ist folglich nicht einmal ansatzweise so resistent und stark gegenüber Umwelteinflüssen wie der einer Kakerlake. Genau deshalb (!) musste er ein Selbstbewusstsein entwickeln, um überhaupt überleben zu können. Auch reduziert sich das Leben einer Kakerlake auf fressen, atmen und fortpflanzen, während die vom Menschen erschaffenen gesellschaftlichen und ökonomischen Systeme, die er sich zur Organisation seiner Art schuf, ihn mit einem immensen Spektrum an Problemen konfrontieren. Permanent muss er ins Gesamtgefüge eingreifen und dieses verändern, um sich der Zufriedenheit anzunähern – kann diese aber nie erreichen. Stattdessen wachsen mit seiner Reaktion auf seine Umwelt die Komplexität der von ihm erschaffenen Systeme und damit das Potential an Destruktivität. Es gibt keinen Fortschritt ohne ein Rückschlagspotential in gleicher Höhe, so wie es kein Guthaben ohne Kredit gibt und keine Schöpfung ohne Zerstörung. Das ist die Bilanz des Seins (dessen Passiva das Nichts ist).
Heute ist der Mensch durch Hygienemaßnahmen, medizinischen Fortschritt und allerlei Impfungen/Medikamente so weit, sein Leben signifikant zu verlängern. Die dualistische und zerstörerische Kehrseite der Medaille ist aber, dass sein Immunsystem damit schwächer und anfälliger wird. Trotz bzw. aufgrund des hohen medizinischen Niveaus explodieren Zivilisationskrankheiten geradezu. Deshalb hat auch die soziale Ader des Menschen im Massenkollektiv ihre dualen Schattenseiten, denn sie hebelt den evolutionären Selektionsdruck aus, durch Gewährleistung der Weitergabe schlechten genetischen Materials (Erbkrankheiten), das im gnadenlosen Wettkampf der Natur untergehen würde, in der Zivilgesellschaft dagegen zu einer negativen Auslese führt: Krankheiten werden durch Pillen unterdrückt, sozial Schwache und Behinderte werden von der Allgemeinheit unterstützt und tragen ihr genetisches Material weiter. Der evolutionäre Selektionsdruck wirkt aufgrund des wachen Bewusstseins des Homo sapiens sapiens nicht mehr und der Mensch befindet sich stets in einer defensiven Verteidigungshaltung gegenüber neuen Krankheitserregern, sodass er gute Chancen hat, durch die kleinsten und resistentesten Wesen dieses Planeten – pathogene Mikroorganismen – eines Tages ausgelöscht zu werden. Der Sozialdarwinismus, auf der anderen Seite der Bilanz, konterkariert alle Charaktereigenschaften durch die wir uns als Mensch definieren und führt in letzter Konsequenz stets zu Euthanasie, Zwangssterilisation, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und am Ende zur Errichtung von Konzentrationslagern. Es gibt schlichtweg keinen Vorteil ohne Nachteil und damit auch niemals ein funktionierendes System. Es ist auch kein Zufall, dass unsere Naturgesetze nicht nur etwas so stabiles wie Materie hervorbringen, sondern im Zeitablauf auch ein zerstörerisches duales Pendant, wie etwa schwarze Löcher. Diese schwarzen Löcher gab es zuvor noch nicht1 und es ist wahrscheinlich, dass sie in ihrem Inneren sogar unsere bekannten Naturgesetze zerstören. Kann eine Weltformel auf Basis von Naturgesetzen etwas voraussagen, das sich mit diesen Naturgesetzen nicht mehr erklären lässt, weil diese im Inneren eines schwarzen Lochs versagen? Lässt sich die gesamte Realität grundsätzlich auf eine Formel reduzieren oder führt sich auch jede Formel (wenn ihre Grenzen ausgereizt werden), wie auch jedes andere System, aufgrund ihrer axiomatischen Basis irgendwann ad absurdum bzw. erscheint in endlosen Ebenen nur als Spezialfall eines übergeordneten Modells? Können Naturkonstanten überhaupt konstant sein? Und wie soll unser Universum entstehen, wenn nicht ständig neue Dinge emergieren, indem sie – esoterisch gesprochen – aus der Leere als Möglichkeitsraum und Summe allen Seins gezogen werden? All diesen Fragen werden wir uns zu gegebener Zeit widmen. Vorerst ist es wichtig zu wissen, dass jeder Zerstörung ein schöpferisches Element und jeder Schöpfung ein zerstörerisches Element innewohnt. So wie Gott (die Leere als Summe allen Seins) sich selbst zerstören muss, um die Welt zu erschaffen, entstehen Materie und Antimaterie aus einem »zerstörten« Photon oder annihilieren wieder zu Photonen (bzw. je nach Bewegungsenergie zu Myonen oder Mesonen) und ebenso entsteht auch ein Staat aus der Zerstörung einer solidarischen Stammesgemeinschaft, die sich aufspaltet in Macht und Ohnmacht. Gleichermaßen wichtig ist das fortwährende Ungleichgewicht, dem jedes System ausgesetzt ist und das sich im Zeitablauf vergrößert (die Komplexität bietet immer mehr Angriffspunkte für Störungen).1 Zusammenfassend lässt sich wiederholen: Dem »Fortschritt« steht immer ein gleich großes »Rückschritts«-Potential2 gegenüber. Wo der Grad an Komplexität steigt, steigt auch der Grad an Fragilität und Inflexibilität.
Beispiele dafür sind der Zusammenbruch von Kapitalismus, Sozialismus, einer ganzen Kultur oder das plötzlich auftretende Massensterben in der Evolution. Da der Zerstörung die Schöpfung als dualer Gegenspieler beisteht, ist jede Katastrophe auch gleichzeitig schöpferische Zerstörung. Der Zusammenbruch eines Wirtschaftssystems bringt ein neues in irrsinniger Geschwindigkeit hervor (oder am Ende eines Kulturzyklus die Zersetzung einer alten Kultur bei baldigem Aufstreben einer neuen). Dem Massensterben in der Evolution folgt eine regelrechte Explosion der Artenvielfalt. Der wichtigste technologische Fortschritt wäre ohne Krieg undenkbar3, und dem totalen Krieg folgen Phasen irrsinniger wirtschaftlicher Prosperität. Auch die Entstehung des Staates (Machtzyklus) brachte eine regelrechte Explosion des menschlichen »Fortschritts«1, sowohl in materieller Hinsicht wie in der Entwicklung des Bewusstseins. Gewalt ist also, um es in den Worten von Goethes Mephistopheles zu sagen, ein Teil jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft, oder um aus Wolfgang Sofskys Traktat über die Gewalt zu zitieren: »Gewalt erschafft Kultur und Kultur erschafft Gewalt« - bzw. Kultur organisiert, institutionalisiert und potenziert die naturhaft-impulsive Gewalt und damit den »Fortschritt«. Kultur wird erst mit dem Staat, bzw. dem Patriarchat als Vorläufer, erschaffen und der Staat entsteht aus einem Gewaltakt und nicht, wie man gemeinhin annimmt, durch Konsens, d.h. aus einem freiwilligen Zusammenschluss von Menschen für Menschen. Tatsächlich entstanden Staaten an keinem Ort der Welt durch eine freiwillige Vereinbarung, sondern stets durch Unterwerfung eines Stammes oder Volkes durch einen anderen Stamm bzw. ein anderes Volk. Ich erlaube mir, hier aus Franz Oppenheimers Der Staat zu zitieren:
»Er ist seiner Entstehung nach ganz und seinem Wesen nach auf seinen ersten Daseinsstufen fast ganz eine gesellschaftliche Einrichtung, die von einer siegreichen Menschengruppe einer besiegten Menschengruppe aufgezwungen wurde mit dem einzigen Zwecke, die Herrschaft der ersten über die letzte zu regeln und gegen innere Aufstände und äußere Angriffe zu sichern. Und die Herrschaft hatte keinerlei andere Endabsicht als die ökonomische Ausbeutung der Besiegten durch die Sieger. Kein primitiver ›Staat‹ der Weltgeschichte ist anders entstanden; wo eine vertrauenswerte Überlieferung anders berichtet, handelt es sich lediglich um Verschmelzung zweier bereits vollentwickelter primitiver Staaten zu einem Wesen verwickelterer Organisation; oder es handelt sich allenfalls um eine menschliche Variante der Fabel von den Schafen, die sich den Bären zum Könige setzten, damit er sie vor dem Wolfe schütze; aber auch in diesem Falle wurden Form und Inhalt des Staates völlig dieselben wie in den ›Wolfsstaaten‹ reiner, unmittelbarer Bildung. Schon das bißchen Geschichtsunterricht, das unserer Jugend zuteil wurde, reicht hin, um diese generelle Behauptung zu erweisen. Überall bricht ein kriegerischer Wildstamm über die Grenzen eines weniger kriegerischen Volkes, setzt sich als Adel fest und gründet seinen Staat. Im Zweistromlande Welle auf Welle und Staat auf Staat: Babylonier, Amoriter, Assyrer, Araber, Meder, Perser, Makedonier, Parther, Mongolen, Seldschucken, Tataren, Türken; am Nil Hyksos, Nubier, Perser, Griechen, Römer, Araber, Türken; in Hellas die Dorierstaaten, typischen Gepräges; in Italien Römer, Ostgoten, Langobarden, Franken, Normannen, Deutsche; in Spanien Karthager, Römer, Westgoten, Araber; in Gallien Römer, Franken, Burgunder; in Britannien Sachsen, Normannen. Welle auf Welle kriegerischer Wildstämme auch über Indien bis hinab nach Insulindien, auch über China ergossen; und in den europäischen Kolonien überall der gleiche Typus, wo nur ein seßhaftes Bevölkerungselement
Natur war. Auch die Ursache des rasanten Fortschritts bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz lässt sich ohne die Laboratorien des Pentagons nicht begreifen.
vorgefunden wurde: in Südamerika, in Mexiko. Wo es aber fehlt, wo nur schweifende Jäger angetroffen werden, die man wohl vernichten, aber nicht unterwerfen kann, da hilft man sich, indem man die auszubeutende, fronpflichtige Menschenmasse von fern her importiert: Sklavenhandel!« Ein Staat entstand also immer durch kriegerische Handlungen, im Zuge derer eine Menschengruppe durch eine andere Menschengruppe zum Zwecke der ökonomischen Ausbeutung unterworfen wurde.
Zuerst unterscheidet Oppenheimer zwischen Bauernstämmen, Jägerstämmen und Hirtenstämmen. Er bezeichnet die Jägerstämme als »praktische Anarchisten«, die sich nicht unterwerfen lassen (weil nicht sesshaft), während sich bei Hirtenstämmen der Hang zum Raubzug aus soziologischer Sicht am stärksten entwickelt (Vernichtung der Viehbestände durch Seuchen und Raubtiere). Daneben gibt es noch Bauernstämme, denen jegliche Kriegs- und Eroberungslust fehlt, v.a. weil sie sesshaft und an ihre Felder gebunden sind und nicht mehr brauchen, als sie ohnehin anbauen (Subsistenzproduktion). Den Jägern und Bauern ist gemeinsam, dass sie in familiären Solidargesellschaften produzieren1 und es keine Obrigkeit gibt, die durch ein Macht-, Zwang- oder Abgabensystem ihre Untertanen knechtet. Wohl gibt es manchmal einen Häuptling, doch dessen Autorität ist eine konsensuale; niemand ist ihm zu Gehorsam verpflichtet. Der Häuptling hat »kein Mittel, um seine Wünsche gegen den Willen der übrigen durchzusetzen« (Ernst Grosse, Die Formen der Familie und die Formen der Wirtschaft). Uwe Wesel beschreibt diese »geordnete Anarchie« von Jägerstämmen in seinem Buch Der Mythos vom Matriarchat exemplarisch anhand des noch heute in Nordamerika existierenden Irokesen-Stammes:
»Es gab keine Zentralinstanz, nur solche Gruppen mit ihren Ältesten. […] Es gibt keinen Häuptling, der an der Spitze des Stammes steht. Der Stamm besteht aus dem selbstständigen und autonomen Nebeneinander von einlinigen Abstammungsgruppen. Die social anthropology nennt sie lineages. Auch innerhalb der Gens2 gibt es keine Hierarchie, wohl aber einen Sprecher, den Sachem, der bei den Irokesen von allen Mitgliedern, Männern wie Frauen, wie Morgan sagt, gemeinsam bestimmt wird und jederzeit wieder abberufen werden kann. Der Sachem hat innerhalb dieses Verwandtschaftskollektivs keine Befehlsgewalt, sondern nur Sprecher- und Vermittlerfunktion. Er vertritt die lineage auch nach außen, ist Mitglied des Stammesrates.«
Nach Oppenheimer entsteht also ein Staat, wenn Nomaden, allen voran Hirtenstämme, einen Bauernstamm überfallen, ihn ausrauben und schließlich zur dauerhaften Abgabenleistung (= Steuer) zwingen. Oppenheimer schreibt dazu: »[D]er Bauer weicht nicht aus [im Gegensatz zum Jäger, Anm. d. Autors], denn er ist bodenständig; und der Bauer ist an regelmäßige Arbeit schon gewöhnt. Er bleibt, lässt sich unterwerfen und steuert seinem Besieger: das ist die Entstehung des Landstaates in der Alten Welt!«
Um sein eigenes Überleben zu sichern, bietet der werdende Staat an, im Gegenzug alle anderen Räuber fernzuhalten (Militär). Man sieht also, dass der Staat (zuerst) im Grunde nichts anderes ist, als eine besonders perfide Form der Ausbeutung, die sich alsbald anstatt des ökonomischen Mittels des politischen Mittels bedient. Hier unterscheidet Oppenheimer grob sechs Stadien:
»Das erste Stadium ist Raub und Mord im Grenzkriege: ohne Ende tobt der Kampf, der keinen Frieden noch Waffenstillstand kennt. […] Das ist das erste Stadium der Staatsbildung. Sie kann jahrhunderte-, vielleicht jahrtausendelang darauf stehen bleiben […] Allmählich entsteht aus diesem ersten Stadium das zweite, namentlich dann, wenn der Bauer, durch tausend Mißerfolge gekirrt, sich in sein Schicksal ergeben, auf jeden Widerstand verzichtet hat. Dann beginnt es selbst dem wilden Hirten aufzudämmern, daß ein totgeschlagener Bauer nicht mehr pflügen, ein abgehackter Fruchtbaum nicht mehr tragen kann. Er läßt im eigenen Interesse den Bauern leben und den Baum stehen, wenn es möglich ist. […] Das heißt, er läßt ihm Haus, Geräte und ausreichend Lebensmittel bis zur nächsten Ernte. Ein Vergleich: der Hirte im ersten Stadium ist der Bär, der den Bienenstock zerstört, indem er ihn ausraubt; im zweiten ist er der Imker, der ihm genug Honig läßt, um zu überwintern. […] Der Bauer erhält eine Art von Recht auf die Lebensnotdurft; es wird ein Unrecht, den nicht Widerstehenden zu töten oder ganz auszuplündern. Und besser als das! Feinere, zartere Fäden knüpfen sich zu einem noch sehr schwachen Netze, menschlichere Beziehungen, als sie der brutale Gewohnheitspakt der Teilung nach dem Muster der partitio leonina enthält. Da die Hirten nicht mehr im Kampfzorn rasend mit den Bauern zusammentreffen, so findet auch wohl einmal eine demütige Bitte Erfüllung, oder eine begründete Beschwerde Gehör.«
Oppenheimer schreibt zu diesen zwei Stadien zusammenfassend:
eine Urmutter zurückführen. Dieses Kollektiv bezeichnet Morgan als Gens und einen Stamm, der aus dem Nebeneinander mehrerer Gentes bestand, als Gentilgesellschaft. Die Irokesenvölker sind darüber hinaus ein noch heute existierendes Beispiel für einen matrilinearen (Mutterfolge) und matrilokalen (das Paar lebt am Wohnsitz der Familie der Frau) Stamm. Zwei Ausdrücke, auf die wir im Subkapitel »Der Phoenix« noch im Detail zu sprechen kommen, wenn wir die Menschheitsgeschichte neu aufrollen.
»Volkstum und Staat, Recht und höhere Wirtschaft, mit allen Entwicklungen und Verzweigungen, die sie schon getrieben haben und noch treiben werden, entstanden gemeinsam in jenem Moment unvergleichlicher weltgeschichtlicher Bedeutung, in dem zuerst der Sieger den Besiegten schonte, um ihn dauernd zu bewirtschaften.«
Die Wichtigkeit dieser Tatsache wird später immer wieder hervorblitzen, wenn es darum geht die Notwendigkeit der geschichtlichen Entwicklung zu verstehen: Der Staat arbeitet ökonomisch! Er versucht, die maximale Abgabe aus seinen Untertanen herauszuholen, gleichzeitig aber nur so viel, um sie ruhig zu halten und Aufstände zu vermeiden. In modernen Staatssystemen stößt diese Ausbeutung (die notwendigerweise wachsen muss, wie später zu beweisen ist) irgendwann an ihre Grenzen, welche die sogenannte »Laffer-Kurve« vorgibt:
»Wird der Steuersatz, ausgehend von einem Satz von null, sukzessive erhöht, so steigen auch die Steuereinnahmen, allerdings nur bis zu einem bestimmten Punkt, an dem die Besteuerten ausweichen. Wird der Steuersatz über diesen Punkt hinaus weiter erhöht, dann nehmen die Steuereinnahmen wieder ab; dieses Phänomen entsteht, weil höhere Steuersätze auch den Steuerwiderstand erhöhen.«1
Dieses Gesetz der Laffer-Kurve ist besonders im Endstadium einer Hochzivilisation, die geprägt ist durch exorbitante Steuern, einer der Katalysatoren für deren Rückabwicklung. Doch vom zweiten Stadium in Oppenheimers Staatstheorie bis zur Ausbildung einer fertigen Kultur ist es noch ein weiter Weg. Oppenheimer fährt fort:
»[…] Bald kommt ein anderes hinzu, um jene seelischen Beziehungen noch enger zu knüpfen. Es gibt in der Wüste außer dem jetzt in den Bienenvater umgewandelten Bären noch andere Petze, die auch nach Honig lüstern sind. Unser Hirtenstamm sperrt ihnen die Wildbahn, er schützt »seinen« Stock mit der Waffe. Die Bauern gewöhnen sich, die Hirten herbeizurufen, wenn ihnen eine Gefahr droht; schon erscheinen sie nicht mehr als die Räuber und Mörder, sondern als die Schützer und Retter.
[…] Das dritte Stadium besteht darin, daß der »Überschuß« der Bauernschaften von ihnen selbst regelmäßig als »Tribut« in das Zeltlager der Hirten abgeliefert wird, eine Regelung, die augenscheinlich für beide Teile bedeutende Vorteile hat. Für die Bauern, weil die kleinen Unregelmäßigkeiten, die mit der bisherigen Form der Besteuerung verbunden waren: ein paar erschlagene Männer, vergewaltigte Frauen und niedergebrannte Gehöfte, nun ganz fortfallen; für die Hirten, weil sie, um sich ganz kaufmännisch auszudrücken, für dieses »Geschäft« keine »Spesen« und Arbeit mehr aufzuwenden haben und die freigewordene Zeit und Kraft auf »Erweiterung des Betriebes« verwenden, d.h. mit anderen Worten, neue Bauernschaften unterwerfen können.
[…] Das vierte Stadium bedeutet wieder einen sehr wichtigen Schritt vorwärts, weil es die entscheidende Bedingung für das Zustandekommen des »Staates« in seiner uns geläufigen äußeren Form hinzubringt: die räumliche Vereinigung der beiden ethnischen Gruppen auf einem Gebiete […] Im allgemeinen reichen aber schon innere Gründe hin, um die Hirten zu veranlassen, die Nachbarschaft der Bauern zu suchen. Die Schutzpflicht gegen die »Bären« zwingt sie, mindestens ein Aufgebot junger Krieger in der Nähe des Stockes zu halten, und das ist gleichzeitig eine gute Vorsichtsmaßregel, um die Bienen von Aufruhrgelüsten oder einer etwaigen Neigung zurückzuhalten, einen anderen Bären als Bienenvater über sich zu setzen. Denn auch das ist nicht selten. […] Aber von diesem vierten führt die Logik der Dinge schnell zum fünften Stadium, das nun schon fast der volle Staat ist. Streitigkeiten entstehen zwischen benachbarten Dörfern oder Gauen, deren gewaltsamen Austrag die Herrengruppe nicht dulden kann, da dadurch die »Prästationsfähigkeit« der Bauern leiden müßte; sie wirft sich zum Schiedsrichter auf und erzwingt im Notfall ihren Spruch.«
Hier entstehen also allmählich das Rechtswesen und die herrschende Macht als Instanz der Vertragsverbindlichkeit. Auch das ist später für das Verständnis des Debitismus unerlässlich.
Wie sieht also das sechste und letzte Stadium aus? Oppenheimer dazu:
»Die Notwendigkeit, die Unterworfenen in Raison und bei voller Leistungsfähigkeit zu erhalten, führt Schritt für Schritt vom fünften zum sechsten Stadium, nämlich zur Ausbildung des Staates in jedem Sinne, zur vollen Intranationalität und zur Entwicklung der »Nationalität«. Immer häufiger wird der Zwang, einzugreifen, zu schlichten, zu strafen, zu erzwingen; die Gewohnheit des Herrschens und die Gebräuche der Herrschaft bilden sich aus. Die beiden Gruppen, erst räumlich getrennt, dann auf einem Gebiete vereint, aber noch immer nur erst nebeneinandergelegt, dann durcheinandergeschüttelt, eine mechanische »Mischung« im Sinne der Chemie, werden mehr und mehr zu einer »chemischen Verbindung«. Sie durchdringen sich, mischen sich, verschmelzen in Brauch und Sitte, Sprache und Gottesdienst zu einer Einheit, und schon spannen sich auch Fäden der Blutsverwandtschaft von der Ober- zur Unterschicht. Denn überall wählt sich das Herrenvolk die schönsten Jungfrauen der Unterworfenen zu Kebsen, und ein Stamm von Bastarden wächst empor, bald der Herrenschicht eingeordnet, bald verworfen und dann kraft des in ihren Adern rollenden Herrenblutes die geborenen Führer der Beherrschten. Der primitive Staat ist fertig, Form und Inhalt.«
Wir begreifen nun, wie ein Staat entsteht und lassen Friedrich Nietzsche wertend sprechen: »Staat heißt das kälteste aller kalten Ungeheuer. Kalt lügt es auch; und diese Lüge kriecht aus seinem Munde: ›Ich, der Staat, bin das Volk.‹«1
Zwar lässt sich die Geschichte des Staates mit Sicherheit auf Nietzsches Worte herunterbrechen, doch wird bald ersichtlich, dass sich die Entstehung des Staates aus der Bedienung der Urschuld ableiten lässt (die sich fraktal auf eine ökonomische Ebene spiegelt). Auf metaphysischer Ebene erschuf bereits die erste Selbstreflektion im Garten Eden eine Kette chaotischer Zyklen, welche den Keim zur Staatenentstehung legte. Wir befruchteten uns mit dem Staat, um uns selbst zu begreifen und zu erfahren. Lassen wir abschließend nochmals Oppenheimer mit einer erhellenden Analogie sprechen:
»[…] Schon Paul v. Lilienfeld, einer der Hauptverfechter der Anschauung, daß die Gesellschaft ein Organismus höherer Art ist, hat darauf hingewiesen, daß hier eine besonders schlagende Parallele zwischen dem eigentlichen und uneigentlichen Organismus gegeben ist. Alle höheren Wesen pflanzen sich geschlechtlich fort, die niederen ungeschlechtlich, durch Teilung, Knospung, allenfalls Kopulation. Nun, und der einfachen Teilung entspricht genau das Wachstum und die Fortpflanzung der vorstaatlichen Blutsgenossenschaft; sie wächst, bis sie für den Zusammenhalt zu groß wird, schnürt sich ab, teilt sich1, und die einzelnen Horden bleiben allenfalls in einem sehr losen Zusammenhang, ohne irgendwie straffere Gliederung. Der Kopulation ist die Verschmelzung exogamischer Gruppen vergleichbar.
Der Staat aber entsteht durch geschlechtliche Fortpflanzung [Hervorhebung des Autors].
Alle zwiegeschlechtliche Fortpflanzung vollzieht sich so, daß das männliche Prinzip, eine kleine, sehr aktive, bewegliche Schwärmzelle (das Spermatozoid) eine große, träge, der Eigenbewegung entbehrende Zelle (das Ovulum), das weibliche Prinzip, aufsucht, in sie eindringt und mit ihr verschmilzt, worauf ein Prozeß gewaltigen Wachstums, d.h. wundervoller Differenzierung mit gleichzeitiger Integrierung, sich vollzieht. Die träge, schollengefesselte Bauernschaft ist das Eichen, der bewegliche Hirtenstamm das Spermatozoid dieses soziologischen Befruchtungsaktes, und sein Ergebnis ist die Reifung eines höheren, in seinen Organen viel reicher gegliederten und viel kräftiger zusammengefaßten (integrierten) sozialen Organismus. Wer weitere Parallelen sucht, kann sie leicht finden. Die Art, wie unzählige Spermatozoide das Ovulum umschwärmen, bis endlich eines, das stärkste oder glücklichste, die Mikropyle entdeckt und erobert, ist den Grenzfehden, die der Staatsbildung vorangehen, wohl vergleichbar, und ebenso die fast magische Anziehungskraft, die das Ovulum auf die Schwärmzellen ausübt, dem Zuge der Steppensöhne in die Ebenen.« Oppenheimer vergleicht also die Staatsentstehung mit der Befruchtung was ausgezeichnet ins Bild unserer fraktalen Spiritualität passt. So wie niedere Wesen sich durch Teilung fortpflanzen (wächst der Stamm, so teilt er sich), pflanzen sich höhere Wesen durch Eroberung und Geschlechtsverkehr fort. In Analogie dazu ist der physisch schwächere Stamm das Weibchen (sesshaft, passiv und solidarisch) und der physisch stärkere Stamm das Männchen (forschend, erobernd und egozentrisch). Wie wir in Martins Ausführungen noch sehen werden, kommt es durch diese Befruchtung durch einen Hirtenstamm von einer solidargemeinschaftlichen Produktion zu arbeitsteiliger Wirtschaft, d.h. so wie aus Spermium und Eizelle durch Zelldifferenzierung ein Kind heranwächst, so sorgt die schiere Existenz eines Staates für ein Auseinanderbrechen der egalitären Solidargemeinschaft in hierarchisch strukturierte, spezialisierte »Zellen«, also Berufe, Stände und Klassen.1 Hinter dieser Dynamik steckt, wie im nächsten Kapitel zu zeigen sein wird, der unbändige Schuldendruck (auf allen Ebenen), der letztendlich dafür sorgt, dass ich heute hier ein Buch auf meinem Laptop verfassen und mir Informationen aus dem Internet besorgen kann. All das basiert zwangsläufig und notwendigerweise auf dem Urgrund allen Seins: dem Willen, sich selbst in all seiner Herrlichkeit zu erfahren und alle daraus resultierenden Fraktale. Der Selektionsdruck der Natur bringt den sich selbst erkennenden Menschen hervor, das Erkennen der Urschuld mündet im Staat, der dann seinerseits als befruchtender, kultureller Turbo für die geistige Evolution des Menschen fungiert. »Innerhalb« der ruhenden, weiblichen, ganzheitlichen Leere waltet das dynamische, männliche, dissoziierende Sein, das sich seinerseits wiederum in den ruhenden, weiblichen, ausgedehnten Raum und die dynamische, männliche, komprimierte Materie (Zeit) teilt. Die Materie wiederum zerfällt in das dunkle, weibliche, anorganische Tote und das helle, männliche, organische Lebende (so wie die Zeit in die zyklisch-weibliche Vergangenheit und die linear-männliche Zukunft zerfällt). Das (menschliche) Leben wiederum teilt sich in die unbewusste, weibliche, triebhafte Natur (Stamm) und die bewusste, männliche, vergeistigte Kultur (Staat). Im kulturellen Zyklus wachsen dann aus der feudalen Einheit kollektivistische, weibliche, egalitäre Strömungen (Sozialismus) und individualistische, männliche, elitäre Machtstrukturen (Kapitalismus).2
Es dreht sich immer alles um die gegengeschlechtlichen Dichotomien »Einheit/Vielheit«, »Verbindung/Trennung« oder »Stillstand/Dynamik«, letztendlich also immer um die Allegorie vom Garten Eden – Paradies oder Sündenfall – und dies gilt für alles Existente auf allen Ebenen. Leben wir im Prinzip »Einheit/Verbindung/Stillstand«, so leben wir im Paradies, doch es mangelt uns an Erfahrung. Leben wir im Prinzip »Vielheit/Trennung/Dynamik«, so genießen wir den Fortschritt und alle geistigen und technologischen Errungenschaften, doch wir leben dann ebenso in einer Welt mit Krisen und Kriegen. Ist Gott die Leere, dann hat er sich noch nicht durch einen Beobachtungsakt selbst gespalten, existiert dementsprechend nicht und hat deshalb einen Mangel an »Sein« und die damit verbundene Erfahrung. Ist Gott das dynamische Sein, so erfährt er sich durch seine Schöpfung, kann aber nicht mehr allmächtig und allwissend sein.1 Er lebt dann auch mit allen »bösen« Dingen, die zur Selbsterfahrung gehören und strebt nach der leeren Einheit.
Das mag dem einen oder anderen Leser noch wie plumpe Esoterik vorkommen, doch wir werden im Zuge dieses Buches diese Prinzipien zu begreifen lernen, völlig unabhängig davon, ob der Leser Atheist oder ein Mensch des Glaubens ist. Gott ist ein Prinzip, welches sich aus der Existenz des Seins ergibt – sowohl die Atheisten als auch die Religiösen haben auf ihre Art und Weise Recht und Unrecht zugleich. Es kommt nur auf den Blickwinkel an, und der wird sich für beide im weiteren Verlauf des Buches verändern, wenn sie sich nur darauf einlassen.
Macht, Eigentum, Geld und Zins
Der Eigentumstitel ›Macht‹ geht allen anderen Titeln immer voran. Titel können nur existieren, wenn sie besichert sind. Diese Besicherung kann nur durch angedrohten oder durchgeführten Einsatz von Waffen erfolgen. Die Waffe muss dabei nicht nur im Besitz, sondern auch im Eigentum der Macht bzw. der jeweiligen Machthalter sein. Die Waffe besichert das Eigentum an sich selbst. In der Waffe fallen demnach Besitz und Eigentum zusammen. Wer sie besitzt, ist zugleich ihr Eigentümer, da er mit Hilfe ihres Besitzes andere von ihrem Besitz ausschließen kann.
Paul C. Martin, Macht, der Staat und die Institution des Eigentums
Es ist nicht Sinn und Zweck dieses Buches, wirtschaftswissenschaftliche Abhandlungen zu verfassen. Deshalb werden die folgenden Kapitel trotz der immensen Komplexität des Themas verkürzt und möglichst vereinfacht dargestellt. Auch können wir auf die Unterschiede zwischen Martins Debitismus-Theorie und Heinsohn/Steigers Eigentumsökonomik nur bedingt eingehen. Ich möchte an dieser Stelle auch betonen, dass nur Zitate als solche direkt den betreffenden Personen zuzuordnen sind, während der übrige Text meine persönliche Interpretation darstellt. Diese beruht zwar auf den Theorien der genannten Ökonomen, muss mit diesen aber im Detail nicht zwingend übereinstimmen. Vielmehr soll ein grober Konsens hergestellt werden, um die Kontinuität zu wahren. Wenn Sie heute auf der Straße einen x-beliebigen Menschen fragen, was Geld eigentlich ist, wird die überwiegende Mehrheit – darunter auch die überwiegende Mehrheit der Ökonomen – es als »Tauschmittel« bezeichnen. Es ist schwer zu begreifen und noch schwerer zu akzeptieren, dass das allgemeine Paradigma »Geld wurde erfunden, um Tauschvorgänge zu vereinfachen« für falsch erklärt werden muss. Nie gab es in vorstaatlichen Zeiten so etwas wie Geld, d.h. ein Gut, das sich aus dem allgemeinen Gütertauschprozess als Geld herausgebildet hat, das jeder annimmt aufgrund des Wissens, dass jeder es annimmt. Zwar gab es durchaus Tauschvorgänge1, doch die beschränkten sich in der Hauptsache auf den Tausch zwischen Stamm und Stamm, oder beruhten auf einem indirekten Tausch, der sogenannten »Schenkökonomie«, die aber keinen ökonomischen oder gewinnorientierten Nutzen verfolgt, sondern eine soziale Funktion erfüllt. Von einem Tauschmarkt oder einer universellen Ware, die als Geld fungiert, fehlt historisch allerdings jede Spur. Wurde doch, im Gegenteil, innerhalb des Stammes solidarisch produziert, d.h. der Stamm sorgte wie eine Großfamilie für seine eigenen Bedürfnisse und das gemeinschaftlich produzierte Gut wurde auf die Stammesmitglieder aufgeteilt bzw. nach konsensualen Regeln zugewiesen. Nach Oppenheimer gibt (bzw. gab) es sogar Stämme, deren Mitglieder mit dem Begriff »tauschen« überhaupt nichts anfangen können und die einem beim Versuch, ein Gut gegen ein anderes (oder gegen eine Dienstleistung) zu tauschen, nur fragende Blicke zuwerfen. Wir halten also fest: Ein allgemein anerkanntes Zahlungsmittel gab es in vorstaatlicher Zeit nicht, zumindest wurde bisher noch kein Beweis für eine Ausnahme entdeckt. Noch immer halten Mainstream-Ökonomen und Professoren im Universitätsbetrieb, ohne den Funken eines Beweises, an dem grundfalschen und folgenschweren Tausch-Paradigma fest – allein weil es einfach und oberflächlich betrachtet einleuchtend klingt und nicht zuletzt auch deshalb, weil dieses Paradigma die Urprämisse ist, auf der so gut wie alle ökonomischen Lehren fußen. Diese Prämisse zu hinterfragen, würde 250 Jahre Wirtschaftswissenschaft auf den Kopf stellen und einen erschütternden Paradigmenwechsel einleiten. Solche Erschütterungen kommen selten schlagartig, sondern vielmehr erst mit dem natürlichen Tod jener, die im wissenschaftlichen Betrieb die Rahmenbedingungen vorgaben.
Was Geld ist und wie es entsteht, erklären sich die ökonomisch Ungebildeten möglicherweise anders als die ökonomisch Versierten. Aber irgendwie ist es in allen Theorien immer von Beginn weg da. Einmal ist es eine Ware, die jeder will. Einmal druckt es der Staat und verteilt es in der Bevölkerung, damit diese Handel treibt mit Geld als Tauschmittel. Einmal entsteht es irgendwie im Prozess des Wirtschaftens usw. Bevor wir diesen Irrtum aber aufklären, wollen wir ein paar juristische Spitzfindigkeiten aufzeigen, die bei der Unterscheidung von Stamm (und Feudalismus/Sozialismus: siehe unten) und Eigentumsgesellschaft bald von großer Bedeutung sein werden.
In der Stammesgemeinschaft gibt es nur Besitz und kein Eigentum. Ich kann in einem Stamm etwas besitzen, das auf Konsens aller übrigen Stammesgenossen beruht (z.B. eine Wohnstätte oder einen Acker, den ich für die solidarische Produktion bearbeite). Aber all das ist nicht mein Eigentum, sondern gehört zum Stammesbesitz1. Selbstverständlich mag das einzelne Stammesmitglied seine privaten Utensilien sein Eigen nennen, sie also besitzen, aber Eigentum im juristischen Sinne kann es nur dort geben, wo es eine Zentralmacht (den Staat) gibt, die dieses Eigentum durch ihr Machtmonopol schützt. Es muss also eine übergeordnete Rechtsinstanz geben, die Eigentum garantiert und Verträge zwangsvollstrecken kann. Würde der Staat als Machtmonopol in einer Eigentumsgesellschaft Eigentum nicht mehr durch seine Legislative, Exekutive und Judikative schützen, würde das Recht des Stärkeren gelten, der Preis für Eigentum würde verfallen und es könnte bei der Kreditschaffung nicht mehr beliehen werden, weil Geschäftsbanken (die es dann ebenfalls nicht mehr geben würde) es nicht mehr als Pfand akzeptieren würden. Der Unterschied zwischen Besitz und Eigentum ist auch in der Eigentumsgesellschaft ersichtlich, etwa wenn jemand eine Wohnung als Mieter oder ein geleastes Auto besitzt, deren Eigentümer jemand anderer ist. Das Eingangszitat Martins lässt bereits erkennen: Die Macht (daher der Staat) geht allen Eigentumstiteln voran. Im Staat müssen Besitz und Eigentum an der Waffe (daher der ultimativen Macht) zusammenfallen. Sobald ein Staat in einer Eigentumsgesellschaft nicht mehr in der Lage ist, sein Gewaltmonopol zu verteidigen, aufgrund von Mord und Totschlag auf der Straße oder einen sozialistischen Putsch, ist Eigentum nicht mehr garantierbar und verfällt wertlos.
Wo es kein Eigentum gibt, da gibt es auch keine Kredite, da Kredite eben immer durch Eigentum besichert sind. Und wo es keinen Kredit gibt, da gibt es auch kein Wirtschaften. Der Stamm produziert auf subsistenzstrategischer Basis, d.h. alle produzieren gemeinsam für alle – man spricht von einer Solidargemeinschaft. Gewirtschaftet wird dagegen nur in einem Machtsystem auf Basis von Recht, Eigentum und Haftung. Würde Stammesbruder A von Stammesbruder B ein Gut borgen und könnte es nicht mehr zurückgeben, so müsste B auf seine Forderung verzichten. Im Stamm herrscht blutsverwandtschaftliche Hilfspflicht. »Die gegenseitigen Hilfspflichten enden erst, wenn alle ohne Güter dastehen.«1 Während der Stamm seinen Bedarf gemeinschaftlich produziert, sind Individuen in der arbeitsteiligen Wirtschaft in der Eigentumsgesellschaft praktisch dazu gezwungen, Verträge mit anderen abzuschließen bzw. diese zu erfüllen, um zu überleben. Die Nichteinhaltung der Verträge führt zur Zwangsvollstreckung. Wir merken bereits jetzt, dass Staat, Eigentum, Geld, Zins und Wirtschaften auf irgendeine Weise ein unlösbares Geflecht bilden.
»Wo eine soziale Konstruktion der bürgerlichen Rechtsordnung fehlt, gibt es statt Eigentumsrechten nur Besitz, statt Vermögen nur Güter, statt Zins bestenfalls Mehrproduktion, statt Geld bestenfalls allgemeine Tauschmittel, statt Kapital nur Produktionsmittel, statt Kauf nur Tausch, statt Märkten nur Tauschplätze, statt Kredit nur Güterleihe, statt Arbeits-/ Einkommenslosigkeit nur Zeiten, in denen es nichts zu tun gibt usw.«2
Wie kam nun das Geld in die Welt? Martins Antwortet lautet: durch die Macht! Die Macht, d.h. der spätere Staat, dessen Entstehungsgeschichte wir ja bereits kennen, fordert in der ersten Phase Tribut vom unterworfenen Stamm, d.h. eine Abgabe (heute Steuer), um seine Macht zu sichern und das »Machterhaltungsmittel Waffe zu finanzieren«1. Diese Abgaben waren in grauer Vorzeit Naturalien (die thesauriert, d.h. nicht mehr verausgabt wurden). Ebenso wurde, je nach Kultur, Waffenmetall – also Kupfer, Zinn (zu Bronze) und später Eisen – zur Abgabe erklärt (zum Waffenmetall zählt aus dem historischen Blickwinkel auch Gold, siehe Martins Gewaltmetall Gold2). Daher wurde erst durch den Abgabenzwang die Abgabe selbst zu Geld. Zuvor gab es kein Geld. Ob dieses Geld Naturalien waren oder später Metall zur Fertigung von Waffen zum Machterhalt und Machtausbau der Herrscher oder heute bunt bedruckte Papierzettel, ist völlig ohne Belang. Erst nachdem die Macht eine Abgabe festlegte, die zu einem Termin zu leisten war, wurde diese Abgabe zum nachgefragten Gut – zu Geld und damit zum Maßstab für die Bewertung aller anderen Güter. Daher ergibt sich der Wert des Geldes durch die Sanktion bei Nichterfüllung der Zwangsabgabe zum Termin. In früheren Zeiten war dies die Schuldknechtschaft, heute der Freiheitsentzug durch staatliche Gerichte. Später startete die Macht, zur Versorgung der Söldnerheere und des Staatsapparats, den Machtkreislauf, indem die Naturalabgabe in Parität zu einer unverderblichen Sache gesetzt wurde (z.B. 180 Gerstenkörner = 1 Schekel Silber in Mesopotamien), um die Herrschaft weiter auszubauen. Die Söldner und Beamten wiederum tauschten dieses Abgabentilgungsmittel (ergo Geld) an die hiesige Bevölkerung gegen Waren und Dienstleistungen, die das Geld (in unserem Beispiel: Silber) benötigten, um ihre monatlichen Tributzahlungen an das Gewaltmonopol leisten zu können. Durch den Rückfluss des Tributs (Redistribution) als terminliche Abgabe an die Macht wurde selbige sukzessive ausgeweitet. Dies ist heute nicht anders, als es vor mehr als 4000 Jahren in Mesopotamien war, wo die erzwungenen Abgaben – wie Texte aus dem 8./7. Jh. v. Chr. zeigen, deren Ursprung am Beginn des 2. Jahrtausends v. Chr. verortet werden kann – theologisch gerechtfertigt wurden:
»Die Götter haben mit der Schöpfung einen Lebensraum geschaffen, in dem sie zunächst allein existierten. Später wurde zu ihrer Arbeitsentlastung der Mensch erschaffen […] Nach der Flut war der Mensch, wie der Text schildert, völlig ungeeignet, ein brauchbarer Mitarbeiter für die Götter auf Erden zu sein. Dazu bedurfte es der Leitung durch einen Regenten, eine lenkende Autorität. Dieser sollte den Menschen helfen, der Natur so viel Ertrag abzuringen, wie er für seinen eigenen Unterhalt und darüber hinaus für die Versorgung der Götter brauchte.«3
An dieser Stelle pausieren wir vorerst, denn ich höre bereits den einen oder anderen Leser laut aufschreien: Geld soll niemals ein Tauschmittel gewesen sein, sondern eine Steuerforderung, d.h. eine Schuld?! Was ist mit dem sogenannten »Primitivgeld«, wie Muschelgeld, gelochten Steinen, Zahngeld usw.?
In allen egalitären Stämmen außerhalb und unberührt von einer abgabenfordernden Zentralmacht handelt es sich ausnahmslos um soziale Buchführungssysteme, denen jeder monetäre Charakter abgeht. Das sogenannte »Primitivgeld« hat nichts, aber auch gar nichts mit dem Phänomen Geld gemein, bis auf eine Sache: Es repräsentiert ein Schuldverhältnis, allerdings ein soziales Schuldverhältnis, kein monetäres. Steht beispielsweise eine Heirat bevor, so hat in manchen patrilinearen/patrilokalen Stämmen die Familie des Bewerbers der Familie der Braut einen Brautpreis in Form der jeweiligen sozialen »Währung« zu übergeben. Im Normalfall handelt es sich dabei um seltene, oder sakrale, oder aufwendig herzustellende Waren. Übergibt also die Familie des Bräutigams eine bestimmte Menge ganz spezifischer Muscheln an die Familie der Braut, so sind diese Muscheln kein Geld. Die Familie der Braut kann damit nirgendwo einkaufen gehen. Sie kann mit diesen Muscheln keine Waren oder Dienstleistungen erwerben, weder bei der Familie des Bräutigams noch in irgendeinem anderen Stamm. Ebensowenig wurde mit diesen Muscheln für die Braut bezahlt. Die Muscheln verbleiben bei der Familie der Braut und dokumentieren nichts anderes als eine soziale Forderung: Der Familie der Braut fehlt nun eine Arbeitskraft (die noch dazu fähig ist, neues Leben zu gebären). Die Familie des Bräutigams erkennt diese Schuld an und dokumentiert sie mit der Übergabe der Muscheln. Die Schuld bleibt so lange aufrecht, bis die Familie des Bräutigams ihrerseits eine Tochter an die Familie der Braut übergibt. Dann erst erlischt die Schuld. Auf diese Weise organisiert ein Stamm den sozialen Ausgleich. Gleiches gilt beim sogenannten Blutgeld, das oft in derselben Währung, ja oft sogar in derselben Menge als Schuld verbucht wird. Hier erhält die Familie eines Mordopfers von der Familie des Mörders die entsprechende soziale Währung, die einerseits Reue symbolisiert und Vergebung erbittet und andererseits ein dauerhaftes Schuldverhältnis dokumentiert: Die Familie des Mörders schuldet der Familie des Ermordeten ein Menschenleben. Diese Schuld erlischt entweder nie oder erst, wenn die Trauernden ihrerseits einen Rachemord an der Familie des Täters begehen. In manchen Stämmen ist es auch möglich, den Mord zu sühnen, indem die Familie des Täters der Familie des Opfers eine Tochter übergibt, die dann beispielsweise mit dem Bruder des Opfers verheiratet wird und ihm Kinder gebärt.
Die soziale Währung spielt auch eine große Rolle bei der Respektserweisung (sie verleiht Prestige, aber nicht im materiellen Sinne), beim Aushandeln von Friedensabkommen usw. In manchen Stämmen kann die soziale Währung, meist in Notlagen, auch dazu verwendet werden materielle Schuldverhältnisse mit dem Nachbarstamm einzugehen, allerdings wird mit dieser Währung nichts gekauft. Wenn Stamm A beispielsweise Vieh benötigt, kann er bei einem Nachbarstamm B vorsprechen. Kann dieser Vieh entbehren, hinterlegt Stamm A dafür eine definierte Menge der sozialen Währung. Mit der Übergabe dieser »Währung« erkennt Stamm A an, dass er Stamm B das Vieh schuldet. Er kann seine Schuld auch mit etwas Gleichwertigem tilgen, wenn Stamm B es als gleichwertig anerkennt, aber natürlich niemals mit Geld. Die soziale Währung ist nicht umlauffähig. Sie hat auch keinen Marktwert oder eine Kaufkraft. Alles, was diese »Währung« aussagt, ist: Stamm A schuldet mir x Stück Vieh. Hätte Stamm B einen Notizblock, einen Stift und ein Schriftsystem könnte er auch einfach notieren, dass ihm Stamm A Vieh schuldet. Die Übergabe der »Währung« ist damit nichts anderes als eine Buchführung. Geld oder universelle Tauschmittel benutzen Stämme ausschließlich dann, wenn Kontakt zu einem Machtsystem besteht. Wenn Stammesgemeinschaften begreifen, dass sie mit Gold oder Dollarscheinen echte Nahrung außerhalb ihrer Stammesstruktur bekommen, dann werden sie diese Währungen oder Tauschmittel auch verwenden bzw. annehmen. Auch der umgekehrte Fall ist dokumentiert: So wurde die soziale Währung der Indigenen, die sogenannten »Wampum-Gürtel«, nach der Eroberung der Neuen Welt zum nachgefragten Kunsthandwerk durch die Europäer, was so weit ging, dass diese in New England von 1637 bis 1661 zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklärt und in ein fixes Kursverhältnis zum Penny gesetzt wurden. Damit degradierte auch bei den Indigenen die ursprünglich sakral aufgeladene Währung für den sozialen Ausgleich zum profanen Zahlungsmittel für den Erwerb von europäischen Gütern.
Wie wir sehen, hatte das sogenannte Primtivgeld eine rein soziale Funktion – es war eine soziale Buchhaltung, wenn man so will. Man konnte mit diesem »Geld« zu keinem Zeitpunkt etwas erwerben. Das war auch gar nicht möglich, da Stämme eben keine Überschüsse produzieren, die sie an irgendeinem fiktiven Markt hätten feilbieten können. Zwar gab es vereinzelt und meist in einem aufwendig zeremoniellen Rahmen Tauschakte zwischen Stämmen, aber nie mit Geld als Tauschmittel. Ist doch Geld als physisches Gut, ganz im Gegenteil, ein noch relativ junges Phänomen und es entwickelte sich auch nicht auf privater Ebene im Zuge von Tauschakten, sondern war und ist seit jeher ein reines Machtderivat. Erst wenn eine Menschengruppe eine andere Menschengruppe kriegerisch unterwirft und sie zwingt, Überschüsse als Tribut abzuliefern, ist das Geld in der Welt. Zu Beginn der Staatenhistorie wurden die vom Staat abgeforderten Naturalabgaben schriftlich verbucht. Es waren reine Kreditsysteme, in denen, beispielsweise in Mesopotamien, auf Tontafeln dokumentiert wurde, wer dem Tempel wie viel schuldet. Dieses zu erwirtschaftende Surplus ist im ganz konkreten Sinne ein Zins (worauf sich auch die in alten Büchern gebräuchliche Bezeichnung »Zinnß« für die Steuer bezieht), d.h. eine Mehrleistung, die periodisch zu erwirtschaften war. Konnte aber ein Abgabenschuldner seine Leistung zum Termin nicht erbringen, musste er sich das Abgabengut beim Tempel leihen, um der Sanktion des Staates zu entgehen. Hierfür wurde eine Schuldurkunde (auf einer Tontafel) ausgestellt, welche die geschuldete Summe dokumentierte. Dieser »Schuldschein« konnte vor Ablauf der Laufzeit vom Gläubiger an einen Dritten gegen einen Abschlag (Disagio) abgetreten (zediert) werden, womit diese Urkunden als Geld zu zirkulieren begannen, deren Schuldinhalt auf eine bestimmte Menge Abgabengut lautete. Bei der Naturalabgabe, die nicht durch Verschuldung emittiert, sondern periodisch abgefordert und schließlich verbraucht bzw. über Mittelsmänner des Palastes an andere Machtzentren im Austausch gegen andere begehrte Waren geliefert wurde, können die Bezeichnungen Zinnß (»Zins 1«) und Geld (Getreide als Abgabengut, ergo »Geld 1«) synonym verwendet werden. Die darauf aufbauenden privaten Schuldbeziehungen können als »Geld 2«1 verstanden werden. Wurden sie zediert, d.h. als Geld verwendet, war ein privater Zins (»Zins 2«) in Form eines Abschlags zu entrichten. Für Martin ist der ursprüngliche Zins – der sich bei ihm aus dem »Zinnß«, d.h. der erzwungenen Abgabe bzw. Steuer an den Staat ergibt – also ein Abschlag (Diskont oder Disagio) auf einen Schuldtitel, der vor Fälligkeit an einen Dritten abgetreten wurde.2 Wir kennen Selbiges vom Wechsel, auf dem ganz genau festgehalten wird, wie viel ein Wechselschuldner im jeweiligen Abgabengut zu leisten hat. Auch hier ist von einem Zins nichts zu entdecken. Erst wenn der Wechsel diskontiert wird, d.h. an einen Dritten oder Vierten weitergegeben wird, um die darauf verbriefte Summe früher zu kassieren als zum Termin, kommt es zum Abschlag, der später der Einfachheit halber auf die geschuldete Summe aufgeschlagen wurde. Ersichtlich ist dieser Abschlag aber teilweise noch heute zwischen Banken und Zentralbanken, wo Schuldtitel diskontiert werden, d.h. die auf dem Schuldtitel verbriefte Summe gegen Abschlag früher als zum Fälligkeitstermin ausbezahlt wird.
Hier sehen wir, dass Geld bereits in seinen Anfängen Schuldverhältnisse dokumentierte. Zu keinem Zeitpunkt war Geld ein Netto-Gut, um Tauschvorgänge zu erleichtern, verbrieft doch Geld als Guthaben, ganz im Gegenteil, erst die Forderung an einen Schuldner als Counterpart, Dienstleistungen zu erbringen bzw. Waren im Überschuss herzustellen, die dann mit Geld gekauft werden können, was wiederum dem Schuldner die Möglichkeit gibt, sich von seiner Schuld zu befreien (zumindest temporär, da es das Wesen von Staatssystemen ist, seine Schäfchen in permanenter Verschuldung zu halten, um Wirtschaftsleistung zu generieren). Wer in vorstaatlicher Zeit oder bei noch heute von der Zivilisation unberührten Stämmen mit einem Goldnugget Waren oder Dienstleistungen kaufen wollte, würde bestenfalls ausgelacht. Niemand würde sich dort für ein funkelndes Stück Metall zum Dienstleister degradieren oder Nahrung abgeben, die dem Stamm dann zur Bedienung der eigenen Urschuld fehlen würde. Nicht nur, dass Gold in den meisten Stämmen bestenfalls ideellen Wert hatte – man muss sich eher die Frage stellen, ob Gold überhaupt jemals so etwas wie einen »intrinsischen Wert« besaß, wie von Gold-Fans und Tausch-Theoretikern gern fabuliert wird, denn selbst im klassischen Goldstandard war Gold kein Wert an sich, sondern eine Recheneinheit, um Schuldverhältnisse zu dokumentieren. Aber wie kam es aus historischer Sicht zu diesem bis heute anhaltenden Mythos, der Edelmetalle umgibt?
Die Verklärung und Vergöttlichung von Gold lässt sich mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auf seine Verwendung als Jagdwaffenmetall vor rund 30.000 Jahren vor unserer Zeit zurückführen, welches später, im Zuge der Bildung erster Protostaaten im Neolithikum, in verschiedensten Teilen der Welt von der herrschenden Klasse monopolisiert wurde und nur ihr vorbehalten war. Für Details empfehle ich das Buch »Gold-Revision – Vom kosmischen Fall zum irdischen Aufstieg der Edelmetalle«, in dem sich Luis Pazos auf Spurensuche begibt. Gold als Waffen- und Rüstungsmetall zur Maximierung der Ausbeutung unterworfener Völker konnte damit von der Elite in ein klares Kursverhältnis zu Naturalabgaben gesetzt werden (wie viel Naturalabgaben lassen sich mit x Kilogramm Gold als Waffenmetall abfordern), weshalb mit dem Gold auch Söldner entlohnt werden konnten. Hier und nur hier kann von einem »inneren Wert« von Gold gesprochen werden, da mit Gold als Waffenmetall Erträge von unterworfenen Völkern abgepresst werden konnten. Als die Edelmetalle durch das Aufkommen der Schmelzofen-Technologie und die Verbesserung der metallurgischen Bearbeitung nach und nach ihres Waffencharakters beraubt wurden, fiel ihnen eine neue Rolle zu, wie sich aus den zu diesem Zeitpunkt existierenden schriftlichen Aufzeichnungen klar herauslesen lässt. Schnell erkannte man nämlich, dass fälschungssicheres Metall – auch wenn dieses sonst keinerlei Nutzwert mehr hat – nach wie vor dazu verwendet werden kann, das Machtmonopol zu sichern und auszubauen. Man benutzte es weiterhin zur Versorgung von Söldnerheeren, die ja unmöglich ständig über riesige Distanzen mit Nahrungsmittel beliefert werden konnten, und verwendete dabei einen simplen Mechanismus. Man setzte das Edelmetall in Parität zu einer bestimmten Menge Naturalien1, übergab den Söldnern (und dem gesamten Beamtenapparat, der das Machtzentrum verwaltete) eine bestimmte Menge des Metalls als unverderbliche Vorauszahlung und forderte dieses Edelmetall gleichzeitig als Abgabe von der unterworfenen Bevölkerung. So hatte das Volk die Wahl, entweder Naturalien als Abgabe an die Macht zu liefern oder diese Naturalien sofort an Söldner gegen das Edelmetall zu tauschen und statt Naturalien dieses an das Machtzentrum bzw. dessen Mittelsmänner abzuliefern. Mit der Implementierung des von Martin so genannten »Machtkreislaufs« verwandelte sich der Staat in eine riesige Kriegsmaschinerie. Sehr schön ist auch hier zu sehen, dass die Edelmetalle keinen inhärenten Wert besaßen, sondern ihnen dieser Wert durch den staatlichen Abgabenzwang erst verliehen wurde. Der Staat hätte hierfür ebenso Schnecken als Abgabe abfordern können, wie das tatsächlich beispielsweise bei Kauri-Schnecken auf der Isla do dinheiro vor der Küste Angolas im 10. Jh. der Fall war. Wichtig war nur eines: Was die jeweiligen Herrscher auch immer als Abgabenmittel auserkoren, es musste a) fälschungssicher sein und Fälschungsversuche mussten mit drakonischen Strafen geahndet werden und b) hauptsächlich im Besitz der Herrscher selbst sein. Die Kauri-Schnecken kursierten deshalb auch nicht einzeln, »sondern staatlich genormt in Hohlmaßen oder Schnüren, die vorgegebene Länge war in den Unterarm tätowiert bzw. umfasst den ganzen Unterarm«1. Ebenso hätten die Herrscher bunt bedruckte Zettel verwenden können. Wir sehen bereits hier, dass Geld immer und ausschließlich eine Recheneinheit zur Dokumentation von Schuldverhältnissen ist und nie einen Netto-Wert darstellt, der zum Tausch verwendet wird, wie das ganze Heerscharen an Ökonomen und Universitätsprofessoren in die Köpfe der Zeitungsleser und Studenten hämmern. Bis hierher könnten wir der ökonomischen Kaste wohlwollend historische Ignoranz vorwerfen. Besonders absurd wird es aber, wenn die unwiderlegbaren, realen und für jedermann leicht nachprüfbaren monetären Abläufe im klassischen Goldstandard und im heutigen Papiergeldsystem umschrieben und umschifft werden, als wären sie gar nicht existent. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wird auch der Leser glasklar erkennen, dass wir es mit einer Pseudowissenschaft zu tun haben, die es, befeuert durch massive Lobbyarbeit neoklassischer Ökonomen und libertärer Anhänger der österreichischen Schule der Nationalökonomie, bis in die höchsten Ränge des Staates und den akademischen Betrieb geschafft hat. Sehen wir uns nun die nächsten Phasen der historischen Geldentstehung an, dann sind wir schon beinahe beim modernen Geldwesen angelangt.
Nachdem der Staat eine fälschungssichere Recheneinheit als Abgabe festgelegt hatte, wurde diese zu Geld zur Bedienung der periodischen abgeforderten Abgabenschuld bzw. zum Schuldinhalt, auf den private Schuldkontrakte lauteten. Doch wie kam das Volk zu dieser Abgabe, die doch hauptsächlich der Elite vorbehalten war? Zum einen natürlich durch den Tausch von Waren gegen das Abgabengut mit Söldnern, Staatsbeamten oder anderen Staatsverwaltern, denen der Staat das Abgabengut vorschoss. Der Rest musste sich das Abgabentilgungsmittel bei einer vom Staat eingerichteten Institution (z.B. Tempelbanken in Mesopotamien oder Griechenland) gegen Zins leihen. Als Pfand bzw. Sicherheit diente der eigene Körper, d.h. wer nicht zeitgerecht seine Schulden beglich, wurde in die Schuldknechtschaft verkauft (oft mit Sippenhaftung). Dieser Mechanismus ist nicht nur simpel, er ist die Voraussetzung für Geld, wie wir es heute kennen. Auch die Notenbanken der Neuzeit emittieren das gesetzliche Zahlungsmittel, normiert gegen Pfand und Verschuldung, gleichgültig ob es sich bei diesem um goldgedeckte Banknoten oder Papiergeld handelt. Immer muss der Staat etwas als Abgabe verlangen, das sich seine Schäfchen durch Verschuldung besorgen müssen. Erst dieser Zwang zur Verschuldung generiert Wirtschaftsleistung, weil die Marktteilnehmer nun Leistung erbringen müssen, d.h. Waren und Dienstleistungen erwirtschaften müssen, um von ihrer Schuld herunterzukommen. Das Risiko des Abgabenforderers, ergo Staates, liegt genau darin, dass er die Vorkommen bzw. die Produktion des Abgabenmittels immer unter Kontrolle haben muss. Sei es, dass er sich die Rechte auf den Edelmetallabbau sichert und Private nur gegen Gebühr schürfen lässt (Bergregal), die Kontrolle über die Emission der Münzen hat (Münzregal) oder die Ausgabe von Papiergeld monopolisiert (Notenbank-Monopol).
Eine Goldmünze ist kein Wert an sich. Tatsächlich wirken Goldmünzen, die der Staat ohne Nachfrage durch einen Schuldner emittiert, inflationstreibend, weil ja gleichzeitig der Wirtschaftsoutput gleichgeblieben ist. Nur weil der Abbau von Gold energieaufwendig bzw. schweißtreibend ist, kann man nicht umso mehr Waren kaufen, je mehr man abbaut. Es trifft bloß mehr Gold auf weniger Waren, was die Preise anhebt. Es ist das, was Debitisten »Netto-Geld« nennen: Geld, das ohne Verschuldung das Licht der Welt erblickt hat und dementsprechend wertlos ist. Dennoch emittiert der Staat in begrenztem Ausmaß auch außerhalb schwerer Krisen »Netto-Geld« ins System, was er als sogenannte »Seigniorage« verbucht – eine Steuer durch Inflation. Heute passiert das durch das gesetzliche Zahlungsmittel in Münzform (Scheidemünzen). Dieser Prozess ist gesetzlich streng reglementiert, um inflationäre Exzesse zu vermeiden. Papier- und Giralgeld dagegen ist immer durch Schulden gedeckt – die Frage ist diesbezüglich nur, ob der Schuldner auch leistet. Der Seigniorage-»Gewinn« besteht immer aus der Differenz zwischen tatsächlichem Wert und Herstellkosten – im Falle von Gold in einem vollgedeckten Goldstandard wären das die abgebauten Unzen Gold minus die Kosten des Abbaus des Goldes bis zur eventuellen Prägung, ausgedrückt in Unzen Gold. In einem teilgedeckten Goldstandard würde der Staat das ausgegrabene Gold an die Notenbank verkaufen. Der »Gewinn« liegt hier also in der abstrakten Recheneinheit, mit exaktem Verhältnis zu einer Gewichtseinheit Gold (beispielsweise 20,67 $ für eine Unze Gold im Falle des US-Münzgesetzes 1834), gegen welche die Notenbank das Gold aufkauft, minus die Abbau- und Prägekosten ausgedrückt in dieser abstrakten Recheneinheit. Und im heutigen Papiergeldstandard ist das der Nennwert der Münzen in einer abstrakten Recheneinheit minus die Kosten für Rohmaterial und Prägung der Münzen1 in dieser Recheneinheit. Ich erläutere das Beispiel mit der Seigniorage deshalb so ausführlich, weil es den riesigen Denkfehler neoklassischer Ökonomen entlarvt, die in Geld einen Wert an sich sehen, der losgelöst von einer simultan zum Geldwert erzwungenen Wirtschaftsleistung steht. Emittiert der Staat beispielsweise Gold netto, so hebt er die Preise. Er hat damit zwar in der ersten Runde den Vorteil, dass er Waren und Dienstleistungen zum alten Preisniveau erwirbt, bevor die Preise zu steigen beginnen, aber er entwertet damit die Kaufkraft seiner eigenen Währung und damit die Kaufkraft der eigens in dieser Währung eingehobenen Steuer, die er in den kommenden Monaten erhöhen muss, wenn er seinen Staatsapparat weiter durchfüttern will. Hier sehen wir auch – noch bevor wir uns überhaupt mit dem Notenbankzins oder dem Geschäftsbankzins beschäftigen müssen –, dass es sich bei der Steuer um den ersten Zins handelt, der nach Etablierung einer Notenbank, die Schuldtitel vor Fälligkeit diskontiert, einen Zins 2 hervorbringt und dieser wiederum im modernen zweistufigen Banksystem, auf das wir in Kürze zu sprechen kommen, den privaten Zins 3. Wird also vom Staat Netto-Geld ausgegeben, muss die Steuer erhöht werden, um die Wirtschaft auf gleichem Niveau laufen zu lassen oder umgekehrt formuliert: Da Netto-Geld von echtem Geld nicht zu unterscheiden ist und ebenso dazu dient, bestehende Schulden zu tilgen, steht diesen getilgten Schulden keine Wirtschaftsleistung gegenüber – diese kann nur durch eine Erhöhung der Steuer gewährleistet werden. Gleiches gilt, wenn der Staat damit ausstehende Staatsschulden tilgt. Staatsschulden, d.h. die Zession zukünftiger Steuereinnahmen, wirken immer inflationär, weil der Staat am Markt nur nachfragt, aber kein entsprechendes deflationäres Angebot an Waren und Dienstleistungen stellt, um seine Schulden zu tilgen, um diese Inflation im gesamtwirtschaftlichen Maßstab wieder zu neutralisieren. Neutralisieren kann er diese Inflation ausschließlich dann, wenn er diese Schulden dem Volk aufbürdet, d.h. die Steuern erhöht, die sich das Volk wiederum durch Verschuldung besorgen und durch Leistung abarbeiten muss. Tilgt also der Staat seine Staatsschulden mit Netto-Gold, bleibt das Inflationsniveau dauerhaft bestehen. Was der Staat mit »überschüssigem«, beispielsweise über den Außenhandel erwirtschaftetem Gold, machen kann: Er kann die Inflation in andere Staaten auf Basis eines Goldstandards auslagern. Fließt Gold einem anderen Land zu, senkt das dort die Zinsen und hebt die Preise, sodass sich die Handelsbilanz wieder umkehrt: Es wird mehr importiert als exportiert, so lange, bis das Gold auch aus diesem Land abgeflossen ist und der nächste Staat (oder der ursprüngliche Staat, wenn von dort die Importe bezogen werden) mit einem Inflationsimpuls umgehen muss. Es gibt beim Staat weder in einem Warengeldstandard noch in einem ungedeckten Papiergeldsystem, weder ober- noch unterirdisch, irgendwo eine Schatztruhe, in die man nur hineinzugreifen braucht, um dafür plötzlich Waren und Dienstleistungen geschenkt zu bekommen, denn irgendjemand muss diese Waren und Dienstleistungen schließlich auch erwirtschaften. Ein Staat, der Überschüsse produziert, muss andere dafür tiefer in die Verschuldung getrieben haben – entweder das eigene Volk oder ein anderes: durch ein Handelsbilanzungleichgewicht, einen Wirtschaftskrieg oder durch militärische Unterwerfung.
Dass Gold im Goldstandard eine reine Recheneinheit für Gläubiger-Schuldner-Kontrakte war, lässt sich auch daran erkennen, dass es weder bei Gold im Goldstandard noch bei Papiergeld heute jemals solche aberwitzigen Schwankungen in der Kaufkraft gegeben hat, wie Gold heute als freies und rein psychologisch getriebenes Asset aufweist, das ja nun, ginge es nach libertärer Lehre, nach der staatlichen Entmonetarisierung endlich als Privatgeld zur Verfügung stünde. Umgekehrt kann kein Tauschtheoretiker erklären, warum auch Papiergeld, dessen Wert ja angeblich auf reinem Vertrauen beruht, abgesehen von einer konstanten Inflation, auf deren Ursache wir noch zurückkommen, zu keinem Zeitpunkt eine auch nur annähernd so drastische Schwankung in der Kaufkraft hatte, wie Gold heute. Wir sehen, dass Geld mitnichten eine Ware, sondern immer Produkt einer Gläubiger-Schuldner-Beziehung ist, die ihren Ursprung in der Schuld »ex nihilo« hat – der Steuer! Deshalb definiert sich der Reichtum eines Staates auch nicht durch seinen Gold- bzw. Geldvorrat, sondern durch seine Wirtschaftsleistung, die erst dem Geld seinen Wert gibt. Aus diesem ökonomischen Unverständnis der tatsächlichen Abläufe resultieren dann auch Hirngespinste, wie das bedingungslose Grundeinkommen, bei dem so getan wird, als wäre Geld, wie im Sozialismus, ein Gutschein zum Erwerb von bereits Geleistetem und nicht, wie es realiter der Fall ist, eine Forderung auf zukünftige Leistungen. Oder diese unsägliche Diskussion selbsternannter Ökonomen, ob Bitcoins das Potential hätten den etablierten Währungen den Rang abzulaufen, was selbstverständlich niemals (!) der Fall sein wird, weil ein Bitcoin, ohne Schuldner als Counterpart, eben keine Währung ist, sondern ein virtuelles Asset, das mit echtem Geld gekauft und gegen echtes Geld verkauft werden kann, ebenso wie Gold außerhalb eines Goldstandards.1 Um ein Gefühl für das Wesen des Geldes zu bekommen, haben wir nun bereits zu weit vorgegriffen, denn ein Charakteristikum unterscheidet das moderne Geldsystem noch fundamental von den Anfängen der Staatenhistorie und splittet das damals einstufige Banksystem (Staat mit Staatsbank) in unser gegenwärtiges zweistufiges Bankensystem: Das Eigentum!
In jeder Kultur entwickelte sich aus dem stammesähnlichen Hausen ohne zentrale, abgabenfordernde Obrigkeit nach der Unterwerfung ein feudales System1, das schließlich, aus unterschiedlichsten Gründen, nur teilweise oder aber vollkommen in eine Eigentumsgesellschaft2 überging. Martin erklärt das Freigeben des eroberten Gebietes zur privaten Bewirtschaftung folgendermaßen:
»Existiert Steuerbelastung (Schuld des Publikums dem Staat gegenüber), kann diese gemindert werden, sobald das Publikum die Möglichkeit erhält, mit Hilfe von privatem Eigentum zu wirtschaften. Dieses entsteht, sobald die Macht gezwungen ist oder wird, Teile von ihren Eigentumsrechten abzutreten (nach Katastrophen, Revolutionen, durch Privilegierungen usw.), die sie sich entweder im Abgabenmittel bezahlen lässt oder in Ausübung ihrer Souveränität über das Areal, in dem sich das private Eigentum befindet, dieses weiterhin als Steuerbasis belässt.«
Entgegen libertärer Phantasien können Eigentumstitel nur vom Staat als ursprünglichem Obereigentümer abgetreten werden. Nur er kann Rechte und Pflichten des Eigentümers durch sein Machtmonopol garantieren. Ist erst Eigentum vorhanden, beginnt die eigentliche Form des Wirtschaftens, denn Eigentum lässt sich belasten, d.h. mit Hilfe von Eigentum kommen Kredite in die Welt und mit den Krediten der Kapitalismus, wie wir ihn heute kennen und wie er mindestens seit der griechischen Antike verbürgt ist. Für das Einräumen von Kredit benötigt man nämlich – entgegen landläufiger Meinung, die sogar von vielen selbsternannten Ökonomen vertreten wird – nicht zuerst das Abgabengut, ergo Geld, sondern mit dem Kredit wird erst eine Forderung auf Geld erschaffen, indem auf beiden Seiten, der des Gläubigers und der des Schuldners, Eigentum bzw. Vermögen (Aktiva) belastet wird. Das Einräumen von Kredit durch vermögende Privatpersonen, die sich später zu Banken entwickeln, ist deshalb etwas fundamental anderes als eine Geldleihe, bei der tatsächlich Geld verliehen wird. Bei einem Kreditgeschäft muss weder zuvor Geld vorhanden oder »einbezahlt« worden sein, noch wird dabei Geld verliehen. Stattdessen wird das Vertrauen in die prinzipielle Zahlungsfähigkeit des Gläubigers (!) verliehen, das sich eben nicht allein auf das Geldvermögen beschränkt, sondern auf das gesamte Vermögen (Eigentum), das sich in Geld bepreisen lässt. Bevor im nächsten Kapitel im Detail gezeigt wird, wie ein Gläubiger, indem er sein Vermögen belastet, Kredit vergibt, ohne dabei Geld zu verleihen, schauen wir uns das Prinzip dieses Vorgangs am Beispiel des Wechsels an. »Zieht« beispielsweise ein Gläubiger einen Wechsel auf einen Schuldner, auf dem die zu zahlende Summe zum Fälligkeitstermin verbrieft ist (beispielsweise lautend auf Gold als gesetzliches Zahlungsmittel), so kann dieser Wechsel während der Laufzeit vom Gläubiger an Dritte, Vierte usw. weitergegeben werden, wenn diese ihn als Zahlungsmittel akzeptieren. Das geschieht aber im Normalfall nur dann, wenn der Gläubiger einen guten Ruf genießt und mit seinem Vermögen (Eigentum) für den Ausfall des Wechsels haftet, um das Vertrauen in das Dokument zu stärken, da der Dritte ja möglicherweise den Hauptschuldner nicht persönlich kennt. Der Dritte wiederum kann auch seinerseits für den Ausfall des Wechsels mit seinem Eigentum haften und ihn weiterreichen (zedieren). Je mehr Eigentümer für den Wechsel haften, desto umlauffähiger wird er und damit würde dieses Stück Papier zu einem Derivat von Geld zur Dokumentation von Schuldverhältnissen unter Privaten. Das Gold, das der Schuldner dem Inhaber des Schuldtitels zum Fälligkeitstermin zu zahlen hat, wird zum Tauschgegenstand, um die Schuld zu tilgen. Ist erst die Schuld getilgt, verfällt das Dokument wertlos. Was wir hier beschrieben haben, ist im Kern nichts anderes als Giralgeld, das die Geschäftsbanken bei der Kreditaufnahme erschaffen und nach Tilgung der Schuld aus ihren Bilanzen löschen.
Und damit dringen wir endgültig zum Kern des Debitismus vor: Geld war immer ein Schuldentilgungsmittel, d.h. immer, wenn Geld existierte, musste auch gleichzeitig eine Schuld dafür offen sein, die mit Geld getilgt werden musste. War dieses Geld in grauer Vorzeit Naturalien oder Metalle, dann mussten die Menschen wirtschaften, d.h. Leistung erbringen, um mit dem dadurch verdienten Geld ihre Steuerschuld tilgen zu können. Von da an kam es zu einer regelrechten Evolution des Geldbegriffs, dessen Kern sich aber nie änderte, denn auch im privaten Wirtschaftsleben wird mit Geld immer nur eine bestehende Schuld getilgt, wie im nächsten Kapitel im Detail gezeigt wird. Das Geld als solches – egal ob es Gold oder Papier ist – ist dabei nie mehr wert als sein Gebrauchswert1. Den Wert erhält das Geld erst durch den darunterliegenden Schuldkontrakt, der zur Leistung verpflichtet. Einen »inneren Wert«, losgelöst von einer terminfixierten Schuld (zuerst staatlich, dann privat), kann Geld nicht haben.
Ersetzt man das Gold durch Papier, ändert sich im ersten Moment gar nichts. Der einzige Unterschied liegt darin, dass der Goldbestand einer Notenbank im Goldstandard begrenzt ist bzw. erst mühsam durch Förderung vermehrt werden muss, d.h. je mehr nachgefragt wird, desto höher steigen die Zinssätze, was die Nachfrage früher oder später einbrechen lässt. Ebenso sind der Staatsverschuldung Grenzen gesetzt, weil bei der Notenbank eingereichte Staatstitel für einen leistungslosen Goldabfluss sorgen, der irgendwann die gesetzlich vorgeschriebene Deckung zu unterschreiten droht. Eine Notenbank in einem Papiergeld-System dagegen kann auf Nachfrage unbegrenzt drucken, was so lange kein Problem darstellt, wie diese Verschuldung auch wieder beglichen wird, ergo das Geld (bzw. spiegelbildlich dazu die Schuld) durch Anbieten von Waren und Dienstleistungen am Markt im Gegenwert dieser Recheneinheit erwirtschaftet wird. Und Geld erwirtschaften bedeutet immer (!), jemand anderen tiefer in die Verschuldung zu treiben, denn des Einen Guthaben muss des Anderen Schuld sein. Geld dokumentiert also immer eine Schuld, zuerst die Abgabenschuld an die Machthalter und darauf aufbauend die Kontraktschuld zwischen Privaten. Der Staat simuliert dabei nichts anderes als die Urschuld bzw. baut als Derivat des Mangels (Überbevölkerung, Landmangel, Ressourcenmangel etc.) auf demselben Schema auf, das uns bereits von der Natur aufgezwungen wurde: Er zwingt die Menschen dazu, ein definiertes Ding durch Leistung zu erwirtschaften, um es zum Termin (Fälligkeitstermin der Steuer- oder der privaten Kontraktschuld) abzuliefern, um der Sanktion zu entgehen. Geld entsteht also durch die terminfixierte Zwangsabgabe und diese Abgabe wird erst dadurch zum Bewertungsschema für andere Waren und Dienstleistungen, d.h. sie schafft Preise. Erst dieser Abgabenbeschaffungszwang zum staatlich festgesetzten Termin verlangt nämlich in weiterer Folge, durch den Tausch von Waren und Dienstleistungen gegen das Abgabenmittel selbiges zu beschaffen, um es an die Macht abliefern zu können. Das führt zum Beginn des Handels! Um das zu verdeutlichen: Der Auslöser für die wirtschaftliche Dynamik in einem Machtsystem – von der Zerstörung einer egalitären, geldlosen Solidargemeinschaft hin zu einer immer feiner differenzierten und spezialisierten Arbeitsteilung mit Handelszwang und individueller Haftung – ist einzig und allein der Druck, die Abgabe pünktlich zum Termin an den Staat zu leisten. Der Termin ist nach Martin die entscheidende Größe und spielt im Debitismus die wichtigste Rolle überhaupt. Er schreibt: »Tatsächlich sind weder Güter noch Geld – in welcher Form auch immer – ›als solche‹ knapp, sondern stets nur zum Termin, an dem sie erscheinen sollen (z.B. Wasser beim Durstigen) oder erscheinen müssen (Geld beim Steuertermin). Gäbe es keinen Termin zur Zahlung von Geld in welcher Form auch immer, wäre Geld nicht definierbar. Oder anders: Geld, das nie Termin hat, ist per definitionem wertlos – unbeschadet der Tatsache, auf welchem ›Träger‹ es marschiert, ob also auf Metall oder Papier.«1
Wir sind hier wiederum beim Phänomen »Zeit«. In Stammesgesellschaften wird für den Eigenbedarf produziert. In Machtsystemen wird nach der Etablierung von Eigentum gewirtschaftet, um das Abgabenmittel »Geld« zum Termin an die Macht liefern zu können. Oder wie Martin es formuliert: »Sobald sich Macht und Zins etabliert haben, beginnt jene ›wirtschaftliche Dynamik‹ von Geld (Abgabengut) und Zins (Abgabengut-Beschaffungsmittel), die sich über Schwankungen in der Geschichte bis zur heutigen Form entwickelt hat.«
In einer Eigentumsgesellschaft muss der Kapitalist, bevor er überhaupt wirtschaften kann, Kapital haben, d.h. er muss sich zuerst (!) verschulden, um seine Produktion vorzufinanzieren und so an das Steuertilgungsmittel zu kommen. Die ganze Wirtschaft in einem kapitalistischen System beruht also auf Schuldkontrakten mit Termin, die sofort wertlos werden, sobald der Schuldner seine Leistung zum Termin erbracht hat. Die Vorstellung, dass Geld (z.B. Gold) einfach so vorhanden ist und als Schmiermittel für Tauschvorgänge dient, ist vollkommen falsch. Geld ist nie (!) einfach so vorhanden, weil es sonst keinen Wert hätte. Es muss immer erst durch Leistung erwirtschaftet werden. Besser verständlich wird all das erst, wenn wir im nächsten Kapitel unser modernes Geldsystem dem klassischen Goldstandard gegenüberstellen. Letzterer wird ja von libertären Kreisen immer wieder als Gegenentwurf zum heutigen System hochstilisiert, während die Unterschiede in Wahrheit marginal waren und sind. Zwar ist der Goldstandard zweifellos die stabilste Form des Kapitalismus, da er den Staat im Anhäufen von Schulden beschränkt und Kreditkrisen in kürzeren Intervallen, dafür aber mit milderer Intensität bzw. kürzerer Dauer einleitet, als das im entfesselten Kapitalismus der Fall ist.1 Doch wie wir bald begreifen werden, kann auch dieser nur ein Zwischenstadium sein, das systemimmanent zum heutigen Geldwesen und schließlich in den Untergang führt.
Der Kapitalismus
– ein System, das funktioniert.
Paul C. Martin (Buchtitel)
Nach der Erfahrungsschuld, die sich aufteilt in die Schuld der Leere,1 zu sein und die Schuld des Seins, wieder Vollständigkeit (Leere) zu erlangen, zieht sich diese Schuld fraktal weiter bis zur Urschuld, aus der nach Katastrophen oder Landmangel die organisierte Gewalt erwächst. Die Abgabenschuld, zu deren dauerhafter Tilgung der unterworfene Stamm dem Sieger verpflichtet ist, bildet den Startschuss auf dem langen Weg zum modernen Kapitalismus.
In der Frühzeit der Staatenhistorie war die Abgabe, ergo Geld, selbst eine Ware und mit dieser Ware wurde die Schuld der Obrigkeit gegenüber getilgt. Im Zuge der sukzessiven Entstehung von Eigentum »durch Revolution gegen den feudalen Staat von unten oder Reformen durch diesen von oben«2 kam es zu Kontraktschulden, d.h. zu Verträgen zwischen Privaten, um die Abgabe zu erwirtschaften. Rekapitulieren wir hierfür noch einmal das Beispiel mit dem Wechsel: Der Schuldner A schuldet dem Gläubiger B eine bestimmte Menge des Abgabenguts (z.B. Gold) und es wird ein Wechsel ausgestellt, auf dem die zu zahlende Summe zum Zeitpunkt X vermerkt ist. Der Gläubiger B kann nun diesen Wechsel weiter für Zahlungen unter Privaten verwenden (Zession), wenn er jemanden findet, der ihn gegen einen Abschlag (Diskont, aus dem der Zins hervorgeht) als Zahlung akzeptiert. Damit dieser neue Gläubiger C – der natürlich ebenso eine Geschäftsbank sein kann – nun den Wechsel von B annimmt, muss B selbst wiederum mit seinem Eigentum haften. C kann nun mit diesem Wechsel seinerseits bezahlen, wenn er mit seinem Eigentum haftet. Je mehr Schuldner nun auf dem Wechsel vermerkt sind (Indossament), desto »umlauffähiger« wird dieser Wechsel, d.h. desto mehr wird er als Geld unter Privaten akzeptiert, da der Gläubiger jeden vermerkten Schuldner von Staats wegen zwangsvollstrecken lassen kann. Was wir hier beschrieben haben, ist im Prinzip nichts anderes als die Entstehung von Giralgeld. Tatsächlich operieren nämlich die Geschäftsbanken nach demselben Prinzip bei der Kreditvergabe. Sie ziehen sozusagen einen Wechsel auf sich selbst (Solawechsel, Finanzwechsel) und begeben diesen »auf Sicht«, gegen Hereinnahme von Sicherheiten des Kreditnehmers.
Um die Dinge nicht unnötig zu verkomplizieren, erklären wir die realen Abläufe anhand zweier Privatpersonen. Person A will sich Geld leihen von Person B(ank). B hat aber gerade nicht so viel Bargeld flüssig, dafür aber Vermögenswerte in Millionenhöhe. Da Person B eine reiche, angesehene Person ist, der man gemeinhin vertraut1 und eine hohe Bonität unterstellt, gibt B dem Kreditnehmer A kein Geld, sondern einen Schuldtitel (Forderung) auf Geld, d.h. sie schreibt die Kreditsumme auf diesen Schuldtitel und verpflichtet sich, dass sie diesen, wenn er ihr vorgelegt wird (auf Sicht), in Bargeld umwandelt. B haftet also mit seinem Vermögen für die Einlösung des Schuldtitels. Im Gegenzug haftet A für die Rückzahlung des Kredits mit seinen Sicherheiten, die er als Pfand hinterlegt. A kann nun mit diesem Schuldschein bei einem Händler einkaufen gehen, da dieser darauf vertraut, dass B ihm das Geld auszahlen wird, wenn er es benötigt. Ebenso aber könnte sich der Händler den Schuldschein einbehalten und seinerseits damit zahlen. Exakt das passiert beim Giralgeld (auch Buchgeld oder Sichteinlage genannt). Die Geschäftsbanken belasten bei der Kreditvergabe ihr Vermögen (Aktiva in Form von Eigentum, Wertpapieren und Forderungen gegenüber anderen Schuldnern) und räumen dem Kreditnehmer die Kreditsumme als Sichteinlage ein. Diese Sichteinlage ist kein (!) Geld, sondern eine Forderung, die auf Wunsch in Geld auszubezahlen ist. Der Kreditnehmer gibt dieses Giralgeld am Markt aus, wo es auf ein anderes Konto einer anderen Person als Guthaben wandert. Der Inhaber dieses Kontos kann sich dieses Giralgeld nun entweder in bar ausbezahlen lassen2, oder – was heute eher üblich ist – er belässt das Giralgeld auf seinem Konto, um damit seinerseits Zahlungen vornehmen zu können. Um das also nochmal klar zu sagen: Mit diesem Akt der Verschuldung entsteht privates Geld (= Forderung auf »echtes« Geld, d.h. goldgedecktes oder ungedecktes Bargeld bzw. gesetzliches Zahlungsmittel).
Um das Bankengeschäft wirklich zu begreifen, bleiben wir in unserem mikroökonomischen Beispiel: Die wohlhabende Person B hat also der Privatperson A durch Belastung ihres Vermögens Kredit eingeräumt und A geht mit diesem Schuldtitel beim Händler einkaufen.
Dieser akzeptiert den Schuldtitel von B, weil jeder in der Region weiß, dass B vertrauenswürdig ist. Der Händler kann aber nun mit diesem Schuldtitel zu B gehen, um sich sein Geld ausbezahlen zu lassen. B, der nach wie vor kein Bargeld flüssig hat, hat nun zwei Möglichkeiten, wie er an Bargeld kommt, um es dem Händler auszubezahlen:
1) Er könnte entweder Vermögenswerte am Markt verkaufen und so zu Bargeld kommen.
2) Er könnte den Schuldtitel annehmen und sich jemanden suchen, der diesen Schuldtitel während der Laufzeit des Kredits von A gegen Hereinnahme zu Bargeld macht. Das ist der berühmte »Dritte«, der in Paul C. Martins Beispiel einen Wechsel diskontiert. Dieser Dritte würde den Schuldtitel natürlich nicht ohne Eigennutz zu Bargeld machen, sondern gegen einen Zins (in unserem Beispiel aufgeschlagen statt diskontiert). Sobald der Kreditnehmer A nach der Fälligkeit seines Kredits der wohlhabenden Person B seinen gesamten Kredit samt Zinsen in bar überreicht hat (in Raten oder endfällig), geht Person B zum Dritten, gibt ihm das Bargeld von A (zuzüglich des verlangten Zinses), nimmt seinen Schuldtitel wieder zurück und vernichtet ihn.
Dieses Beschaffen von gesetzlichem Zahlungsmittel (Bargeld) nennt sich »Refinanzierung« und wird im modernen Geldsystem von den Zentralbanken (Bank der Banken) ermöglicht. Sie sind dieser Dritte, der entweder Vermögenswerte der Geschäftsbanken gegen Bargeld aufkauft (üblicherweise nur zeitlich befristet gegen eine Rückkaufvereinbarung) oder eben einen Schuldtitel der Geschäftsbank während der Laufzeit gegen einen Leitzins in Bargeld umwandelt. Dieser Punkt ist tatsächlich auch der einzige fundamentale rechtliche Unterschied zwischen der Kreditvergabe von Privatpersonen und der Kreditvergabe von Geschäftsbanken. Privatpersonen müssen sich diesen Dritten am Markt suchen, Geschäftsbanken haben darüber hinaus die Zentralbank.
Es gibt aber auch noch eine dritte Möglichkeit, wie B den Händler zufriedenstellen kann, und diese dritte Möglichkeit kennt jeder von uns, auch wenn er noch nie bewusst darüber reflektiert hat: Er bietet dem Händler an, den Schuldtitel hereinzunehmen und zu verzinsen, wenn dieser im Gegenzug vorerst auf eine Auszahlung verzichtet. Das ist der Grund für die (geringe) Verzinsung von Giralgeld am Konto oder auf Sparbüchern1. Die Bank erspart sich durch eine Verzinsung der Giralgeldguthaben die Refinanzierungskosten, weil dadurch viel weniger Menschen ihr Geld in bar nachfragen. Daneben müsste eine Geschäftsbank Giralgeldabflüsse, die durch eine Überweisung von einer Geschäftsbank zur anderen stattfinden, beim sogenannten »Clearing« in Zentralbankgeld ausgleichen. Auch das soll durch eine positive Zinszahlung verhindert werden. So viel Vertrauen haben eben die Geschäftsbanken untereinander nicht, dass sie fremdes Giralgeld akzeptieren. In unserem Beispiel hat die wohlhabende Person B die Refinanzierungskosten (anfallende Kosten bei Veräußerung von Vermögenswerten bzw. Zinszahlung an den Dritten zur Erlangung von Bargeld), bzw. die Zinskosten für den Verzicht auf die Auszahlung des Schuldtitelhalters, bereits zu Beginn dem A auf seinen Zins aufgeschlagen.1 Sie rechnet also von Anfang an damit, dass der Schuldtitel noch vor Fälligkeit auf Sicht vorgelegt und die Ausbezahlung verlangt wird. Dasselbe machen die Geschäftsbanken. Auch sie schlagen dem Kreditnehmer etwaige Refinanzierungskosten auf seinen Zins auf. Deshalb ist es Zentralbanken möglich, durch eine Änderung des Leitzinses (= Kosten für die Refinanzierung der Geschäftsbanken) indirekt Einfluss auf die Kreditvergabe zu nehmen. Erhöht sie den Leitzinssatz, wird dieser von den Geschäftsbanken an die Kreditnehmer weitergegeben und drosselt so die Kreditvergabe.
Das »echte« Geld, das sogenannte »gesetzliche Zahlungsmittel«, wird also, neben dem Verkauf von Vermögenswerten der Geschäftsbank an die Zentralbank, hauptsächlich gegen Hereinnahme notenbankfähiger Sicherheiten2 der Geschäftsbanken »verliehen«3, d.h. hier treten die Geschäftsbanken als Schuldner auf, hinterlegen Sicherheiten bei der Zentralbank und bekommen dafür gesetzliches Zahlungsmittel in der Höhe des Werts der beliehenen Sicherheit. Geld – gleichgültig ob Giralgeld oder gesetzliches Zahlungsmittel – entsteht also stets durch einen Gläubiger-Schuldner-Kontrakt und verschwindet, wenn der Kredit getilgt ist: Tilgt der Kreditnehmer seinen Kredit, verschwindet auch das Giralgeld. Zahlt die Geschäftsbank ihr geliehenes Bargeld an die Zentralbank zurück und löst damit ihre Sicherheiten aus, verschwindet auch das Bargeld in den Tresoren der Zentralbank. Geld entsteht im Kapitalismus also immer durch ein Rechtsgeschäft zwischen Gläubiger (die Geschäftsbank oder die Notenbank) und Schuldner (der Kreditnehmer oder die Geschäftsbank). Es erblickt durch einen kreditären Akt das Licht der Welt und verschwindet nach Tilgung der Schuld im Nichts, aus dem es kam.
Wenn also grundsätzlich jeder Giralgeld erzeugen kann, warum konzentriert sich die Geldschöpfung dann fast ausschließlich bei den Geschäftsbanken? Was macht eine Geschäftsbank zu etwas Besonderem? Nun, wie wir gesehen haben, wird das Giralgeld ja vom Schuldner am Markt ausgegeben, d.h. irgendjemand hat dann den aufgenommenen Kredit des Schuldners in seiner Hand bzw. auf seinem Konto. Ein Gläubiger einer traditionellen Wechselforderung kann in das Vermögen eines, bestenfalls mehrerer Indossanten zwangsvollstrecken. Reichen die Sicherheiten nicht bzw. sind diese stark im Wert gefallen, fährt der Gläubiger einen Verlust ein. Ein Gläubiger eines »Bankwechsels« dagegen kann in das Vermögen der gesamten Bank zwangsvollstrecken, mit dem sie für diese Forderung (lautend auf Bargeld) haftet. Geht nämlich der Kreditnehmer, der das Giralgeld zusammen mit der Geschäftsbank geschaffen hat, pleite, muss die Geschäftsbank diesen Verlust bilanziell anderweitig ausgleichen, notfalls mit ihrer Gewinnrücklage. Sie haftet also für die Werthaltigkeit des von ihr ausgegebenen Giralgeldes und sie muss stets genügend notenbankfähige Pfänder auf ihrer Aktiv-Seite haben, um die Nachfrage nach Bargeld bedienen zu können.
Daneben bezahlen Geschäftsbanken auch beim Ankauf von Wertpapieren oder Sachvermögen mit neu erschaffenem Geld, aber auch hier müssen sich Vermögen und Verbindlichkeiten der Bankbilanzen die Waage halten, d.h. jede Kreditvergabe und jeder Ankauf von Wertpapieren oder Sachvermögen stellt eine Bilanzverlängerung dar, während jede Kredittilgung oder der Verkauf von Wertpapieren oder Sachvermögen einer Bilanzverkürzung entspricht. Dem Vermögen einer Geschäftsbank (Kreditforderungen, Wertpapiere, Sachvermögen) stehen also immer Verbindlichkeiten in gleicher Höhe gegenüber. Das bedeutet, dass eine Geschäftsbank natürlich nicht nach Belieben die halbe Welt mit neu geschöpftem Giralgeld aufkaufen kann – verringert sich nämlich nach Ankauf der Preis der Sachvermögen oder Wertpapiere, entsteht ein Ungleichgewicht in der Bankbilanz, das die Bank mit ihrem eigenen Geld (Gewinnrücklage) bzw. ihrem Eigenkapital decken muss. Kann sie das nicht, ist sie pleite. Wenn also eine Bank Vermögenswerte mit frisch gedrucktem Geld aufkauft, ist sie zwar Eigentümerin dieser Vermögenswerte, sie hat aber gleichzeitig Verbindlichkeiten in der gleichen Höhe in ihrer Bilanz stehen. Sie hat somit keinerlei Gewinn damit gemacht. Erst wenn diese Vermögenswerte im Preis steigen, hat sie Gewinn. Sinken sie, muss sie Verluste schreiben.
Diese – schon allein anhand der Bankbilanzen – leicht nachprüfbare Tatsache wird von neoklassischen und libertären Ökonomen, die in Geld einfach ein Tauschmittel, d.h. de facto eine Ware sehen, einerseits völlig ignoriert und von Verschwörungstheoretikern – die ironischerweise im Gegensatz zur etablierten Lehre den Elefanten im Raum beim Namen nennen – wiederum als gigantischer Betrug angeprangert. Letztere sprechen dann gern von »Fiatgeld1«, d.h. von Geld aus dem Nichts, das seinen Wert nur durch den Glauben an diesen Wert erhält, während Warengeld (wie Gold) einen »intrinsischen Wert« hätte, weil es erst durch Arbeitsaufwand aus dem Boden geholt wurde. Wie wir im Laufe dieses Kapitels sehen werden, könnte nichts ferner von der Wahrheit sein, da Geld anders als auf Basis eines Gläubiger-Schuldner-Kontrakts gar nicht vorstellbar ist. Ja, Banken schaffen Giralgeld tatsächlich aus dem Nichts, sie tun dies aber gänzlich innerhalb der Rechtssphäre zwischen zwei freien Rechtssubjekten, indem auf beiden Seiten Vermögen belastet wird, um Forderungen und Verbindlichkeiten zu erstellen. Wir haben es hier also mit einem gewöhnlichen Rechtsgeschäft zu tun, das auch zwei Privatpersonen abschließen könnten, wie wir am Beispiel der Kreditschöpfung gesehen haben. Ebenso kann eine Privatperson A ihr Vermögen belasten, einen Schuldtitel ausstellen und damit beispielsweise ein Haus kaufen, wenn dieser Schuldtitel aufgrund des Vertrauens zu A als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Auch wenn A nun Eigentümer eines Hauses ist, ist dabei sein Vermögen zu keinem Zeitpunkt angewachsen, weil er ja auf der Passiv-Seite der Bilanz eine Verbindlichkeit lautend auf gesetzliches Zahlungsmittel offen hat (Bilanzverlängerung). Der Halter des Schuldtitels (der Verkäufer des Hauses) kann nämlich jederzeit (oder nach Fälligkeit) die Herausgabe von Bargeld verlangen und wenn A dieses nicht vorweisen kann, muss er Vermögenswerte veräußern, beispielsweise sein gerade eben gekauftes Haus (Bilanzverkürzung). Anders als also die Mainstream-Ökonomie suggeriert, benötigen Geschäftsbanken für die Schaffung von Giralgeld keine Spareinlagen, sondern Vermögenswerte. Sie verleihen keine Spareinlagen weiter, sondern schaffen durch die Belastung von Vermögen Forderungen auf Geld, die erst danach (!) ihren Weg auf ein Bankkonto finden können, wenn etwa der Kreditnehmer mit dem so geschöpften Geld beim Händler Waren kauft und ihm dieses Geld auf sein Konto überweist. Mit der von Libertären und Verschwörungstheoretikern heftig kritisierten »multiplen Geldschöpfung« – das angeblich mehrfache Verleihen der Spareinlagen – hat das allerdings nichts zu tun. Wie soll ein Passivum wie eine Sichteinlage überhaupt verliehen werden können?2 Bargeld wäre ein Aktivum, das verliehen werden könnte, aber auch hier haben wir es mit simplen Buchungssätzen zu tun. Bargeld wird eingezahlt und dem Einzahler die entsprechende Summe als verzinstes Giralgeld auf der Passivseite (!) der Bankbilanz eingeräumt, da die Bank ja nun dem Einzahler das Bargeld, ergo gesetzliches Zahlungsmittel schuldet. Auf der Aktivseite der Bankbilanz steht nun das Bargeld. Die Bilanz ist also wieder ausgeglichen. Kommt nun ein Kreditnehmer, würde wieder ein neuer Posten an Forderungen und Verbindlichkeiten eröffnet. Mit der vorangegangenen Bargeldeinzahlung hat dieser nichts mehr zu tun und realiter, ohne historische Vergleiche mit dem Wechselgeschäft, funktioniert eine Kreditaufnahme heute tatsächlich so: A will einen Kredit über 1 Million Euro. Die Bank prüft seine Bonität, A stellt noch die geforderten Sicherheiten und schon wird ihm der Kredit eingeräumt. Aktiv schreibt die Bank die Forderung an den Kreditnehmer zur Tilgung seines Kredits und passiv die Verbindlichkeit, das Giralgeld in gesetzlichem Zahlungsmittel auszubezahlen. Das ist schon alles. Einbezahltes Bargeld wird die Bank, sofern die Mindestreservepflicht eingehalten und der Kassabestand für das alltägliche Bankgeschäft ausreicht, nicht in irgendwelchen Tresoren verwahren und in der Bilanz behalten, sondern der jeweiligen Zentralbank zur Auslösung von Pfändern zurückzahlen, die sie einst dort deponierte, um Bargeld im Wert des Pfandes beziehen zu können. Das erspart ihr die Refinanzierungskosten, d.h. den Leitzins – den Zins zur Erhaltung des gesetzlichen Zahlungsmittels, ergo Zins 2 bzw. eine Steuer 2, die, entgegen der Desinformationskampgane verschwörungstheoretischer Kreise, nicht von Privatpersonen einbehalten, sondern wieder an den Staat ausgeschüttet wird. Was Geschäftsbanken machen, ist also keine moderne Alchemie, wie das so oft kolportiert wird. Es ist das Wesen von Geld, Schuldbeziehungen nicht bloß in unseren Köpfen zu verbuchen, sondern zu dokumentieren und schließlich durch Zession kurant (umlauffähig) zu machen. Nichts anderes tun Geschäftsbanken. Halten wir also fest: Eine Geschäftsbank benötigt keinerlei Spareinlagen, um Kredite zu vergeben oder anders formuliert: Niemand, der einen Wechsel auf einen Schuldner zieht, benötigt dafür Spareinlagen.
Der hier beschriebene Mechanismus ist sowohl in einem Goldstandard als auch in unserem heutigen System freier Wechselkurse ident. Anders als sich das neoklassische Ökonomen gerne vorstellen, wurde im Goldstandard nicht Gold gegen Waren und Dienstleistungen getauscht, sondern es war ebenso Schuldentilgungsmittel für offene Steuer- oder Kontraktschulden, wie das Giral- und Bargeld heute ist. Und da sich Geschäftsbanken, ebenso wie heute, bei der Zentralbank durch Hinterlegung eines Schuldtitels gegen einen Zinssatz (bzw. Diskontsatz) refinanzieren mussten, um an goldgedecktes Bargeld zu kommen, wirkte die limitierte Goldmenge (je weniger Gold zur Deckung in den Tresoren der Zentralbank lag, desto höher der Zinssatz für das verausgabte Bargeld) indirekt dämpfend auf das Kreditangebot bzw. die Kreditnachfrage der Geschäftsbanken, da diese den Zinssatz natürlich an ihre Kunden weiterreichten. Diesen fundamentalen Unterschied, den Edelmetall-Anhänger gern zwischen dem modernen Kapitalismus und einem Warengeldstandard sehen, gibt es so nicht. Der einzige Unterschied bestand darin, dass die Notenbanken nicht nach Belieben an der Zinsschraube drehen konnten – das wurde durch die vorhandene Goldmenge geregelt.
Um das besser zu verstehen, müssen wir uns den Unterschied zwischen dem von den Geschäftsbanken geschöpften Giralgeld/Buchgeld und dem von den Zentralbanken geschöpften Bargeld genauer ansehen. Stellen wir uns hierfür einen idealen Goldstandard vor, mit einer Golddeckung von 100%. In einem solchen System wäre Gold (oder zu 100% mit Gold gedeckte Banknoten) das Steuertilgungsmittel, um die Schuld dem Staat gegenüber Monat für Monat zu tilgen. Das Bargeld wäre in diesem System die Goldmünze, die ihren Wert durch den Nachfragezwang (Steuertilgungsmittel) zum Termin erhält. Damit nun die Marktteilnehmer ihre Steuerschuld Monat für Monat mit Gold tilgen können, müssen sie Waren und Dienstleistungen erwirtschaften und gegen Gold als Zahlungsmittel anbieten, ergo sie müssen den Steuersatz 1: 1 in Wirtschaftsleistung umwandeln, was Preise schafft und dem Gold seine Wertstabilität verleiht. Da aber nicht alle Wirtschaftssubjekte gleichzeitig genug Gold erwirtschaften werden, um ihre Urschuld und Steuerschuld zum Termin leisten zu können – und zwar nicht allein deshalb, weil sie schlecht gewirtschaftet hatten oder sich das Gold im Kapitalismus systemimmanent in der reichen Schicht konzentriert und deshalb in den unteren Schichten fehlt, sondern weil, wie wir später sehen werden, eine vollständige Tilgung grundsätzlich unmöglich ist – wird es zu Leihgeschäften zwischen Privaten kommen. Derjenige, der Gold zum Termin benötigt, wird sich dieses von jemandem leihen, der es im Überschuss vorrätig hat. Das ist nichts anderes als eine Geldleihe, wie sie etwa auch eine Anleihe darstellt, die ebenfalls am Markt weitergehandelt werden kann. Wer allerdings ein Unternehmen vorfinanzieren will, von dem er sich in Zukunft ein großzügigeres Einkommen in Gold verspricht, wird sich den entsprechenden Kredit wiederum über eine Geschäftsbank besorgen, d.h. durch Belastung von Vermögen des Gläubigers (Geschäftsbank) und des Schuldners. Ein Goldstandard mit 100% Deckung ist in einer Eigentumsgesellschaft (!) deshalb der Garant schlechthin für die Entstehung des von Libertären so verhassten Kreditgeldes, weil es in einem solchen System gar keine andere Ausweichmöglichkeit für Privatpersonen gibt, um an genügend Zahlungsmittel zu kommen – anders als beispielsweise in den Anfängen der Staatenhistorie, wo es nur zarte Ansätze von Privateigentum gab. So lässt sich die einfache Geldleihe in Mesopotamien bereits 3000 v. Chr. belegen, vor allem mit der zunehmenden Bedeutung der Tempelbank spätestens seit dem 2. Jt. v. Chr., die das Abgabengut Silber gegen Zins verlieh (Geldleihe). Die Sicherheit, die der Tempelbank angedient wurde, war, wie bereits dargelegt, meist das Eigentum an sich selbst, d.h. die Schuldknechtschaft im Falle der Nichttilgung. Ob es in Mesopotamien bereits Kredite gab, d.h. privat geschöpftes Geld in Form von Wechseln, ist ein Streitthema weniger Gelehrter weltweit, die sowohl historisch als auch ökonomisch bewandert sind, und zielt vor allem auf die Frage ab, wie es mit der Verteilung des Privateigentums bestellt war, das wohl eher der Oberschicht und den Kaufleuten (Verbindungsmänner zwischen Palast und Welthandel) vorbehalten war. Aber bereits in der griechischen Antike lässt sich das Geflecht aus Eigentum, Vertragsfreiheit und Kredit zweifelsfrei nachweisen, und die Römer verfügten über einen voll ausgereiften Kapitalismus. Die Ironie an der Sache ist, dass ohne den von Libertären so verhassten Staat nicht nur kein von ihnen so geheiligtes Eigentum definierbar ist, sondern dass dieses Eigentum letztlich sogar Ursache und Voraussetzung für die Entstehung des heftig kritisierten privat geschöpften Kredites ist.
Dieses dem Kapitalismus (Debitismus) inhärente Prinzip aus Abgabenschulden dem Staat gegenüber auf der einen Seite und Kontraktschulden zwischen Privaten auf Basis von Eigentumsrechten auf der anderen Seite ist der Ursprung unseres modernen zweistufigen Bankensystems. Beide Rechtssphären muss man sich getrennt voneinander vorstellen, und daran ändert auch ein Goldstandard nicht das Geringste.1 Muss man sich doch, im Gegenteil, die Frage stellen, wie Gold überhaupt gefördert werden soll, wenn nicht durch eine – notwendigerweise – nicht goldgedeckte Vorfinanzierung der betreffenden Goldmine. Oder wie Martin hierzu in Gewaltmetall Gold erklärt: »Es ist äußerst wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass auch in einem System mit Unter-100%-Golddeckung Banknoten nicht etwa ›als solche‹ verliehen werden, sondern immer nur gegen Pfand (andere ›Ware‹ in relativ stetigem Verhältnis zum Gold) bzw. dem Versprechen als Sicherheit, letztlich in etwas zurückzuzahlen, was in letzter Konsequenz wieder nur Gold sein kann. Man macht sich das am einfachsten klar, indem man auf der einen Seite ein Depot nimmt, das Marken mit 100% Deckung ausgibt und dann 10% zusätzliche Marken an ein Goldbergwerk ausgibt, das als Sicherheit das Versprechen im Depot (in Form eines Wechsels z.B.) hinterlegt, die 10% nach abgeschlossener Produktion zurückzugeben. Dann hat das Depot nach Ablauf des Versprechens 110% Deckung und kann weitere 10% Depositenscheine ausgeben bzw. die zehn Prozent zusätzlichen Metalls direkt ausgeben – als Kredit, der wiederum durch Pfand bzw. ein neues Zahlungsversprechen eines anderen besichert sein muss. Auf einen solchen Vorgang weist die […] vorgestellte Tontafel (Herkunft Mesopotamien, Anm. des Autors) hin, wo der Tempel (Bank) an einen Zalilum 6 Shekel Silber verleiht, wobei der Kaufmann Agaya 5 Ar (»acres«) seines Feldes verpfändet. Abgesehen von der hier zunächst nicht weiter zu interessierenden Zinsfrage zeigt dieser Vorgang deutlich, dass die Hergabe von Silber (man könnte wahlweise einen Depotschein nehmen) seitens eines Depots nur möglich ist, nachdem Pfand geleistet wurde. Dieser Vorgang führt direkt zu Banknoten in heute aktuellen Geldsystemen, die ausschließlich gegen auf Pfandkonten der Notenbank liegende Sicherheiten erfolgt.«
Um ein Gefühl für die Abläufe zu bekommen, stellen wir uns ein Geldsystem mit partieller Golddeckung, d.h. unter 100%, vor, wie es im klassischen Goldstandard Usus war. Hier haben wir auf der einen Seite die Zentralbank, deren Aufgabe die Emission goldgedeckter Banknoten ist. Bei einer Deckung von 50% hätte die Notenbank die Aufgabe, Bargeld zu emittieren, das zu 50% mit Gold gedeckt ist, welches in den Tresoren der Notenbank schlummert. Will nun eine Geschäftsbank Banknoten (Bargeld), müsste sie sich entweder irgendwo Gold besorgen und es bei der Notenbank gegen Bargeld tauschen, oder aber sie hinterlegt z.B. einen Wechsel mit Rückzahlungsversprechen zu einem definierten Termin und »borgt« sich die Banknoten. Diese Refinanzierungsgeschäfte zwischen Geschäftsbank und Notenbank unterscheiden sich damit kaum von den Geschäften zwischen Kunden und Geschäftsbank. Sieht man vom fundamentalen Unterschied ab, dass eine Zentralbank zwar in bilanzielle Schieflage geraten, aber nicht pleitegehen kann (so genügen Gesetzesänderungen, um die Bonitätsstufe notenbankfähiger Sicherheiten aufzuweichen oder im Krisenfall ganz abzuschaffen; siehe die später vertiefenden Erläuterungen zu »Nettogeld«), besteht eine andere Abweichung darin, dass die Notenbank grundsätzlich nur Bargeld in der Höhe des Pfands (z.B. Wechsel) gewährt, während eine Geschäftsbank heute mehr Giralgeld gutschreibt, als das vom Kreditnehmer hinterlegte Pfand wert ist, was, wie wir später noch sehen werden, systemimmanent passieren muss und auch rechtlich kein Problem darstellt, solange sie genügend Vermögenswerte (Aktiva) vorweisen kann, um für den Ausfall des Schuldners geradezustehen. Ob und welche Pfänder zu welchem Wert der Schuldner hinterlegt, ist allein Sache der Geschäftsbank.
Fassen wir also noch einmal zusammen, bevor wir uns dem gegenwärtigen Geldsystem zuwenden: Am Anfang steht die Urschuld. Aus einer Not heraus oder dem Drang, die Urschuld dauerhaft zu bedienen, resultiert ein Gewaltakt. Ein Stamm oder Volk wird unterworfen und tributpflichtig gemacht. Das Abgabentilgungsmittel zum Termin wird zu Geld. Erst wenn also eine Schuld (Steuerschuld) zum Termin offen ist, ist Geld definierbar. Um die Steuerschuld zu bedienen, kommt es zum Abschließen von Verträgen zwischen Privaten zur Erwirtschaftung der Abgabe. Aus einer Not heraus oder dem Drang, die Urschuld und Steuerschuld dauerhaft zu bedienen, kommt es zuerst zur Geldleihe und nach Etablierung von Privateigentum zum Kredit, d.h. zu eigentumsgedeckten Schuldtiteln mit Fälligkeit (Termin!), die zediert werden. Auch Giralgeld ist damit nur dadurch definierbar, dass es zum Termin wieder zurückgefordert wird. Es wird dem Kreditnehmer von der Geschäftsbank eingeräumt und muss zum Fälligkeitstermin (monatliche Kreditrate bzw. Kredittilgung am Ende der Laufzeit) wieder zur Bank zurück, wo es im Nichts verschwindet, aus dem es kam, d.h. nach Leistung wertlos verfällt. Giralgeld ist immer eine Forderung auf das Steuertilgungsmittel. Würde ein Kreditnehmer oder Sparer einer Geschäftsbank sein Giralgeld in goldgedecktes Bargeld ausbezahlt haben wollen, so müsste die Geschäftsbank, wenn sie nicht gerade physisches Gold lagernd hat oder Sachwerte gegen Gold verkauft, notenbankfähige Schuldtitel1 (mit Fälligkeitstermin!) bei der Notenbank hinterlegen und dafür Bargeld (mit 50% Golddeckung) in Höhe des Schuldtitels bekommen, um dieses dem Sparer oder Kreditnehmer auszuzahlen. Diese Menge an Bargeld müsste die Bank spätestens einen Tag vor Fälligkeit des hinterlegten Schuldtitels wieder an die Notenbank zurückzahlen, um den Schuldtitel auszulösen. Über den Zinssatz für das Halten des von ihr verausgabten Bargeldes reguliert die Notenbank indirekt die Kreditvergabe der Geschäftsbanken, sodass diese bei steigenden Zinsen die Nachfrage nach Bargeld drosseln. Auf diese Weise soll die Golddeckung nie die 50% unterschreiten. Wichtig ist auch hier, dass das Gold selbst keinen Wert an sich hat, sondern nur als Schuldentilgungsmittel fungiert. Nachgefragt wird das Gold (abgesehen von seiner Verwendung als Schmuck) nur deshalb, weil es der Staat als Steuer verlangt und Kredite damit getilgt werden, aber einen Wert im Verhältnis zu allen anderen Gütern erhält es erst durch die zwingend aus den Schuldkontrakten resultierende Leistung (Wirtschaftswachstum), worauf wir im Detail noch zurückkommen. Die Goldhinterlegung wirkte letztendlich also nur als Bremse für das Kreditwachstum – mehr nicht!
In einem System flexibler Wechselkurse ohne Edelmetall-Deckung funktioniert die Bargeldschöpfung genauso: Hier hinterlegen Geschäftsbanken notenbankfähige Pfänder2 (z.B. Wechsel, Kreditforderungen, Wertpapiere etc.) bei der Notenbank, d.h. sie belasten ihr Vermögen und bekommen dafür von der Notenbank verzinstes Bargeld im Wert des Pfandes gutgeschrieben (Aktivtausch), das die Geschäftsbank nun beispielsweise einem Kunden aushändigen kann. Bargeld ist also in krisenfreien Zeiten vollständig gedeckt mit Vermögenswerten bzw. Schuldtiteln höchster Bonität, da die Zentralbank an ihre Pfänder wesentlich strengere und konservativere Kriterien anlegt als die Geschäftsbank an die Pfänder ihrer Kunden. Am Fälligkeitstermin des Pfandes muss das Bargeld samt Zins allerdings wieder zurück zur Notenbank, das Pfand wird ausgelöst und wandert wieder auf die Aktiv-Seite der Geschäftsbank-Bilanz und das nun wertlose Bargeld wird von der Notenbank im Tresor verwahrt oder bei Abnutzungserscheinungen physisch verbrannt. Wer also Bargeld auf sein Konto einzahlt, der spart3 es nicht in irgendeinem Tresor, sondern gibt der Geschäftsbank die Möglichkeit, ihre »Kredite« bei der Zentralbank zu begleichen und ihre Pfänder auszulösen oder aber ihre Mindestreserve oder Barreserve aufzustocken. Die Geschäftsbank räumt dem Einzahler wiederum nur ein Sichtguthaben ein, d.h. nur Forderungen auf Geld, die sofort verfallen, wenn die Bank pleitegeht. Geld zirkuliert also nicht im Wirtschaftsraum, wie sich das die Neoklassiker ausmalen, sondern es entsteht durch eine dokumentierte Schuld und wird mit Tilgung derselben, zusammen mit dem Schuldtitel, wieder vernichtet. Immer ist also der Kredit des einen das Guthaben des anderen und beide saldieren sich zu null1. Guthaben und Schulden sind also immer zwei Seiten einer Medaille. Es kann das eine ohne das andere nicht geben. Wären alle Kredite beglichen, gäbe es kein Geld mehr und ohne Geld keine Preise. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es kein Geld netto gibt, d.h. Geld, das ohne Schulden auf der anderen Seite der Bilanz geschaffen wurde. Geld bezahlt immer nur Schulden, gleichgültig ob sein Träger Gold oder Papier ist.
Damit Geld definierbar ist, muss dafür also immer eine Schuld auf der anderen Seite der Bilanz offen sein? Warum kann Geld nicht einfach Tauschmittel sein, wie man sich das intuitiv gerne vorstellt? Vielen Absolventen eines VWL-Studiums geht der Knoten im Kopf auch dann nicht auf, wenn sie das Geschriebene als wahr begriffen haben, weshalb sie schließlich beginnen, utopische Tauschökonomien (beliebt sind durchexzerzierte »Inselbeispiele«) zu entwerfen, um ein grundsätzliches Funktionieren einer solchen zu beweisen. Doch auch hier laufen wir, gleichgültig, wie man es dreht und wendet, immer wieder in das gleiche Dilemma. Stellen wir uns eine einsame Insel vor, deren Bewohner alle die gleiche Menge Gold besitzen und mit dieser nun beginnen sollen, Tauschhandel zu treiben. Wir müssen hierfür zuerst schon einmal ausblenden, dass es ohne eine Obrigkeit, die Gold als Zwangsabgabe fordert, für unsere Inselbewohner keinen Grund gibt, sich nicht zu einer kooperierenden Solidargemeinschaft zusammenzuschließen, anstatt sich individuell zu spezialisieren und sinnlos zueinander in Konkurrenz zu treten. In einer Solidargemeinschaft aber braucht es kein Geld und gab es auch noch nie eines. Ebenso seltsam ist es, dass die Inselbewohner ein Metall zum ultimativen Tauschmittel auserwählen, das keinerlei Nutzwert hat und auch noch nie nachgefragt wurde, weil schlichtweg die abgabenfordernde Macht fehlt. Lassen wir aber auch diesen gewichtigen Einwand außen vor, so wird aber schnell klar, dass sich ohne diese obere Rechtsinstanz weder ein Eigentumsbegriff definieren lässt noch wäre die Vertragssicherheit gewährleistet. Letzendlich würde in so einem System das Recht des Stärkeren gelten. Auch diesen Einwand wollen wir ignorieren. Sofort ergibt sich aber ein neues Problem: Was soll Gold wert sein?
Wie kann etwas, das jeder zu gleichen Teilen besitzt, überhaupt von Wert sein? Und wenn wir diesem glitzernden Ding für unser Gedankenexperiment einen fiktiven Wert zugestehen wollen, wie sollen sich hieraus Tauschrelationen herauskristallisieren? Wie viel Brot bin ich bereit herzugeben für ein funkelndes Metall, das für mich ohne Nutzen ist? Und bekomme ich dieses auch wieder los? Wie viel an Mehrproduktion muss ich leisten, um genug Gold zu verdienen, um meine Urschuld zu bedienen? Und gilt mein Wertmaßstab dann auch für die anderen Teilnehmer? Wie wir sehen, hängen alle Marktteilnehmer vollkommen in der Luft, was die Preisrelationen der Güter untereinander betrifft und sie hängen vollkommen in der Luft, weil sie ja gar nicht wissen können, wie viel Gold insgesamt umläuft. Ihnen fehlt also bereits beim Zahlungsmittel selbst eine Vorstellung vom Angebots-Nachfrage-Gefüge. Der große Denkfehler libertärer Geldtheoretiker ist der, dass sie, anders als im Kapitalismus, wo Schuldgeld die Wirtschaftsleistung annähernd exakt abbildet (dazu gleich), auf der einen Seite Waren und Dienstleistungen haben, die nachgefragt werden und auf der anderen Seite eine Ware wie Gold, die im gleichen Maße nachgefragt werden muss und dem gleichen Nachfragedruck unterliegen müsste wie die Waren und Dienstleistungen, die man damit kaufen will. Hier stellt sich die berechtigte Frage, wer eigentlich was bewertet: Das Gold die Waren oder die Waren das Gold?
Die bittere Ironie an der Sache ist, dass exakt das, was die Libertären den Sozialisten vorwerfen – kein wertstabiles Geld zu haben –, noch viel mehr für ihre eigenen geldtheoretischen Hirngespinste gilt, denn den Sozialisten war diese Problematik wenigstens zum Teil bewusst. Auch sie suchten nach einem Wertmaßstab für ihr Geld und legten dafür – beispielsweise in der Sowjetunion – Arbeitseinheiten fest, die sich aus Arbeitsproduktivität (z.B. Einsatz von Technik etc.), Arbeitskraft, Arbeitsmittel bzw. Arbeitszeit zusammensetzten. Sie legten also Preise für ihre Produkte fest, die den Arbeitsaufwand, wenn man so will, ausdrücken sollten. Die Geldemission basierte auf der Summe all dieser festgelegten Preise. Deshalb war das sozialistische Geld auch kein Geld, sondern ein Gutschein, den man einlöste. Und obwohl die Sozialisten diesen Wertmaßstab schufen, gab es starke inflationäre Schübe und Mangelwirtschaft bis hin zu Hungerkatastrophen. Warum? Zum einen natürlich aufgrund der systemimmanenten Faulheit des sozialistischen Massenkollektivs und der fehlenden Innovationskraft (auf beides kommen wir im Kapitel »Der Sozialismus«. noch zu sprechen), zum anderen, weil auch mit diesem Wertmaßstab das Informationsproblem nicht gelöst werden konnte. Nur weil produzierte Güter bepreist werden und mit Gutscheinen (d.h. sozialistischem Geld) erworben werden können, heißt das ja noch lange nicht, dass alle Produkte gleichzeitig vom Markt geräumt werden. Es ist eine völlige Illusion, vorher wissen zu wollen, was später nachgefragt werden würde.1 Hätte jemand im Sozialismus den ganzen Tag über per Hand das Gras auf einer Weide ausgerupft, wäre dieses Gras nach der sozialistischen Bepreisungspolitik hoch bewertet worden. Wer aber hätte dieses Gras nachgefragt? Daran erkennt man auch, dass es so etwas wie einen »intrinsischen Wert« nicht gibt und auch nicht geben kann. Die Mühe und Arbeitsleistung, die hinter dem Abbau einer Unze Gold steckt, ist für den Markt völlig irrelevant, wenn das Gold nicht nachgefragt wird. Und wie wir gesehen haben, gibt es für die Nachfrage nach Gold (oder jeder anderen Recheneinheit, die nicht auf Schulden basiert) in einem libertären System keine Notwendigkeit – und selbst wenn es nachgefragt werden würde, dann nicht von allen und für jedes Tauschgeschäft im gleichen Maße. Die gesamte Wirtschaftsleistung dieses fiktiven libertären Systems könnte von Gold gar nicht erst abgebildet werden, da es im Idealfall (!) nur jene freiwilligen Tauschvorgänge erfassen könnte, die über die Subsistenz und den direkten Tausch »Ware gegen Ware« hinausgingen. Gold hätte in diesem System Schmuckwert, und wie hoch dieser in staatenlosen Gemeinschaften veranschlagt wird, durfte Kolumbus bei der Entdeckung Amerikas erleben, als er Glasperlen gegen Gold tauschen konnte. Den Indigenen gefielen Letztere einfach besser und etwas anderes interessierte sie nicht. Das Gold hatte keine Geldfunktion für sie, genauso wenig wie in jedem anderen akephalen Volk.1
Selbst in unserem abstrakten, die historischen Tatsachen verleugnenden Beispiel kommt man schnell zum Schluss, dass sich wohl eher etwas als Geld herauskristallisieren würde, das von tatsächlichem Nutzen ist, wie beispielsweise möglichst haltbare Nahrung, Baumaterial oder aber auch Drogen unterschiedlichster Art. Der synergetische Drang eines solchen Systems, wieder zu einer Solidargemeinschaft zu verschmelzen, kann nicht verleugnet werden. Und selbst wenn wir die Inselbewohner in unseren Köpfen mit aller Gewalt individuell produzieren oder gar wirtschaften lassen wollen, würden sie recht bald, anstatt sich weiter zu spezialisieren, zur individuellen Subsistenzwirtschaft zurückkehren und Selbstversorger werden. Getauscht würden dann bestenfalls Güter des täglichen Bedarfs, ohne dass sich daraus ein ultimatives Zahlungsmittel herauskristallisieren würde. Am ehesten würden sich auch in einem solchen künstlichen System Schuldscheine als
Das Ausland hätte dieses Geld nämlich sonst nicht angenommen und Gold hatte im Westen stets einen aktuellen Marktpreis, ausgedrückt in der jeweiligen Währung, oder einen Marktwert, wenn es zur Deckung von Schuldkontrakten verwendet wurde (Goldstandard). Um es also noch einmal ganz klar zu sagen: Das libertäre Geld, das sich Hayek, Rothbard und Co vorstellen, ist nicht einmal ansatzweise so wertstabil wie das sozialistische Geld. Genaugenommen ist es gar nichts wert.
Geld herauskristallisieren (Du gibst mir x, dafür gebe ich dir y in einem Jahr), die beispielsweise einen Anspruch auf eine bestimmte Menge Nahrungsmittel oder eine bestimmte Dienstleistung verbriefen, weil ein solcher Schuldschein bis zur Fälligkeit praktischerweise jederzeit zediert werden könnte. Selbstverständlich wäre ein solcher aber ohne einen Machtapparat, der den Schuldner bei Androhung von Strafe zur Erfüllung der Schuld zwingen kann, nicht gerade begehrt, um es gelinde zu formulieren. Realiter würde nichts dergleichen dauerhaft Bestand haben.
Wir sehen also: Ohne Macht geht es nicht. Bauen wir also einen Gold abfordernden und Eigentum garantierenden Staat in unser Gedankenexperiment ein. Schon hätte das Gold zumindest einen Wert, der in Relation zur Sanktion bei Nichterfüllung der Zwangsabgabe steht. Im Falle der Todesstrafe wäre sein fiktiver Wert also sehr hoch. Doch auch hier gilt: Wie kann etwas von tatsächlichem Wert sein, das jeder hat? Und wie kann etwas für den Staat von Wert sein, das jeder hat? Wie kann mit so einer Abgabe der Machtkreislauf initiiert werden? Stellen wir uns vor, der Staat würde das gesamte Gold, das er zuvor an seine Inselbewohner ausgeteilt hat (realiter teilt der Staat im Regelfall1 kein Geld aus, sondern fordert es einfach ab), im nächsten Monat wieder als Steuer einnehmen. Dann wäre nichts geschehen. Das Gold wäre ausgeteilt und wieder eingesammelt worden. Ein Wirtschaftsprozess kann damit nicht gestartet werden. Offensichtlich kann ein Ding erst dann Wert haben und damit Preise schaffen, wenn es zum Termin eines darunterliegenden Schuldkontraktes, dem Staat oder einem Privaten gegenüber, knapp ist. Etwas, das nicht knapp ist, regt nicht zum Erwirtschaften eines Surplus an (mit dessen Hilfe man an die Abgabe kommt) – und damit auch nicht zum Wirtschaften an sich. Etwas, das jeder hat, schafft keine Preise, und was noch wichtiger ist: Etwas, das jeder hat, schafft keine Mehrproduktion, die man mit dem Gold kaufen könnte. Offenbar muss Gold also zum Steuertermin knapp sein, um Wert zu haben. »Knapp sein« aber bedeutet, dass dieses Gold nicht jedermann zum Steuertermin hat oder umgekehrt: Dass die Macht eben mehr (!) Gold als Abgabe verlangt, als jedermann zum Steuertermin haben wird. Die Macht muss die Steuer so weit erhöhen, dass sie nicht mehr für alle leistbar ist. Jetzt ist der »Zinnß« in der Welt, der primäre Zins, aus dem sich der private Zins entwickelt.2 Nun erst beginnt der Kampf um das Abgabentilgungsmittel und erst jetzt wird gewirtschaftet, d.h. erst jetzt werden unter Privaten Kontraktschulden abgeschlossen, Gold geliehen, Kredite vergeben, Unternehmen vorfinanziert usw., um schließlich durch den Verkauf der Produkte an das Gold zu kommen. Es ist ein ewiger Konkurrenzkampf, weil nie genug Abgabentilgungsmittel für alle da ist, so wie auch in der Natur nie genug für alle Lebewesen da ist – erst das erzeugt den evolutionären Druck und mit ihm eine immer komplexere Fauna und Flora, so wie der Schuldendruck des Kapitalismus die immense Vielfalt und Komplexität des Wirtschaftsraumes hervorbringt. Das ist die fraktale Abfolge: Aus der Urschuld entsteht die Abgabenschuld und aus der Abgabenschuld die Kontraktschuld; und wieder fungiert Gold nur als Schuldentilgungsmittel dem Staat gegenüber oder um private Schulden zu bezahlen. Die Neoklassiker, die kapitalistisches Wirtschaften auf irgendwelche »ungestillten Bedürfnisse« zurückführen, statt auf den Zwang, Schulden zu bedienen, sollen einmal erklären, warum es diese Bedürfnisse in einer Stammesgemeinschaft für Jahrzehntausende nicht gab und gibt. Warum wächst die Produktion im Stamm nicht? Warum spezialisiert sich niemand auf ein Handwerk? Und warum wird im Kapitalismus das Schlagwort »Wirtschaftswachstum« zum sich bis zum Exzess repetierenden Mantra? Um die letzte Frage ausführlich beantworten zu können, müssen wir uns den Zusammenhang zwischen Geld und Wirtschaftsleistung im Detail ansehen.
Während im Sozialismus das Volk, sinnbildlich gesprochen, mit der Peitsche zur Produktion von Waren und Dienstleistungen angetrieben werden muss, die dann mit Hilfe irgendwelcher absurder Bewertungsmodelle vom Staat mit einem Preisettikett versehen werden, und man im libertären Disneyland mit sogenanntem »Geld« ohne Nutzwert überschüssige Waren geschenkt bekommt, die zuvor niemand hergestellt hat, bedarf es im Kapitalismus keiner Intellektuellen, die sich um Wirtschaftswachstum und Geldversorgung Gedanken machen müssten – das alles regelt das Geld als solches. Schauen wir uns hierfür die Abläufe konkret an: Wenn ein Schuldner A einen Kredit von 100 € aufnimmt und damit eine Geldmenge von 100 € in die Welt setzt, die vorher noch nicht existiert hat, dann muss er innerhalb der Laufzeit seines Kredits diese 100 € (plus Zinsen) am Markt nachfragen, um seinen Kredit zu tilgen. Das bedeutet: Alles Geld im Kapitalismus wird nach seiner Schöpfung durch einen Akt der Verschuldung bereits im annähernd selben Moment nachgefragt (nominal sogar darüber hinaus, wenn man den Zins berücksichtigt), um damit den Kredit tilgen zu können. Es gibt also beim vom Staat definierten, debitistischen Geld nicht nur den Nachfragezwang nach Geld, um damit seine Steuern entrichten zu können. Es gibt darüber hinaus und darauf aufbauend einen Zwang, die Kredite zu bedienen, durch die das Geld überhaupt erst erschaffen wurde. Das bedeutet aber auch, dass man die Predigten von Anhängern eines Goldstandards, die aufgrund aufgeblähter Giralgeldmengen oder Zinsmanipulationen der Notenbanken vor einem Vertrauensverlust in Geld über Nacht warnen (Hyperinflation), getrost vergessen kann. Das kann auf die von ihnen beschriebene Weise niemals passieren, da existierendes Geld immer (!) nachgefragt werden muss. Eine Hyperinflation selbst ist dagegen eine durchaus reale Gefahr, auf deren tatsächliches Zustandekommen wir aber erst an späterer Stelle näher eingehen können.
Zuvor kommen wir noch einmal auf unseren einzelnen Kreditnehmer zurück, weil es hier noch viel mehr zu entdecken gibt. Mikroökonomisch würde die Schöpfung und Vernichtung von Geld so aussehen: Der Kreditnehmer A nimmt einen Kredit von 100 € auf, geht mit diesem Geld einkaufen und muss schließlich durch Feilbietung von Waren und Dienstleistungen das Geld wieder zurückerlangen, um seinen Kredit bedienen zu können. Danach würde das Geld im Nichts verschwinden, aus dem es kam. Realiter sind es, statistisch gesehen, natürlich nicht dieselben 100 €, die nachgefragt werden, sondern es wird das Geld anderer Leute durch das Anbieten von Waren und Dienstleistungen nachgefragt. Diese Betrachtung hat Sprengkraft. Sie zeigt nämlich, dass Geld (Giralgeld oder gesetzliches Zahlungsmittel), sobald es existiert, immer an ein Leistungsversprechen gebunden ist, so wie auch die Steuer erst durch eine Mehrleistung (Surplus) erwirtschaftet wird. Der Kreditnehmer A, der erst Zahlungsmittel zusammen mit der Geschäftsbank (Gläubiger) erzeugt, muss etwas leisten, um für die Tilgung des Kredits das Geld wieder am Markt einzusammeln. Und der Markt bewertet seine Leistung, d.h. erst wenn der Kreditnehmer genug Waren und/oder Dienstleistungen am Markt verkauft hat, damit er die zu tilgende Kreditsumme beisammen hat, kann er sich von seiner Schuld befreien.
Um das nochmals zu verdeutlichen: Der Nachfragezwang nach Zahlungsmittel (Geld oder Giralgeld) gibt diesem zuerst einmal einen grundsätzlichen Wert, aber erst die Leistung, die der Kreditnehmer zu erbringen hat, um diesen abzubezahlen, ist die Ursache für die Wertstabilität des Geldes, weil das Geld dadurch direkt an das Wirtschaftswachstum in einem kapitalistischen System gekoppelt ist. All das gibt es im libertären Entenhausen nicht. Dort buddelt der Goldgräber im Schweiße seines Angesichts nach Gold und meint dann Werte in der Hand zu haben, weil er sich so viel Mühe dabei gegeben hat (»intrinsischer Wert«). Das ist aber völlig irrelevant, wenn andere Marktteilnehmer ihren Wirtschaftsoutput nicht auch gleichzeitig hochgefahren haben, denn sonst stünde ein Mehr an Gold einem gleichbleibenden Output an Waren und Dienstleistungen gegenüber, was nichts anderes ist als Inflation und auch nichts anderes aussagt, als dass dieses ausgegrabene Gold eben überhaupt keinen Wert hat. Es ist Nettogeld! Wie wir sehen, ist Geld im Kapitalismus immer an das Wirtschaftswachstum gekoppelt, weil der Kreditnehmer, der letztlich Geld erzeugt, auch gleichzeitig Leistung erbringen muss, um seinen Kredit zu tilgen. Die wichtigste aller Fragen aber ist: Woher kommt das Geld anderer Leute? Wie kann der Kreditnehmer seine Waren und Dienstleistungen überhaupt am Markt absetzen? Das Geld anderer Leute hat abermals durch einen kreditären Akt das Licht der Welt erblickt. Der Kredit von A wird durch einen später fälligen Kredit von B, C, D … abbezahlt. Und die Schuldner B, C, D … müssen ihrerseits ihren Kredit mit später fälligen Krediten anderer Kreditnehmer zurückzahlen. Das ist im Debitismus der berühmte »Nachschuldner«: Früher fällige Kredite werden von später fälligen Krediten abgelöst. Und jetzt kommen wir neben dem Nachfragezwang zum zweiten wichtigen Punkt, der damit gelöst wird: Das Informationsproblem. Der Kreditnehmer A, der 100 € Kredit von der Bank gewährt bekam, muss einen oder mehrere Leute finden, die zusammen 100 € (plus Zinsen) Kredit aufgenommen haben (oder diesen Kredit als Guthaben besitzen) und dem Kreditnehmer A seine Waren und Dienstleistungen abkaufen, damit er mit dem so verdienten Geld seinen Kredit abstottern kann. Käufer und Verkäufer einigen sich auf einen Preis, der zum aktuellen Marktpreis wird. Beide bewerten also die Waren und Dienstleistungen in Geldeinheiten, was natürlich nur dann funktioniert, wenn der Kreditnehmer A das Geld zur Tilgung seines Kredits haben muss (!), d.h. kalkulieren muss, ob die erzielten Preise seine Kredittilgungsverpflichtungen und laufenden Kosten decken. Mit Nettogeld oder Nettogold können deshalb keine Preise erzielt werden. Es gibt hier weder eine erzwungene Wirtschaftsleistung, die dem Geld erst seine Kaufkraft gibt, noch einen Termin, an dem das Geld wieder zum Emittenten heimkehren muss, noch eine durch den Zins gewährleistete Geldknappheit. Wenn nun der Kreditnehmer A genug Leistung erbracht hat, um 100 € (plus Zinsen) erwirtschaftet zu haben, dann zahlt er seine letzte Kreditrate, löst seine Sicherheiten aus, die nun wieder ihm und nicht der Bank gehören und hat damit seinen Part erledigt. 100 € sind im Nichts verschwunden – die vom Kreditnehmer erwirtschafteten Zinsen behält sich die Bank als Gewinn ein. Der erwirtschaftete Output entspricht damit 1: 1 dem Marktwert des Kredits. Gleiches gilt natürlich für Steuerforderungen, die – Bankrotte außen vor gelassen – 1: 1 in Wirtschaftsleistung umgewandelt werden und der Auslöser der gesamten Kapitalismus-Veranstaltung sind. Immer muss ein Nachschuldner (bzw. jener, der den Kredit des Nachschuldners als Guthaben auf seinem Konto hat), der dem Kreditnehmer A seine Waren und Dienstleistungen abgekauft hat, mit seinem Geld aus dem »Nichts« (Kredit) diese Waren und Dienstleistungen im freien Spiel der Marktkräfte (Angebot und Nachfrage) bewerten. Er muss nun seinerseits einen Nachschuldner finden, um seinen Kredit abzustottern und dafür muss auch er etwas leisten. Und diese Leistung wird letztendlich von einem weiteren Kreditnehmer bewertet, ad infinitum … oder besser: »Ohne Ende, bis zum Ende«, wie Paul C. Martin sagen würde, dem wir diese geniale Entschlüsselung des Kapitalismus zu verdanken haben, denn so effizient dieses System auch arbeitet – es hat ein Ablaufdatum, und darauf werden wir im Folgenden eingehen. Eine Tatsache, die gleich von großer Bedeutung sein wird, nehmen wir aber aus dem bisher Gesagten mit: Es ist nie genug für alle da!
Drei Fragen drängen sich nämlich bei Martins debitistischer Betrachtungsweise des kapitalistischen Systems auf:
1) Wenn alles Geld dieser Welt nur durch Kreditkontrakte in die Welt kam, wo kommen dann die Zinsen zur Tilgung dieser Kredite her? Oder anders formuliert: Wenn alle ihre Kredite tilgen würden und es damit folgerichtig kein Geld mehr gäbe, würden dann nicht noch Zinsforderungen übrigbleiben, die uneinbringlich sind?
2) Wenn alle im Kapitalismus Gewinne einfahren wollen (bzw. »sparen«, d.h. Horten von Giralgeld über den Fälligkeitstermin des darunterliegenden Kredites hinaus), fehlt dann dieses Geld nicht, um ausstehende Kredite zu tilgen?
3) Dürfen überhaupt mehr Kredite getilgt als aufgenommen werden, ohne durch die damit einhergehende Kontraktion der Guthaben eine Deflation auszulösen? Oder anders formuliert: Wenn die Schulden im Kapitalismus nominal fixiert sind (d.h. ein Kredit bleibt immer in gleicher Höhe stehen bzw. wächst durch den Zins, aber er kann nicht schrumpfen), aber die Sicherheiten darunter im Wert schwanken können (werden zu viele Kredite beglichen, wird Geld knapp, wertet auf und die Preise fallen auf breiter Front), darf dann die Geldmenge (bzw. Kreditmenge) jemals schrumpfen?
Die in Frage 1 beschriebene Zinsmisere ist schnell begriffen: Wenn ein Schuldner A erst durch einen zinsbehafteten Kreditkontrakt Geld erzeugt, wie kann er diesen dann mit Zinsen wieder tilgen, wenn doch der Zins nicht mit dem Kredit mitgeschaffen wurde? Die Antwort: Er kann ihn – zumindest bei endfälligen Krediten (s.u.) – nicht tilgen! Er benötigt hierfür, wie schon gezeigt, einen anderen Kreditnehmer B, der genügend Geld geschaffen hat, damit er oder jemand anderer, der seinen Kredit als Guthaben hält, von A damit Waren und Dienstleistungen abkauft, damit dieser seinen Kredit samt Zinsen zurückzahlen kann. Und wo bekommt nun B die Zinsen für seinen (noch höheren) Kredit her? Er benötigt seinerseits einen Kreditnehmer C, der ihm dieses Geld zur Verfügung stellt usw. Das ist der berühmte Nachschuldner in Martins Debitismus, oder, wie Wolfgang Theil schreibt:
»Nur durch die Rekonstruktion der Geldentstehung wird klar, dass Geld nicht als ewig zirkulierendes ›Tauschmittel‹ […], sondern als zur Vernichtung durch Auflösung eines Schuldvertrags bestimmtes Schuldendeckungsmittel entsteht, das in der Summe niemals ausreicht, um alle Geldforderungen zu bedienen. Die Summe aller Schuldendeckungsmittel alias nicht zinstragende Anrechte auf Kreditgebereigentum alias ›Geld‹ ist immer niedriger als die Summe aller Forderungen von Kreditgebern gegen Kreditnehmer.«
Dabei wäre der Zins nicht das Hauptproblem im Kapitalismus, da die erste bezahlte Kreditrate eines Tilgungskredits von der Bank als Zinsforderung (und nicht als Kreditrückzahlung) und damit als Gewinn behandelt und deshalb auch wieder verausgabt werden könnte, um sie dem Markt und damit indirekt unserem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen. De facto also fehlt der Zins in der Theorie nicht. Das Problem offenbart sich vielmehr bei Punkt zwei, dem »Sparen« von Giralgeld, worunter auch das Sparen des Zinses durch den Gläubiger fällt. Stellen wir uns hierfür den Kreditnehmer A vor, dem von einer Geschäftsbank 10.000 € Kredit eingeräumt werden. Er geht damit bei X einkaufen und X behält sich die 10.000 € auf seinem Girokonto ein, und zwar über die gesamte Laufzeit des Kredites von A. Wo bekommt A nun das (Giral-)Geld her, um seinen Kredit zurückzubezahlen? Natürlich von einem oder mehreren weiteren Kreditnehmern, die insgesamt 10.000 € Kredit in die Welt setzen. Dabei ist die Sache aber so einfach nicht, da wir realiter davon ausgehen müssen, dass diese Kreditnehmer mit ihrem Kredit nicht direkt A seine Waren und Dienstleistungen abkaufen, sondern ihr Geld bei B, C, D, E, F, G, H … ausgeben, die nun ihrerseits einen Teil dieser Forderungen auf Geld auf ihrem Konto belassen könnten, sodass letztlich wesentlich mehr Kreditnehmer vonnöten sind, um alle Verbindlichkeiten (Schulden) bedienbar zu halten. Wer also seine Forderungen auf Geld am Konto nicht verausgabt und der Wirtschaft zur Verfügung stellt, erzwingt indirekt eine Netto-Neuverschuldung in gleicher Höhe, damit die Kreditnehmer draußen am Markt ihre Kredite bedienbar halten können. Dieses Horten von Nominalforderungen (Giralgeld) über die Fälligkeit des entsprechenden Schuldkontrakts (Kredit) hinaus erzwingt eine permanente Zunahme der Gesamtverschuldung im betreffenden Wirtschaftsraum. Nun könnte man natürlich einwenden, dass ja niemand dazu gezwungen wird, Kredite aufzunehmen und dass die Pleite einiger Wirtschaftsteilnehmer aufgrund eines zu geringen Angebots an Zahlungsmitteln (basierend auf zu geringer Netto-Neuverschuldung) nun mal zur kapitalistischen Realität dazugehört. Natürlich ist diese Sichtweise legitim, aber was genau geschieht eigentlich, wenn über einen längeren Zeitraum weniger neue Kredite aufgenommen als alte getilgt werden? Das ist die Kernproblematik der dritten Frage.
Werden in Summe mehr Kredite zurückgezahlt als neue Kredite aufgenommen, sinkt natürlich die (Giral-)Geldmenge und wenn die Menge an Geld (ergo Kredit) in einem Wirtschaftsraum sinkt, wertet dieses auf, d.h. es wird wertvoller, was im Umkehrschluss bedeutet, dass die Preise für Waren und Dienstleistungen sinken – alles wird billiger. Dieses Phänomen nennt sich »Deflation« und es führt dazu, dass nicht nur die Waren und Dienstleistungen des täglichen Gebrauchs günstiger werden, sondern auch die Pfänder/Sicherheiten, die von Kreditnehmern für ihren Kredit hinterlegt wurden, was zu Nachforderungen der Bank führen kann – der Kreditnehmer muss also für seinen Kredit nachträglich weitere Sicherheiten stellen, wenn er sich die Exekution sparen will. Auch für Unternehmer ist eine Deflation bitter. Müssen diese doch ihre Waren immer günstiger anbieten, um sie an den Mann bringen zu können, was sich nicht nur negativ auf ihren Gewinn auswirkt, sondern ebenso auf ihre Kredittilgungsverpflichtungen und die Löhne ihrer Mitarbeiter. In einem deflationären Umfeld sinken also das allgemeine Preisniveau und mit ihm die Bewertungen der Sicherheiten für ausstehende Kredite ebenso wie die Einnahmen, um die Kredite bedienbar zu halten, und das Lohnniveau. Das führt zu großflächigen Entlassungswellen. Werden Löhne staatlich fixiert (Kollektivlöhne etc.), werden zusätzlich mehr Arbeitnehmer gekündigt, um die Unternehmen vor der Pleite zu bewahren. Geringere Löhne und mehr Arbeitslose würgen den Konsum ab, was dazu führt, dass Unternehmen noch mehr Leute entlassen müssen, noch niedrigere Löhne zahlen und noch weniger verkaufen, was die Preise weiter sinken lässt, noch mehr Rationalisierung der Unternehmen und Sicherheitsnachschusspflichten der Banken auf den Plan ruft, noch mehr Arbeitslose generiert und den Konsum weiter abwürgt. Hinzu kommt, dass in einem deflationären Umfeld »gespartes« Geld erst recht nicht verausgabt wird, da in einem solchen Szenario kaum investiert wird und Geld in einem Umfeld sinkender Preise die beste Anlageform ist. Damit beantwortet sich auch Frage Nummer 3 von selbst: Es gibt im Kapitalismus nichts Schlimmeres als eine über die Menge der neu erschaffenen Kredite hinausgehende Kredittilgung, da die Schulden nominal fixiert sind, während die Bewertung der unter den Schulden liegenden Güter variabel ist. So wie sich also ein (inflationärer) Wirtschaftsboom aus sich selbst heraus speist – Konsum, Löhne, Beschäftigungsquote, das Preisniveau und damit die Bewertung der Pfänder steigen in einem sich selbst verstärkenden Regelkreis –, so wirkt auch die Kehrseite des inflationären Booms, der deflationäre Bust, autokatalytisch. Nun haben kleine Einbrüche im Aufwärtstrend der Geld- bzw. Kreditmengen nicht sofort eine deflationäre Depression zur Folge. Meist kommt es zu einer rezessiven Kreditkontraktion, die zu einem Crash in einer ganzen Branche führt, der einen neuen, leicht niedrigeren Geld- bzw. Kreditmenge-Level implementiert, auf dem neu aufgeschuldet werden kann. Bricht aber der Aufwärtstrend grundsätzlich und es werden über einen längeren Zeitraum weniger Kredite aufgenommen als getilgt, ist eine deflationäre Depression unvermeidlich, solange der Staat nicht als Nachschuldner einspringt. Zur besseren Orientierung für den Leser im nachfolgenden Text dieses Kapitels will ich bereits an dieser Stelle einen Teil des Jargons meiner Zyklen-Theorie erläutern, auch wenn die tiefere Bedeutung dieser Begriffe erst in chronologisch späteren Kapiteln ausführlich dargelegt wird: Unter dem »Machtzyklus« verstehe ich den Zeitpunkt von der ersten Unterwerfung eines Bauernstammes durch einen Hirtenstamm zur ökonomischen Ausbeutung, der bis heute andauert und spätestens 5000 v. Chr. startete. Der Machtzyklus ist demnach ein Teil des »patriarchalischen Zyklus« (ab ca. 7000 v. Chr.), der wiederum ein Teil des Neolithikums ist (spätestens 10.000 v. Chr.). Der Machtzyklus speist sich aus den aufsteigenden und absterbenden Kulturen, deren Lebensdauer vom Zeitpunkt echter Staatspolitik1 bis zur hochzivilisierten Lebenshaltung etwa 1000 Jahre beträgt. Danach geht ein 1000-jähriger »Kulturzyklus« in eine jahrzehnte- oder jahrhundertelange Desintegration über, an deren Ende primitive, entwicklungsunfähige Volksmassen stehen, die sich zu Stämmen zurückentwickeln und erneut der Unterwerfung für einen weiteren Kulturzyklus harren. Auf die innere chronologische Struktur eines Kulturzyklus werden wir später im Detail eingehen. Im folgenden Kapitel konzentrieren wir uns auf den großen kapitalistischen Zyklus innerhalb des abendländischen Kulturzyklus, dessen Anfänge sich in Europa zwar bereits zwischen dem 13. und 15. Jh. verorten lassen, der aber erst mit der Industriellen Revolution 1750 seinen wirklichen Durchbruch hatte. Und dieser große kapitalistische Zyklus ist gekennzeichnet durch wirtschaftliche Auf- und Abschwünge, die ich als »debitistische Durchläufe« oder »debitistische Zyklen« bezeichne, die im Abendland zwischen 50 und 70 Jahre andauern, in weniger technologisierten Kulturen (entschleunigter Kapitalismus durch wesentlich längere Kommunikations- und Transportwege) aber ein Vielfaches davon betragen können. Der letzte debitistische Durchlauf fällt dabei mit dem Ende eines Kulturzyklus zusammen und wird so lange gedehnt, dass kein klares Ende definierbar ist.
Halten wir nach diesem kleinen Einschub fest, dass mit jeder Neukreditaufnahme auch ein neuer Level an Schulden auf der einen Seite und Guthaben auf der anderen Seite etabliert wird, der nicht mehr signifikant unterschritten werden darf. Deshalb müssen die Schulden im Kapitalismus innerhalb eines engen Trendkanals ständig wachsen und die Realität verifiziert diese These in jeder Hinsicht. Die Folge davon kann natürlich nur sein, dass der Kapitalismus die Schere zwischen Arm und Reich unaufhörlich öffnet, da die Schulden der Unter- und Mittelschicht und der Unternehmen den Guthaben der Oberschicht entsprechen. Ebenso konzentriert sich das unbelastete Eigentum zur potentiellen Kreditschaffung in der Oberschicht, das deshalb bei den Leistungsträgern des Wirtschaftssystems rar wird. Der Leistungsdruck nimmt also in den unteren Schichten und den verschuldeten Unternehmen sukzessive zu, verunmöglicht im Volk nach und nach die Schaffung eines kleinbürgerlichen Glücks und hat am Ende nur noch den Sinn, Erträge für die Oberschicht zu erwirtschaften, deren Wertpapiere bedient werden und im Wert steigen sollen (Entkopplung von Realwirtschaft und Finanzwirtschaft). Ohne eine breit gestreute Eigentumsverteilung und die Schaffung von Vermögen durch die Leistungsträger zur weiteren Kreditgenerierung endet ein debitischer Durchlauf in sich selbst. Bricht nämlich die Netto-Neuverschuldung dauerhaft ein, ist ein debitistischer Zyklus vollendet und löst sich auf in Bürgerkriege, internationale Kriege, bitterster Armut, Totalitarismus und schließlich einer Neuordnung der Dinge. Diese Durchläufe kennt man bereits seit der frühdynastischen Zeit Mesopotamiens (2900 – 2340 v. Chr.), als es gegen Ende des Kulturzyklus der Sumerer immer wieder zu staatlich veranlassten Schuldenerlassen kam, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Ein Konzept, das natürlich nur dann Sinn macht, wenn der Großteil der Menschen die Schulden direkt beim Staat hat (via Tempelbank) und die Schuldenerlasse nicht mit periodischer Regelmäßigkeit kommen (sondern nur, wenn bereits die Krise eingetreten ist). Würden heute periodische Schuldenerlasse beschlossen, wäre die Rechtssicherheit für Gläubiger dahin, die Geschäftsbanken sofort pleite und der Markt würde sich sofort auf die neue Regelung einstellen (z.B. in Form von horrend steigenden Zinsen, je näher das nächste »Jubeljahr« rückt). Schuldenerlasse sind also nicht irgendeiner Großzügigkeit geschuldet, sondern nichts anderes als eine Währungsreform, der bereits schwerste Krisen und katastrophale Schicksale vorausgingen. Dass der Kapitalismus stets in die gleiche Katastrophe mündet, ist natürlich kaum jemandem in der Geschichte des Kapitalismus entgangen. Bereits Aristoteles beklagte die angebliche Widernatürlichkeit des Zinses und heute sind es vor allem die Freiwirte1, die mit ihren Konzepten einer »umlaufgesicherten Währung« den Fehler des Systems auszumerzen versuchen. Allen Kritikern des gegenwärtigen Geldsystems, angefangen bei Aristoteles, ist allerdings gemein, dass sie nicht begreifen, was Geld eigentlich ist und deshalb dem Tauschparadigma anhängen. Expemplarisch will ich hierfür die Freiwirte hervorheben. Sie wollen das Sparen von Geld durch eine Wertminderung desselben über die Zeit hinweg bestrafen, z.B. indem man auf jeden Geldschein (z.B. 100-€-Schein) Monat für Monat eine Marke klebt (z.B. im Wert von 50 Cent), um den Wert zu erhalten, d.h. Geldhaltung soll auch Geld kosten – das Geld soll sozusagen »verderben« wie eine Ware. Dabei erklären die Freiwirte nicht, woher der ursprüngliche 100-€-Schein kommt, da er in ihrer Vorstellung ohne Schulden ensteht und damit schon per se wertlos ist (»Nettogeld«). Sie erklären ebenso nicht, woher die Marken kommen: Sind sie Nettogeld, d.h. werden sie nicht zur Schuldentilgung abgefordert? Dann sind sie wertlos und befeuern die Hyperinflation des ohnehin schon wertlosen Freigeldes. Sind sie aber Ergebnis eines Gläubiger-Schuldner-Kontrakts, dann befeuern sie das deflationäre Potential, weil Menschen Kredit aufnehmen müssten, damit andere ihr Guthaben wertstabil halten könnten – ein groteske Vorstellung, mit ebenso grotesken Implikationen für das Bankgeschäft und die Negativzinspolitik in einem Freigeldsystem. Dass ein derartiges »Schwundgeld« natürlich mit einer massiven Hortung von Sachwerten einhergehen würde, ist auch dem Begründer der Freiwirtschaftslehre, Silvio Gesell, nicht entgangen, weshalb er der Hortung von Grund und Boden in seinem Theoriemodell durch eine »Bodenreform« beizukommen versuchte. Diese beinhaltete Pachtzahlungen an den Staat als Nutzungsgebühr, was besonders skurril ist, weil mit dieser Pacht der positive Zins, den Gesell zu bekämpfen versuchte, plötzlich wieder die kapitalistische Bühne betritt. Pachtzahlungen sind nichts anderes als Zinsen (»Pachtzins«); vom primären Zins, dem »Zinnß«, der Steuerzahlung an den Staat, ganz zu schweigen.2 Darüber hinaus – und das war auch der Grund, weshalb ich die Freiwirte dem debitistischen Denkmodell gegenüberstellte – ist eine Erhöhung der sogenannten »Umlaufgeschwindigkeit« keine Lösung für das systemimmanente Problem des Debitismus, so wie diese überhaupt eine der am meisten überschätzten Phrasen der etablierten Lehre ist. Was passiert, wenn sich die Umlaufgeschwindigkeit einer Währung erhöht? Bleibt die Nettoneuverschuldung aus, dann werden in der Zwischenzeit Kredite getilgt. Jeder Nachfrage nach Produkten auf der einen Seite, durch eine Erhöhung der Umlaufgeschwindigkeit, stehen Fälligkeiten der Kredite gegenüber, durch die das Geld erst erschaffen wurde. Wo also auf der einen Seite Produkte nachgefragt werden und sich deren Preis erhöht, werden auf der anderen Seite Kredite getilgt, was Geld vernichtet und die Nachfrage wieder abwürgt. Das Missverständnis, dass eine signifikante Erhöhung der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes die Ursache für Hyperinflationen ist, kommt einerseits daher, dass die Neoklassiker Geld wie eine Ware behandeln, d.h. seinen Wert ebenso durch Angebot und Nachfrage ausdrücken wollen wie bei den Dingen, die man damit kauft. Und andererseits kommt es aus der Beobachtung, dass sich die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes in einer Hyperinflation erhöht, was aber nicht Ursache, sondern Folge der Hyperinflation ist, wie später noch zu zeigen sein wird. Man kann es drehen und wenden wie man will: Nur neue Kredite bringen neues Wirtschaftswachstum, nur neue Kredite halten das Preisniveau oben und nur neue Kredite halten das Gewerk am Laufen. Ebenso wenig ändert das bloße Streichen von Schulden, das natürlich auf der anderen Seite der Bilanz zu einer Vernichtung von Guthaben führen muss, irgendetwas am grundsätzlichen Problem: der Konzentration von Eigentum in den Händen weniger. Erst eine großflächige Enteignung von Eigentum für die Kreditschaffung, wie beispielsweise Grund und Boden oder Immobilien, mit einer anschließenden breitflächigen Verteilung kann einen neuen debitistischen Zyklus initiieren, und das geschieht am Ende eines solchen auf die eine oder andere Weise (fast) immer:
1. In Form eines »Lastenausgleichs«, wie er 1952 in Deutschland stattfand. Hierfür werden Eigentümer gezwungen, ihr Eigentum zu belasten.
2. In Form einer direkten Enteignung Vermögender, zu welcher der Staat (alter Machthaber oder neuer Machthaber durch Putsch) in der klassischen Revolutionsphase gezwungen ist, um sein Machtmonopol zu behalten.
3. Wenn die Nachschuldnerfindung durch wirtschaftliche Expansion (Globalisierung) keine weiteren Erträge abwirft, werden Kriege geführt – zum Erzwingen von Nachschuldnern (Sklavenhaltung oder der Verliererstaat besteuert den Siegerstaat), zur Eigentums- und Rohstofferbeutung, um im Land einen inflationären Impuls gegen die Deflation zu setzen und nicht zuletzt, um den Zusammenhalt im Inneren durch einen äußeren Feind zu gewährleisten.
4. Indirekt durch einen von Krieg zerbombten Staat, der eine neue, breiter gestreute Eigentumsverteilung möglich macht.
Der Kapitalismus ist letztlich ein modifiziertes Monopoly-Spiel, mit der neuen Spielregel, dass niemand mit einem Startkapital beginnen darf, sondern sich dieses erst leihen muss. Ziel des Spiels ist es, den Konkurrenten tiefer in die Verschuldung zu treiben, um selbst solvent zu bleiben bzw. Geld oder Geldforderungen zu horten, mit denen hernach Eigentumstitel gekauft werden können. Wenn am Ende einige wenige alles besitzen und die große Mehrheit heillos verschuldet ist, ist der Durchlauf beendet. Der letzte debitistische Durchlauf im Leben einer Kultur wird nicht mehr abgewickelt, sondern durch die dann auftretenden Imperatoren so lange wie nur möglich durch Staatsverschuldung, Nettogeld-Spritzen, Teil-Währungsreformen, Imperialismus, Enteignung von politischen Kontrahenten und Gläubiger-Morde gedehnt. Die betreffende Volkswirtschaft findet dann, selbst nach einer vollständigen Währungsreform, nie wieder zu alter Stärke, weil eine großflächige Enteignung von Eigentum mit anschließend breit gestreuter Verteilung aufgrund der Komplexität des betreffenden Wirtschaftsraumes weder politisch noch ökonomisch durchsetzbar ist. Wir kommen später im Detail darauf zurück. Halten wir vorerst fest: Betrachten wir die Gesamtverschuldung der Bevölkerung und die Verschuldung des Staates bzw. reziprok dazu das Gesamtguthaben als eine einzige Bilanz, dann darf es in dieser zu keiner längerfristigen Bilanzverkürzung kommen. Die Gesamtschuldenmenge und spiegelbildlich die Guthaben müssen stetig wachsen.
Nun sind diesem Kreditwachstum aber im Goldstandard Grenzen gesetzt, nämlich durch die vorhandene Goldmenge, mit der die Notenbank die Nachfrage der Geschäftsbanken nach Bargeld begrenzt, was indirekt auch die Kreditvergabe der Geschäftsbanken drosselt. Sobald die Grenzen des Kreditwachstums im Goldstandard erreicht sind – also die letzten Kredite nicht mehr durch neuerliche, noch höhere Kredite abgelöst werden –, kommt es zum deflationären Kollaps. Da die Schulden (plus Zinsen) des letzten Schuldners nicht durch neuerliche Verschuldung bedienbar gehalten werden, tilgt dieser nun seine Schulden mit dem vorhandenen Geld (bzw. Forderungen auf Geld), das nun folgerichtig den anderen Schuldnern zur Bedienung ihrer Kredite fehlen muss. Der von Martin so bezeichnete »Kettenbrief« reißt und es beginnt ein Kampf um das Schuldentilgungsmittel »Geld«. Nun laufen alle gemeinsam zum Ausgang. Jeder versucht seine Schulden mit dem noch existierenden Geld zu tilgen. Geld wird knapp und es wertet auf oder debitistisch formuliert: Der Produzent kann aufgrund der fehlenden Nettoneuverschuldung seine Produkte nicht mehr am Markt absetzen und senkt sukzessive die Preise, um sie überhaupt noch loszubekommen. Immer mehr Schuldner geraten in diesem Kettenbrief der Kredite unter Druck – den Letzten beißen die Hunde. Die beschriebene deflationäre Spirale aus fallenden Preisen greift um sich. Die ausstehenden Sicherheiten werden neu bewertet, was den Druck auf die übrigen Kreditnehmer erhöht, ihre Kredite schneller zu begleichen oder mit weiteren Sicherheiten zu unterfüttern. Niedrigere Löhne und Arbeitslose befeuern die Entwicklung weiter und da immer mehr Kredite notleidend werden, kommen auch die Banken unter die Räder und stehen kurz vor der Pleite. Die Sparer stürmen daraufhin die Bank, um ihre Forderungen auf goldgedecktes Bargeld (gesetzliches Zahlungsmittel) geltend zu machen. Die Bank kann aber aufgrund ihrer im Preis gefallenen Aktiva nur einen Teil des Giralgeldes bei der Notenbank in Bargeld umwandeln, danach ist sie pleite. So gilt auch hier: Den Letzten beißen die Hunde. Durch die fallenden Preise auf breiter Front sind auch überlebende Banken besonders restriktiv bei der Kreditvergabe und achten auf besonders hohe Bonität ihrer neuen Kreditnehmer. Doch selbst diese wollen in einem Umfeld fallender Preise keine neuen Kredite, sondern beginnen die alten zu tilgen bzw. sparen ihre ständig im Wert steigenden Nominalforderungen (Bargeld unter dem Kopfpolster) und warten auf wirtschaftlich stabilere Zeiten. Durch die fallenden Preise bricht auch bei den Betuchten der Konsum ein, nach dem Motto: Warum soll ich heute Anschaffungen leisten, wenn sie morgen noch viel billiger sind? Das Gleiche gilt für die wenigen, die grundsätzlich bereit wären, Kredite aufzunehmen: Warum heute Kredite aufnehmen, warum nicht morgen, wo die Zinsen noch niedriger sind? So wird ohne Nettoneuverschuldung, die notwendig wäre, um die Schulden zu stemmen, ein Schuldkontrakt nach dem anderen fällig und die Deflationsspirale dreht sich gnadenlos, theoretisch bis zu dem Punkt, wo alle Kredite vernichtet sind und damit kein Buchgeld mehr existiert bzw. alles Geld (in welcher Form auch immer) zum Emittenten zurückgekehrt ist. Praktisch bricht dagegen nur das Kreditgeschäft der Banken zusammen, d.h. der Markt für Forderungen auf das gesetzliche Zahlungsmittel. Die Deflation bucht damit Schulden aus, die uneinbringlich sind und korrigiert die der Deflation vorangegangene Inflation. Übrig bleiben die Steuerforderungen, d.h. das echte Geld, das weiterhin nachgefragt und damit gegen Verschuldung geschöpft werden muss. Würde diese Forderung in einem Gedankenexperiment wegfallen1 und würden wir uns in einer isolierten Volkswirtschaft mit ausreichend Grund und Boden für jedermann befinden, dann würde sich die Gesellschaft, nach einem jahrzehntelangen Intermezzo der für krisengeschüttelte Machsysteme typischen Tausch-Geschäfte (Zigaretten gegen Nahrung etc.), wieder zu Stämmen mit Subsistenzproduktion zurückentwickeln, das Abgabengut, in unserem Fall Gold, würde zu seinem inneren Wert zurückkehren (Schmuckwert, der besonders in einer Krise äußerst niedrig und in Stämmen de facto wertlos ist) und Eigentumstitel könnten nicht mehr bepreist werden.
Deflationäre Phasen sind alles andere als angenehm. Es kommt zu Revolten, Regierungsstürzen und Instabilitäten im Staat. Sowohl Volk als auch Staat fürchten sich vor einer deflationären Schuldenbereinigung wie der geschilderten. Was hat also zu geschehen?
Um das Funktionieren des Kapitalismus weiter zu gewährleisten, beginnt man ganz einfach die Golddeckung aufzuweichen, von 30 auf 10%, von 10 auf 3% usw. Auf diese Weise versucht man, den inhärenten Zwang des Kapitalismus zur Aufschuldung zu gewährleisten. Es soll nie wieder dazu kommen, dass Unternehmen keinen Kredit bzw. nur einen Kredit unter teuren Konditionen bekommen, weil den Notenbanken das Gold dazu im Tresor fehlt. Nun funktioniert die Aufschuldung wieder. Durch die Fluten an neuen Krediten steigen Aktien, Immobilien, Rohstoffe und Konsumgüter – je nachdem, welches Segment mit den Unmengen an Geld eben gerade nachgefragt wird. Weil alles im Preis steigt, wird fleißig investiert, und die Kredite werden den Banken nur so aus der Hand gerissen. Nun kommt aber selbst die geringste Golddeckung irgendwann an ihre Grenzen. Ein weiterer Crash wartet mit gestiegener Fallhöhe – d.h. noch viel mehr Kredite, noch viel mehr Zerstörungskraft, noch viel mehr Potential für inner- und außerstaatliche Instabilität. Wieder können weder Volk noch Staat die Deflation zulassen und so beginnt man die Golddeckung ganz abzuschaffen, die ohnehin nie mehr war als ein künstlich geschaffenes Element zur Begrenzung des Kreditwachstums; bzw. hatte Gold nach Gunnar Heinsohn und Otto Steiger früher überhaupt nur den Vorteil der Fälschungssicherheit gegenüber Banknoten. Dem Staat war die Golddeckung darüber hinaus ohnehin immer ein Dorn im Auge – war er dadurch ja selbst in seiner Kreditaufnahme beschränkt. Mit Gold lässt sich deshalb kein für ein Weltreich notwendiger Imperialismus betreiben, keine Demokratie erhalten (Bestechung des Wählers mit seinem eigenen, in Zukunft zu erwirtschaftenden Geld), keine internationale Konkurrenz ausstechen (ein Land mit Goldstandard muss langfristig gesehen immer hinter der Wirtschaftsleistung eines Landes mit ungedecktem Geld zurückbleiben), kein Wettrüsten mithalten und keine zwingend steigende Komplexität des Wirtschaftsraumes verwalten. Darüber hinaus wird in einer Deflation in einem demokratischen System die amtierende Regierung abgewählt und in einem nichtdemokratischen System herrschen zumindest machtpolitische Instabilitäten. Der Goldstandard kann also stets nur ein Intermezzo im Leben einer Kultur sein, wenn diese die Möglichkeit erhält, mit Privateigentum zu wirtschaften. Entweder diese schafft ihn irgendwann ganz ab oder weicht ihn sukzessive so weit auf, dass es einer Abschaffung gleichkommt.1
Mit der Abschaffung des Goldstandards steht der entfesselte Kapitalismus da in seiner ganzen Pracht und Reinheit. Der Markt wurde von künstlichen Gold-Regulierungen befreit und der Kredit kann in Hülle und Fülle aus den privaten Geschäftsbanken sprudeln und die Wirtschaft befeuern. Da bald auch die Banken nichts anderes als jahrzehntelangen Wirtschaftsboom und steigende Preise (z.B. der Immobilien), daher im Wert steigende Sicherheiten, kennen, wird auch dort die Kreditvergabe immer laxer, d.h. sie verlangen immer weniger Eigentumspfand als Sicherheit und vertrauen auf das Rückzahlungsversprechen1, sodass sich letztendlich jeder ein Haus leisten kann.2 Das Emittieren von Giralgeld ohne (bzw. mit wenig) Eigentumsdeckung durch den Schuldner ist der finale Schritt am Ende eines – zu diesem Zeitpunkt noch prosperierenden – debitistischen Zyklus. Der Kredit ist dann oft zu einem großen Teil nur noch durch das zukünftige Einkommen des Kreditnehmers besichert. Und auch hier zeigt sich wieder, dass Geld immer nur Produkt einer Schuld sein kann: Bricht nämlich das Einkommen aufgrund von Arbeitslosigkeit weg und kann der Kreditnehmer deshalb seinen Kredit nicht mehr begleichen, wird sein Giralgeld zu Nettogeld, d.h. es hebt in dem Segment, in dem der Kreditnehmer mit dem Kredit gekauft hat (Nachfrage), die Preise (Inflation), aber da es im Gegenzug keine Leistung (Angebot) des Kreditnehmers gibt, sinken die Preise in einem anderen Segment nicht, d.h. es gibt einen gesamtwirtschaftlich inflationären Impuls durch die Nachfrage mit dem neu geschaffenen Geld, aber kein Erwirtschaften neuer Waren und Dienstleistungen zur Kredittilgung, um ein deflationäres Angebot in die Welt zu setzen. Erst wenn die Geschäftsbank die Bilanzlücke mit ihrer Gewinnrücklage schließt, d.h. den Kredit mit ihrem eigenen Geld tilgt und dieses Geld somit vernichtet, wird der inflationäre Impuls wieder neutralisiert. Wieder ist klar ersichtlich: Ob Gold oder Papier – einen inneren Wert, losgelöst von einer Schuld, die zur Nachfrage nach Geld durch das Stellen eines Angebots (Leistung) verpflichtet, gibt es nicht. Geld hat immer einen Termin, an dem damit eine Verbindlichkeit getilgt werden soll. Ohne Termin ist es wertlos; nur durch den Termin wird es überhaupt nachgefragt. Geld ist immer, sobald es existiert, bereits fällig. Geld, das also »netto zirkuliert«, wie sich das die Vertreter der Tauschtheorie vorstellen, gibt es nicht bzw. hat keinen Wert. Der Staat kann zwar Nettogeld ins Wirtschaftssystem pumpen – gemeint ist Geld (in gedruckter oder elektronischer Form) ohne Schuldner als Counterpart –, dieses Nettogeld erhält seinen Wert aber immer nur durch alle anderen schuldbehafteten Geldderivate, welche durch die Existenz dieses wertlosen Nettogeldes (im konventionellen Geschehen Scheidemünzen) verwässert werden, d.h. inflationieren. Niemals kann mit dem Nettogeld alleine ein Wirtschaftsprozess in Gang gesetzt werden.
Und auch in einem reinen Kreditgeldsystem gilt, dass es gesamtwirtschaftlich zu keiner Bilanzverkürzung zwischen Forderungen und Verbindlichkeiten kommen darf. Daher sind auch Guthaben nur so lange existent, wie es auf der anderen Seite Schuldner gibt, die dafür Leistung erbringen. Dementsprechend kann es auch kein »Gesundsparen« ohne Vernichtung von Sparguthaben geben.1 Der Kapitalismus ist ein Kettenbriefsystem (Paul C. Martin), wo alte Kredite durch neue abgelöst werden. Weil nur Kredite der Treibstoff der kapitalistischen Volkswirtschaft sind, müssen im Volk ständig neue Bedürfnisse geweckt werden, die zuvor noch nicht da waren. Das führt u.a. zum Phänomen der »Werbung«, die aus systemischer Sicht nichts anderes bewirken soll, als zum Schuldenmachen zu verführen, damit die Kapitalisten ihrerseits ihre Schulden bedienbar halten können. Das Anwachsen der Schulden führt auf der anderen Seite aber auch zu einem Anwachsen des Wohlstandes auf ein sagenhaft hohes Niveau, das aber immer auf dem wackeligen Fundament der Vorfinanzierung steht. Der Kapitalismus ist damit niemals (!) im Gleichgewicht, sondern unterliegt einem permanenten Schuldendruck, der im Zeitablauf immer aggressiver wird. Erst dieser bewerkstelligt die typisch kapitalistische Dynamik und den immensen Fortschritt in kurzer Zeit, v.a. gegen Ende hin.2 Stets benötigt der Kapitalismus eine Netto-Neuverschuldung – oder er geht unter. Während im Sozialismus die Armut gleich verteilt ist, wie wir später sehen werden, ist der Wohlstand im Kapitalismus auf Kredit, mithin auf die Zukunft aufgebaut. Hinter dem kapitalistischen Wohlstand lauert also immer (!) der alles zerstörende Crash als dualistischer Pol. Die Gegenwart wird vorfinanziert; geht also das Vertrauen in den zukünftigen Wirtschaftsboom bzw. die Bezahlbarkeit der ausstehenden Kredite verloren, kommt es zur Krise.
Aber natürlich gibt der Staat nicht auf, wenn sich die ersten ernsten Anzeichen für eine Rückabwicklung des Kapitalismus zeigen. Um diesen noch bedrohlicheren Kollaps weiter in die Zukunft zu verschieben, bringt der Zyklus neue Ökonomen hervor oder hievt deren Ideen ins öffentliche Bewusstsein, wie etwa Keynes und seinen Keynesianismus. Um die fehlende Nachfrage (daher das fehlende Kreditwachstum) zu kompensieren, soll der Staat selbst als Nachschuldner auftreten und die Kreditmaschinerie wieder in Gang bringen. Er soll in neue Technologien investieren, Bauprojekte verwirklichen, Banken und Firmen stützen und damit künstliche Nachfrage erzeugen, damit das Vertrauen in die Zukunft wiederhergestellt wird und die Leute wieder Kredite nachfragen: Das Volk soll wieder Vertrauen in die Bedienung zusätzlicher Kredite bekommen. Schafft es der Staat, durch dieses sogenannte »deficit spending« die Nachfrage noch einmal anzuheizen und einen neuerlichen Boom zu entfachen, soll er sodann die Staatsverschuldung – geht es nach Keynes – durch höhere Steuern wieder ausgleichen. Dass dies natürlich nur einen zeitlich befristeten psychologischen Effekt zur Folge hat, der das Grundproblem nicht löst, sondern weiter verschärft, dürfte einleuchtend sein. In der Praxis kann der Staat seine Staatsverschuldung gar nicht tilgen – was, wie wir später sehen werden, notwendigerweise in den Staatsbankrott führt.
Gleichzeitig beginnen die Notenbanken im Umfeld stockender Kreditvergabe den Leitzins (= der Preis für die Umwandlung von Schuldtiteln in Bargeld) künstlich zu senken, um die Nachfrage nach Krediten wieder anzukurbeln. Auch dieses Phänomen wird von der Mainstream-Ökonomie vollkommen missverstanden: Ihre Vertreter meinen, der Leitzins würde je nach Inflations- oder Deflationserwartung künstlich regulierend wirken. Tatsächlich aber kennt der Leitzins nach der debitistischen Boomphase (»kapitalistischer Sommer« – im gegenwärtigen Durchlauf des Westens bis ca. 1980) langfristig, innerhalb eines Trendkanals bzw. spitz zulaufenden Dreiecks, nur eine einzige Richtung: die nach unten. Das Zinsniveau muss (!) in einer Welt des ewigen Kreditwachstums gen null tendieren, da bei steigender Verschuldung weitere Kredite nur bei günstigen Konditionen aufgenommen werden. Und auf der anderen Seite muss der Spielraum zur Anhebung des Leitzinses immer kleiner werden, da eine vollkommen überschuldete Volkswirtschaft höhere Zinsen einfach nicht mehr verkraftet. Und zwar umso weniger, je länger das System läuft. Ist erst der Leitzins bei null und der Staat, durch seine exzessiven Ausgaben zur »Bewältigung« der Krise, kurz vor dem Bankrott, beginnt der deflationäre Kollaps. Wie bereits erwähnt, findet eine Deflation in der Theorie erst dann ihren Boden, wenn alle Schulden und Guthaben sich zu null saldieren und es keinerlei Geld mehr in der betreffenden Volkswirtschaft gibt. Das wird auf der einen Seite durch die laufenden Steuerforderungen verhindert und auf der anderen Seite versucht der Staat – vor allem beim letzten debitistischen Durchlauf am Ende eines Kulturzyklus – bereits viel früher, die deflationäre Spirale durch das Drucken von Nettogeld aufzufangen. Zwar bezeichnet Nettogeld im engeren Sinne schuldloses Geld, in der Praxis aber wird der Staat dafür langlaufende Staatsanleihen direkt bei der Notenbank zur Umwandlung in Notenbankgeld hinterlegen, die bei Fälligkeit durch kürzer laufende Staatsanleihen abgelöst (prolongiert) werden. De facto also ist dieses Nettogeld als Schuld verbucht, was aber mehr einer Formalität gleicht und kaum einen Unterschied macht.1 Um ein Kippen der Deflation in eine Hyperinflation zu vermeiden – beides ist eine Gefahr für das Machtmonopol des Staates –, versucht er die Geldknappheit am Ende des großen kapitalistischen Zyklus (letzter debitischer Durchlauf und Ende des Kulturzyklus) durch dosiertes Einstreuen von Nettogeld zu kompensieren und die Gratwanderung zwischen Deflation (Tilgung und Ausbuchung von Schulden) und Hyperinflation (Entwertung der Schulden) zu meistern. Dieser Weg, sofern der Staat nicht von ihm abkommt, nennt sich »jahrzehntelange schrittweise, kontrollierte Verarmung«. Dieses dosierte Einstreuen von Nettogeld hat zwar in der Tat eine entlastende Funktion für die Kreditnehmer, die damit ihre Kredite begleichen können, führt aber auf der anderen Seite zu einem Steigen der Preise (v.a. bei lebenswichtigen Gütern des täglichen Bedarfs) bei gleichzeitiger Kontraktion des Wirtschaftsraumes durch ein Abwürgen des Schuldendrucks und ein Stagnieren der Löhne. Die Inflation wird dabei immer wieder unterbrochen durch schwere deflationäre Schocks, die eine Ausweitung der Nettogeldproduktion nach sich ziehen. Darüber hinaus ändert diese Maßnahme nichts Gravierendes an der Vermögensverteilung im Wirtschaftsraum und erzeugt schon gar nicht einen Anreiz zur Schaffung von belastbarem Eigentum und der Nachfrage danach bzw. nach Krediten. Eine solche Krise ist eben nicht zu lösen. Entweder der Staat lässt die Deflation zu, was sein Machtmonopol gefährdet, oder er übernimmt laufend, nach jedem deflationären Einbruch, die uneinbringlichen Schulden, verschiebt also deren Fälligkeit in die Zukunft und lässt den Steuerzahler dafür bürgen. Letztere ist die empirisch wahrscheinlichste und langwierigste – und gerade deshalb stabilste – Variante am Ende eines Kulturzyklus, wie noch zu zeigen sein wird, aber auch diese Form der »Dauerkrisenbekämpfung« muss, um den Staat über einen langen Zeitraum solvent zu halten, immer mit periodischen Teilenteignungen von Geldbesitzern oder Steuererhöhungen einhergehen. Da sich aber aus einer sukzessive kontrahierenden Wirtschaft immer weniger Geld für den Staat abschöpfen lässt, um laufende Verbindlichkeiten zu bedienen, steht auch hier am Ende immer die Hyperinflation mit Währungsreform, die aber ohne Lösung der Eigentumsproblematik keinen echten Neubeginn ermöglicht.