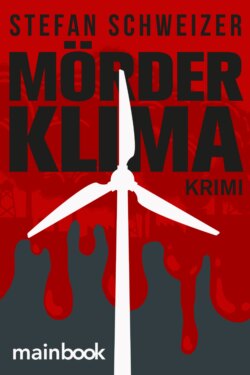Читать книгу Mörderklima - Stefan Schweizer - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8.20. Oktober 2020, Stuttgart, Hauptfriedhof
ОглавлениеAuf dem Stuttgarter Hauptfriedhof herrschte an einer überschaubaren Stelle reger Betrieb. Die gesamte Friedhofsanlage war gepflegt. Auch hier schienen sich die schwäbischen Attribute der Reinlichkeit zu bestätigen. Der Weg zwischen den Gräbern verlief kerzengerade. Eine neu ausgehobene Grube verriet den traurigen Anlass für den Trubel.
Die Blätter der Bäume hatten sich bereits verfärbt und hier und dort lag bereits etwas Laub am Boden. Ansonsten gab es keinerlei Hinweise darauf, dass es bereits Mitte Herbst war. Ganz im Gegenteil. Die Wetterkapriolen der letzten Wochen setzten sich unbeirrt fort. Denn „Goldener Oktober“ war im Moment eher ein metaphorischer Euphemismus für die knapp unter 30 °C liegende Temperatur und die kräftige Sonne, die mit unerbittlicher Kraft herabschien. Eigentlich, dachte Georg, ist das kein passender Rahmen für eine Beerdigung. Aber, was war schon für eine Beerdigung angemessen? Eine Beerdigung assoziierte er mit schlechtem Wetter – entweder Regen oder mit unerbittlicher Kälte, auch wenn sich dies nicht mit seinen tatsächlichen Erfahrungen deckte. Er schwitzte in dem schwarzen Anzug aus dickem, englischem Stoff, der aus der vornehmen Savile Row in London stammte – ein weiteres Geschenk seines in den Vereinigten Staaten von Amerika lebenden Onkels.
Trotz der hohen Temperaturen hielt er es für angemessen, Frieda mit feierlicher Kleidung aus diesem Leben zu verabschieden. Jetzt erhielt er die Quittung für seine hehren Absichten. Aber er litt nicht alleine, denn auch andere Trauergäste schwitzten gewaltig, obwohl sie die Wahl ihrer Kleidung an der Wettervorhersage orientiert hatten.
Georg studierte die Gesichter – die zahlreichen Sonnenbrillen spielten ihm diesbezüglich einen Streich. Er erkannte dennoch Emotionen wie Trauer, Ungläubigkeit, Fassungslosigkeit, aber auch Gleichgültigkeit. Der Kreis der versammelten Trauergemeinde war überschaubar. Immerhin erkannte er zwei, drei Gesichter aus vergangenen Studientagen. Friedas Eltern waren vor Gram gebeugt. Sie waren aus Hessen angereist. Georg dachte darüber nach, ob es wirklich etwas Schlimmeres geben konnte, als das eigene Kind begraben zu müssen.
Der übergewichtige – der Herr hat es uns gegeben und meine Frau hat es vorzüglich gekocht! – evangelische Pfarrer spreizte gewichtig seine Arme, wobei die geöffneten Handflächen gen strahlendblauen Himmel zeigten. Er sprach die altbekannten Worte aus der Bibel, denen Georg nur mit einem Ohr folgte. Vielmehr fokussierte er einen besonders feierlichen, imposanten Kranz mit der Aufschrift „In Memoriam Frieda – Prof. Dr. Dr. h.c. Meyer“. Die in noblem Gelb gehaltene Kranzschleife war der Länge nach mit grüner Schrift bedruckt. Georg beschloss, Meyer zu fragen, wieso der Kranz ausschließlich aus roten Rosen bestand, obwohl eine plausible Schlussfolgerung nicht allzu schwierig war. Das war beinahe schon zu auffällig – ganz so, als lege es jemand darauf an. Daneben lag ein Kranz, der von Friedas Fakultät stammte. Auch er enthielt verdächtig viele Rosen, aber nicht ausschließlich rote und zudem noch andere Schnittblumen wie Nelken. Georg wusste, dass Meier der amtierende Dekan von Friedas Fakultät war.
Meyer befand sich drei Plätze vor ihm in der Schlange, die sich vor dem Grab gebildet hatte. Er war ein großer, athletischer Mann. Georg kannte ihn bereits seit Studienzeiten. Inzwischen war Meyer vom eher schlaksigen Jüngling zu einem ansehnlichen Silberrücken gereift. Eine junge, attraktiv aussehende Frau in einem kurzen und tendenziell zu knapp geschnittenen schwarzen Kleid begleitete ihn. Sommer widmete ihr deutlich mehr Aufmerksamkeit als anderen anwesenden Kolleg*innen, die eher seinem Rang entsprachen. Als Georg an die Reihe kam, nahm er die pittoreske Schaufel und schüttete etwas Erde auf den in der Sonne gleißenden, braunen Sarg. Für eine Sekunde hielt er inne und schloss die Augen.
„Mach es gut, Frieda“, murmelte er kaum vernehmbar und sandte noch einige Bitten an ein höheres Wesen, von welchem er annahm, dass es Alles aus dem Nichts geschaffen hatte.
Dann deutete er einen Diener an und machte Platz für den nächsten Trauergast. Friedas Eltern schüttelte er mitfühlend die Hand und sprach einige wohlgesetzte und deutlich artikulierte Worte des Bedauerns. Die alten Leute taten ihm leid, da er ihren alle Poren durchdringenden Schmerz bis in seine letzte Faser spürte. Er wollte sich dadurch aber nicht zu sehr in seiner Wahrnehmung beeinträchtigen lassen und verabschiedete sich mit einer salbungsvollen, gut gewählten Phrase.
Als er Meyer erreichte, äußerte er eine ziemlich belanglose Mitleidsbekundung, öffnete dann zunächst langsam die rechte Handfläche und streckte sie freundschaftlich seinem alten Bekannten hin.
Meyer musterte Georg einen Augenblick zu lange. Dann nickten sich die Männer unmerklich zu und Meier schlug ein. Der Händedruck war abartig und ein stechender Schmerz durchfuhr zuerst die Finger und dann den rechten Unterarm. Das Knacksen war beinahe eine logische Folge.
„Oh, ich bin auch sehr erfreut, dich nach so langer Zeit mal wieder zu sehen, Hermann“, sagte Georg mit sanfter Stimme, wobei er kaum merklich den Mund verzog und seine Finger vorsichtig schüttelte, um zu sehen, ob noch alles in Ordnung war.
Meyer grunzte zustimmend. Seine hübsche, junge Begleiterin war vorsorglich knapp zwei Meter zurückwichen, was Georg nicht entgangen war.
„Ich kann es immer noch nicht fassen“, meinte Georg.
Meyer zuckte gleichgültig die Schultern.
„Das Leben ist voller Rätsel. Wir wissen nie, was in den Anderen wirklich vor sich geht“, antwortete er in perfektem Hochdeutsch, obwohl er Schwabe war.
Wohl wahr, dachte Georg.
„Ich hoffe, dass deine Forschungsprojekte jetzt nicht gefährdet sind, weil deine wichtigste Mitarbeiterin nicht mehr unter uns weilt.“
Bei „wichtigster Mitarbeiterin“ verriet sich Meyers junge Begleitung durch ein Lächeln.
„Es wäre ein Jammer, wenn dir dadurch der Nobelpreis durch die Lappen gehen würde.“
Meyer schien die Bemerkung ernst zu nehmen.
„So tragisch es ist, aber ‚The show must go on‘, wie es so treffend heißt“, entgegnete er kalt. „Mit Ereignissen wie diesen müssen wir ständig rechnen. Das darf doch nicht unsere Forschungsagenda, unser Streben nach Fortschritt für die Menschheit, wissenschaftlicher Exzellenz und unserem Trachten nach Preisen und Auszeichnungen durcheinanderbringen.“
Er runzelte vielsagend die Stirn.
„Bei allem Mitgefühl, aber das wäre nicht professionell“, fuhr er fort. „Und schließlich ist es kein Geheimnis, dass jeder von uns ersetzbar ist. So funktioniert der technokratisch ausgerichtete Turbokapitalismus nun mal, ob uns das schmeckt oder nicht. Jeder von uns ist ersetzbar“, schloss Meyer sein Mantra.
Bei diesen Aussagen erinnerte sich Georg an eine Menge bedeutsamer Gründe, die es ihm seit jeher schwer gemacht hatten, mit Meyer wirklich warm zu werden.
„Darf ich dich und deine entzückende Begleitung noch zu einem Lunch einladen? Ich würde gerne mit dir ein wenig über die alten Zeiten und Friedas schrecklichen Unfall plaudern.“
Sommer warf einen flüchtigen Alibi-Blick auf seine Omega Speedmaster.
„Frau PD Dr. Dr. Roll und ich müssen dringend zu einer wichtigen Sitzung. Das verstehst du sicherlich, obwohl du ja vermutlich immer noch keinen Lehrstuhl hast. Oder gibt es inzwischen eine Stiftungsprofessur für platonischen Idealismus?“, schoss er kichernd eine Spitze ab.
Schnell biss sich Georg auf die Zunge, um keine Reaktion zu zeigen. Bei Meyers erstem Teil der Aussage fiel ihm unweigerlich das Stichwort „Besetzungscouch“ ein, obwohl das alles nicht zusammenpasste. Wieso hatte Roll einen Privatdozenten-Titel, aber keine Junior-Professur inne? Wollte Meyer sie länger und in eine massive Abhängigkeit bringen? Oder hatte er ihr als Rettungsring eine Stelle an seinem Institut angeboten, damit sie ihm ewig ‚dankbar‘ sein musste?
„Aber vielleicht sehen wir uns auf dem Princeton-Kongress in knapp zwei Wochen“, retournierte Georg.
Meyer nickte.
„Auch wenn wir dort unterschiedlichen Lagern angehören werden. Du weißt genau, wo ich bei der Frage ‚Climate Change – Fake or Threat?‘ zu verorten bin. Mir geht das hysterische Geschnatter auf den Geist. Vor 40 Jahren hieß es, dass der ganze Wald sterben würde und so weiter. Deshalb befinde ich mich in Sachen Klimawandel sozusagen am anderen Ufer als du.“
Georg schenkte dem geschmacklosen Witz keine Beachtung.
„Du hast schon immer einen Hang zum Materiellen gehabt“, zahlte Georg ihm die Spitzen zurück.
Er nickte Frau Roll und Meyer zu.
„Wunderbar, wir sprechen uns dann“, schloss er den Dialog und ging ohne weiteren Körperkontakt Richtung Ausgang des Friedhofs.
Hier hatte er genug gesehen und gehört. Er musste die Eindrücke erst mal verarbeiten.
Bereits in Potsdam hatte er schon beschlossen gehabt, noch länger in Deutschlands Süden zu verweilen, um dem Rätsel von Friedas Tod auf die Spur zu kommen. Denn er war interessiert daran, Friedas Wohnort und ihren Arbeitsplatz unter die Lupe zu nehmen, um möglichst viel über ihre Persönlichkeit herauszufinden. Aber bitte ohne Meyer. Dieser durfte nichts von seinen Aktivitäten mitbekommen. Denn Meyer mochte es zwar zu mehr wissenschaftlicher Visibility gebracht haben als er, aber in Sachen Kriminalistik ließ er sich von ihm nicht vorführen. Und Georg war sich sicher, dass Meyer noch so manches Geheimnis hütete, das in direktem Zusammenhang mit Friedas überraschendem ‚Unfall‘ stand. Was zu beweisen war. Er war sich außerdem sicher, dass er durch seine Ermittlungen neue Spuren hinsichtlich Friedas Tod ans Tageslicht bringen würde.
Die Untersuchung von Friedas Arbeitsplatz war aber ergebnislos und reichlich unspektakulär verlaufen. Ein gelangweilter Doktorand, der als einziger auf dem Stockwerk anzutreffen war, hatte ihm ohne Worte die Türe zu Friedas Büro geöffnet und sich mit den Worten „Geben Sie Bescheid, wenn Sie fertig sind. Um 18 Uhr beginnt der Uni-Fußball!“ verabschiedet. Das offensichtliche Maß an Laxheit und Gleichgültigkeit schockierte ihn.
Schließlich war Frieda eine noch wenig bekannte, aber durchaus ernst zu nehmende Forscherin gewesen. Durch den freien Zutritt zu ihrem Büro wäre es leicht möglich, sich ihre Forschungsergebnisse illegal anzueignen und als die eigenen auszugeben. Das wäre nicht das erste Mal in Academia, dass ein solch ungeheurer Vorgang passierte.
Doch das Büro war auffallend leer. Georg gewann den Eindruck, dass es gesäubert worden war. In den Schreibtischschubladen war belangloses Zeug wie Tipp-Ex, Tesafilm, ungeöffnete Pralinen und so weiter. Am Bildschirm war kein Rechner angeschlossen, sodass Georg davon ausging, dass sich dieser bei ihr zu Hause befand oder aber, dass er bereits von Meyer als Eigentum des Instituts ‚eingezogen‘ worden war. Die wenigen grauen Leitz-Ordner in den Regalen enthielten Rechnungen, Arbeitsstundenblätter und wenige Kopien aus wichtigen Standardwerken der Wirtschaftswissenschaften. Das Büro half ihm nicht weiter! Er musste neuen Spuren nachgehen.
Jetzt stand er vor dem Haus, in dem Frieda gewohnt hatte und hoffte, dass er hier erfolgreicher sein würde. Es handelte sich um ein ordentliches, aber sehr konventionelles Zweifamilienhaus – zweifellos aus der Retorte. Georg hatte sich dem Vermieter als potenzieller Nachmieter Friedas angekündigt. Der kleine, stämmige Mann eilte durch den kleinen Garten und öffnete Georg das Törchen.
„Sie sind also daran interessiert, die Zweizimmer-Einliegerwohnung zu mieten, Herr Doktor?“, hieß er ihn mit mächtig schwäbischem Akzent willkommen und streckte eine stark behaarte Pranke hin, die Georg jovial schüttelte und überrascht war, wie sanft der Händedruck seines Gegenübers ausfiel.
„Genau“, antwortete er und musterte dabei den vorbildlich gepflegten Garten, in dem kein Unkraut wuchs und in dem alles mit dem Lineal angeordnet schien.
„Kommen Sie“, meinte der Schwabe und zeigte mit der Hand auf die schwarze, massive Haustüre. „Unser Garten ist immer tipptopp gepflegt, genauso wie man das doch haben möchte, gell?“, fragte er dann, erhielt aber nur ein kurz angebundenes „Hm“ zur Antwort.
Das Haus bildete eine Fortsetzung des Gartens. Weder staubige Ecken oder unangebrachte Flecken waren zu sehen und alles stand an Ort und Stelle. Die Möbel konnten aus einem bekannten schwedischen Möbelhaus oder einem vergleichbaren Laden stammen. Voller Sehnsucht dachte Georg an seine Villa in der Berliner Vorstadt.
„Hier sind wir!“, meinte der Schwabe und deutete auf einen schlauchartigen Flur.
Die Wohnung bestand aus zwei Zimmern und zwei Abzweigungen in Bad und Küche mit Esszimmer.
Es schmerzte Georg, dass auch hier nichts, aber absolut nichts von Individualität zu spüren war. Austauschbare Möbel, das Ganze ohne Charme und jeglicher persönlichen Note. Frieda hatte offensichtlich keinen allzu großen individuellen Fußabdruck in ihrem Leben hinterlassen.
„Das Arbeitszimmer interessiert mich besonders“, behauptete Georg, „da ich für meine Karriere viel zu Hause arbeite und schreibe. Da müssen das Ambiente und die Aussicht stimmen.“
„Solche Mieter sind uns natürlich am liebsten“, kicherte der Schwabe. „Der Unfall ihrer Vormieterin ist schon bizarr“, fuhr er fort. „Das Fräulein Frieda war ja so eine liebenswerte Person. Äußerst solide und zuverlässig. Überwies die Miete immer pünktlich. Es ist wirklich ein Jammer. Sie machte keinen Lärm, empfing kaum Besuch und erledigte ihre Kehrwoche hervorragend. Sie wissen doch, dass Sie hier Kehrwoche machen müssen?“
„Sauberkeit und Ordentlichkeit sind zwei meiner größten Tugenden“, goss Georg Wasser auf die Mühlen des Häusle-Besitzers.
Auf dem weißen Schreibtisch lag ein in schwarz gebundenes Kalenderbuch, das beim Datum des 6. Oktober aufgeschlagen war – lediglich ein einziger Eintrag um 19 Uhr.
Windforschungsanlage Bremerhaven.
Nicht mehr und nicht weniger. Georg biss sich sanft auf die Unterlippe.
„Die Eltern Ihrer Vormieterin wollen bald die Wohnung ausräumen lassen, also stören Sie sich bitte nicht an den Möbeln“, hakte der Vermieter nach, um die Sache unter Dach und Fach zu bringen. „Da sind Sie natürlich völlig frei. Ganz nach Lust und Laune. Wie Sie wollen.“
Georg überlegte kurz, ob es irgendwie möglich sein würde, den Kalender einzustecken, spürte aber intuitiv die stechenden Blicke des Schwaben in seinem Rücken. Er gab sich weiterhin als interessierter Nachmieter, um die Wohnung nach Verdächtigem abzusuchen. Er fand aber nichts. Rein gar nichts. Beinahe war es so, als habe Frieda überhaupt nie gelebt.