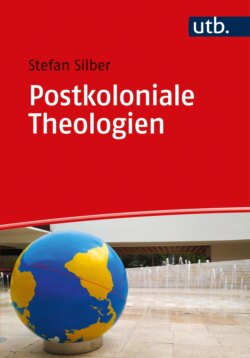Читать книгу Postkoloniale Theologien - Stefan Silber - Страница 14
2 Diskurspraktiken
ОглавлениеWissen kann in der Gegenwart nicht mehr einfach als objektiv vorhanden oder zuverlässig erwerbbar gelten. Es wird vielmehr in vielfältigen Diskursen generiert, verändert, weitergegeben und fortentwickelt. Im Zusammenhang mit Machtkonstellationen, wie sie etwa in kolonialen und postkolonialen Kontexten gegeben sind, ist es zu erwarten, dass auch die Diskurse, die Wissen hervorbringen, von diesen Machtverhältnissen durchdrungen sind und in ihnen operieren.
Die postkoloniale Kritik – und mit ihnen postkoloniale Theologien – widmet daher den verschiedenen Strategien und Praktiken des Diskurses sehr viel Aufmerksamkeit. Denn auch die Theologie ist ein Beziehungssystem vielfacher Diskurse, in denen Wissen produziert wird. Und auch theologische Diskurse sind in vielfältige Machtbeziehungen eingewoben. Die Produktion theologischen Wissens in Diskurspraktiken muss daher – gerade auch aus postkolonialer Perspektive – kritisch auf ihre Beeinflussung durch Machtverhältnisse hin befragt werden.
In diesem Kapitel werden einige wichtige Begriffe der postkolonialen Diskurskritik insbesondere anhand ihrer Verwendung in postkolonial-theologischen Texten vorgestellt. Zwei sehr wichtige Konzepte stehen am Anfang: das ↗ Othering oder die Erfindung des/der Anderen (2.1) und die Essentialisierung oder Versteinerung von Identitäten und Begriffen (2.2). Beide sind stark aufeinander bezogen und treten in der Praxis häufig in Verbindung miteinander auf. Kulturelle Bereiche, in denen besonders augenfällig diese Praktiken des Othering und der Essentialisierung nachgezeichnet werden können, sind der Rassismus (2.3) und die Genderbeziehungen (2.6). Auch der Diskurs über Religion und Religionen ist von externen Zuschreibungen, die versteinernd wirken können, geprägt (2.5). Im Kolonialismus wirkt sich besonders stark eine mehr oder weniger offene Überzeugung von der europäischen Überlegenheit (2.4) aus, die sich beispielsweise auch in der Geschichtsschreibung findet (2.7).
Aufgrund der Vielfalt dieser Perspektiven und ihrer komplexen wechselseitigen Beeinflussung wird in postkolonialen Debatten inzwischen mehr und mehr das Konzept der Intersektionalität oder der Überschneidungen solcher Perspektiven aufgegriffen (2.8).
Allen diesen eher kulturell oder diskursiv orientierten Perspektiven gemeinsam ist die charakteristische Eigenschaft kultureller Phänomene, prägend auf das Bewusstsein der Menschen zu wirken, ohne immer offen sichtbar in Erscheinung zu treten. Bestimmte kulturelle Vorstellungen gelten als selbstverständlich, ohne hinterfragt zu werden. Vielmehr werden sie mit einer scheinbaren Sicherheit ‚gewusst‘, weil sie bereits die Wahrnehmung prägen. Ähnlich wie Sophie BessisBessis, Sophie in ihrer Kindheitserinnerung (vgl. oben 1.1) nicht daran zweifelte, dass die ‚Französinnen‘ in ihrer Schule ihnen überlegen waren, so ‚wissen‘ Menschen auch heute in sehr unterschiedlichen postkolonialen Konstellationen aus tiefster Überzeugung, dass manche Identitäten so und nicht anders sind, bestimmte Menschen weniger wert oder weniger fortgeschritten als andere und dass geschichtliche Prozesse so abgelaufen sind, wie es die Mächtigen aufschreiben ließen.
Postkoloniale Studien hinterfragen und kritisieren diese Selbstverständlichkeit und stellen analytische Mittel bereit, um die scheinbare Sicherheit des kulturellen Wissens zu durchbrechen. Sie decken auch Diskurspraktiken in der Theologie auf, in denen solche Stereotypen als Grundlage verwendet oder als Ergebnis begründet werden. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur selbstkritischen Überprüfung theologischer Diskurse.