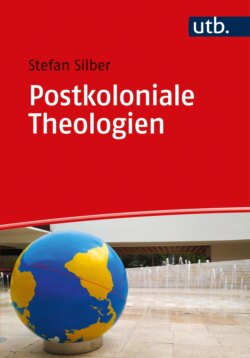Читать книгу Postkoloniale Theologien - Stefan Silber - Страница 16
2.2 Die Versteinerung von Identitäten
ОглавлениеDie Erfindung des Anderen wird noch verschärft, wenn dem/der Anderen – und damit gewissermaßen spiegelbildlich auch dem Subjekt selbst – klar umgrenzte, statische und scheinbar unveränderliche Identitäten zugeschrieben werden. Die negative Bewertung und Unterordnung des/der (erfundenen) Anderen unter den eigenen Dominanzanspruch wird auf diese Weise verfestigt und versteinert. Der/die Andere erscheint minderwertig, einfach weil er/sie einer Gruppe von Menschen zuzugehören scheint, die als minderwertig konstruiert wurde, damit der Machtanspruch, der gegenüber dieser Gruppe erhoben wird, als legitim erscheinen kann. Diesen Vorgang nennt man in der postkolonialen Theorie ↗ EssentialisierungEssentialisierung oder Naturalisierung1. Die kulturell zugeschriebene ‚Identität‘ wird so verstanden, als wäre sie auf ‚natürliche‘ Weise oder ‚essenziell‘, also ‚wesenhaft‘, mit einer bestimmten Menschengruppe und den zugehörigen Individuen verbunden.
Insbesondere Rassismus und Sexismus in ihren vielfältigen Spielarten arbeiten mit diesen Essentialisierungen. Menschen mit bestimmten phänotypischen Merkmalen wie Haut- oder Haarfarbe bzw. Menschen, die einem bestimmten Geschlecht zugeordnet werden, wird eine kulturell bestimmte Identitätsformation zugeschrieben, die scheinbar allen Individuen dieser Gruppe eigen ist. In rassistischen und sexistischen Diskursen werden dazu häufig auch noch ‚wissenschaftliche‘ Analysen, Systematisierungen und Begründungen erarbeitet, so dass diese versteinerten Identitätszuschreibungen auch akademisch untermauert gelehrt und verwendet werden.
Rassismus und Sexismus wurden als wichtige Instrumente kolonialer Herrschaft eingesetzt und stellen auch in der Gegenwart zentrale Elemente postkolonialer kultureller Kontexte dar (vgl. Kapitel 2.3 und 2.6). Darüber hinaus bieten sich kulturelle, ethnische oder nationale Identitäten als Material für die Versteinerung an. Die Theologin → Namsoon KangKang, Namsoon, die aus Korea stammt und in den USA lehrt, zeigt etwa, dass in der Theologie ein essentialistisches Bild von Asien und asiatischen Theologien konstruiert wurde. Mit ausdrücklichem Bezug auf Edward SaidSaid, Edward schreibt sie:
„Das Bild des Orients neigt dazu, unbeweglich, eingefroren, und auf ewig festgelegt zu sein; deshalb wird die Möglichkeit der Transformation und Entwicklung des Orients geleugnet.“2
Essentialistische GegenstrategieDer kolonialistischen Abwertung Asiens und des (essentialisierten) Asiatischen entspricht dann eine von KangKang, Namsoon ebenfalls kritisierte essentialistische Gegenstrategie, in der die asiatische Theologie „glorifiziert, mystifiziert und idealisiert [wird] als die Weisheit des Ostens“3. Asiatische Theologie erscheint in dieser Gegenstrategie ebenso als festgelegt und vereinheitlicht: Bestimmte mystische oder weisheitliche Beispiele asiatischer Theologien werden als Paradigma oder als Wesen ‚der‘ asiatischen Theologie konstruiert und als ‚Anderes‘ des rationalen und diskursiven Europa festgelegt. Dies wird laut Kang „sowohl von den Menschen der westlichen Halbkugel als auch von den Asiaten selbst“4 so praktiziert.
Asiatische TheologInnen, die nicht diesem westlich-mystischen Klischee entsprechen, sondern ‚westliche‘ theologische Methoden anwenden, können dann schnell als entfremdet oder kolonialisiert denunziert werden. Insbesondere der Feminismus kann so als etwas ‚Nichtasiatisches‘ ausgeschlossen werden, sowohl von ‚asiatischer‘ wie von ‚westlicher‘ Seite5. Hier bezieht KangKang, Namsoon sich ausdrücklich auf die feministisch-postkoloniale Theoretikerin Chandra Talpade MohantyMohanty, Chandra Talpade, die bereits 1984 darauf aufmerksam gemacht hatte, dass es Menschen aus Asien gerade auch im akademischen Kontext schwer gemacht wird, im Westen oder dem Westen gegenüber eine Identität einzunehmen, die nicht mit der klischeehaften Vorstellung des Asiatischen übereinstimmt6.
Aber auch in der ‚westlichen‘ Feministischen Theologie deckt KangKang, Namsoon essentialistische Herangehensweisen auf: Anhand einer Arbeit von Rosemary Radford RuetherRuether, Rosemary Radford aus dem Jahr 1998 zeigt Kang, wie Ruether „durch die Erwähnung verschiedener individueller feministischer TheologInnen im Westen“ „die Falle der Verallgemeinerung zu vermeiden sucht“7, dann aber bei der Darstellung der Feministischen Theologie des Globalen Südens genau in diese Falle tappt, indem sie die individuellen Theologinnen in den Kategorien Lateinamerika, Afrika und Asien namenlos verschwinden lässt.
Innerhalb der Theologie in Asien selbst können Frauen und ihre gesellschaftliche Rolle ebenfalls essentialisiert erscheinen:
„Im asiatischen theologischen Diskurs über die Frauen, zum Beispiel, werden die Frauen als reine Opfer oder sich befreiende Persönlichkeiten dargestellt, die über all den Schmerz und das Leid mit einer verblüffenden, erlösenden Kraft hinauswachsen.“8
Frauen als Täterinnen, Frauen als Angehörige der Machtelite oder in anderen gesellschaftlichen Rollen kommen dagegen nicht in den Blick. Auch ihre kulturellen, ethnischen, nationalen und klassenbezogenen Differenzen und persönlichen, individuellen Eigenschaften bleiben unberücksichtigt: „Die asiatischen Frauen werden einseitig als Opfer betrachtet und jedwede historisch-kulturelle Eigenart wird ihnen aberkannt.“9 Dagegen müssten sowohl die interne Diversität der Gruppe ‚asiatische Frauen‘ als auch die Vielfältige Beziehungen von Ähnlichkeiten und Differenzenvielfältigen Beziehungen von Ähnlichkeiten und Differenzen zwischen ‚asiatischen Frauen‘ einerseits und ‚nichtasiatischen Frauen‘ bzw. ‚asiatischen‘ und ‚nichtasiatischen Männern‘ andererseits Berücksichtigung finden.
So kritisiert KangKang, Namsoon beispielsweise auch den Theologen Aloysius PierisPieris, Aloysius aus Sri Lanka, der die Erfahrung der Armut und die Vielfalt der Religionen als zwei gemeinsame Nenner der asiatischen Theologie ausmacht10. Andere Herausforderungen in asiatischen Kontexten, die sich nicht mit diesen beiden großen Kategorien in Verbindung bringen ließen, könnten so nicht Gegenstand einer ‚asiatischen Theologie‘ im Sinn dieser Definition sein.
Das Aufgreifen einer essentialistischen Vorstellung von ‚der asiatischen Theologie‘ durch TheologInnen aus Asien wird dabei von KangKang, Namsoon ausdrücklich nicht verworfen, da sie es auch als eine verständliche Gegenreaktion und legitime Widerstandspraxis gegen die westliche Abwertung ansieht. Dies bezieht sich auf Gayatri SpivakSpivak, Gayatris Rede vom „Strategischer Essentialismusstrategischen Essentialismus“11: Unter bestimmten Bedingungen kann eine Essentialisierung als Mittel zum Widerstand, zur Mobilisierung von Menschen oder auch zur Markierung einer Gegenposition als strategisches Instrument zum Einsatz kommen, wenn dabei der Gefahr der Versteinerung entgegengewirkt wird.
Die negativen Auswirkungen dieser Essentialisierungen müssen jedoch immer kritisch und selbstkritisch im Blick bleiben. Insbesondere müssen sowohl interne Differenzen zwischen den Personen, die unter einen strategischen Essentialismus fallen, als auch die Beziehungen, die zwischen den als verschieden markierten Positionen herrschen, benannt und analysiert werden. Sonst droht die Gefahr eine Isolation der verschiedenen sich selbst als rein und unveränderlich verstehenden Identitäten. KangKang, Namsoon warnt daher ausdrücklich:
„Heutzutage ist es völlig klar, dass alles, was sich isoliert, sei es westliche oder asiatische Theologie, versteinert. Und alles, was versteinert, stirbt.“12
Neben solchen versteinerten Identitätszuschreibungen, die sich auf Menschen anderer Regionen, Kulturen und Ethnien richten können, finden sich Essentialisierungen auch in anderen diskursiven Bereichen. Auch Begriffe und Konzepte können essentialistisch verwendet werden können, so als ob ihre Bedeutung festgelegt und unveränderlich wäre.
Auch Essentialisierungen in der Theologiein der Theologie werden solche generalisierenden Begriffe häufig unkritisch verwendet und können zu Essentialisierungen und politischer, aber auch theologischer Versteinerung führen und so zur bewussten oder unbewussten Machtausübung eingesetzt werden. Die argentinisch-schottische feministische Theologin → Marcella Althaus-ReidAlthaus-Reid, Marcella analysiert am Beispiel der Gnadenlehre, wie auch theologische Lehrsysteme, wenn sie in einer versteinerten Weise angewendet werden, zur Rechtfertigung von Gewalt, Ausbeutung und Mord gebraucht werden können. Bei der Eroberung Lateinamerikas sei der Gnadenbegriff dazu missbraucht worden, die UreinwohnerInnen des Kontinents als ‚Heiden‘, als „Minderwertige“13 abzuwerten. Allerhand „Sünden“ seien dazu konstruiert worden: „Kannibalismus, abweichendes Sexualverhalten, Faulheit und mangelnde geistige Ernsthaftigkeit“ konnten „als Vehikel für die Gnade“ dienen, auch wenn sie „(wie im Fall des Kannibalismus) reine Phantasiegebilde angesichts der tatsächlichen Identität der Eingeborenen waren“14. Die ‚Gnade‘ der Evangelisierung mussten die UreinwohnerInnen mit ihrem Land, ihrer Arbeitskraft und oft genug mit dem Leben bezahlen.
Einen ähnlichen Missbrauch eines versteinerten Lehrbegriffs konstatiert Althaus-ReidAlthaus-Reid, Marcella bei der Rede von der Gnade während der argentinischen Militärdiktatur (1976–1983), die zum Tod oder spurlosen Verschwinden von Zehntausenden argentinischer Staatsangehöriger führte. Die Inanspruchnahme versteinerter Lehren, die sich von ihrer ursprünglichen biblischen und theologischen Bedeutung entfernt hatten und nur noch den Begrifflichkeiten nach am Christentum festhielten, konnte zur Legitimation der Diktatur und ihrer Verbrechen werden:
„Bestimmte Predigten zur damaligen Zeit sprachen von einem Land, das vom Kommunismus erlöst werden musste nach dem Beispiel von JesusJesus am Kreuz, und diese Erlösung sollte ‚durch das Blut‘ von Mitbürgern erreicht werden.“15
Solche kritisch zu bewertenden Praktiken finden sich auch in politischen und befreienden Theologien. → R.S. SugirtharajahSugirtharajah, R.S. kritisiert beispielsweise an der lateinamerikanischen Theologie der Befreiung, dass sie dazu neige, „die Armen zu reifizieren“ und dann „zu romantisieren“16. ‚Reifizierung‘, also Verdinglichung, kann mit dem verglichen werden, was hier als ‚Essentialisierung‘ oder Versteinerung bezeichnet wird. ‚Die Armen‘, ‚die Frauen‘, ‚die Arbeiter‘, ‚die Laien‘, ‚die Ausgeschlossenen‘ (usw.) sind klassische „masterwords“17 im Sinn von Gayatri SpivakSpivak, Gayatri. Darunter versteht sie Wörter, die als machtvolle Oberbegriffe eine größere, heterogene Gruppe von Menschen so bezeichnen, als wäre sie homogen. Zugleich – durch die Macht der Verallgemeinerung – üben diese Begriffe Herrschaft (im Sinn des englischen master) über diese Menschen aus, indem sie sie homogenisieren und ihre individuellen Differenzen verschwinden lassen. Diese Herrschaft üben natürlich nicht die Begriffe selbst aus, sondern diejenigen, die sie verwenden. Durch die Benennung als masterwords lässt sich diese Herrschaftsausübung an den Begriffen selbst sichtbar machen.