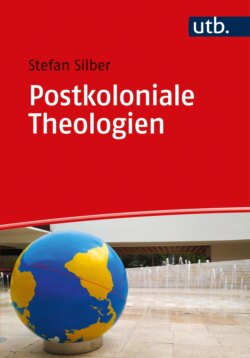Читать книгу Postkoloniale Theologien - Stefan Silber - Страница 20
2.6 (Post-)Koloniale Genderbeziehungen
ОглавлениеDie bisher beschriebenen kolonialen Diskurspraktiken wirken auch im Bereich der Geschlechterverhältnisse, und sie werden insbesondere von der postkolonialen feministischen Theologie auch kritisch analysiert. ↗ Othering und ↗ Essentialisierung sind klassische Methoden, um aus der Perspektive einer männlichen Dominanz Frauen als das ‚andere‘ oder das ‚zweite‘ Geschlecht zu klassifizieren. Sie dienten auch zur Bestätigung europäischer Überlegenheit in kolonialen Kontexten.
Auch binäre Geschlechtskonstruktionen tendieren dazu, dualistisch und zugleich exklusiv zu werden. Geschlechtliche Identitäten, die sich nicht in diesen Dualismus einordnen lassen, werden dann als abweichend oder unnatürlich, als Ausnahme oder schlichtweg als nicht existierend eingestuft. Die Beispiele in diesem Abschnitt kritisieren meistens eine patriarchal-dualistische Geschlechterkonstruktion ohne explizit auf die tiefere Problematik eines zweigeschlechtlichen Menschenbildes aufmerksam zu machen. Diese weiterführende Kritik wird von diesen feministischen Überlegungen jedoch mit angestoßen und muss immer im Blick bleiben1.
Auch im Bereich der Kirchen und der Theologie Verschlechterte Beziehungen zwischen den Geschlechtern durch den Kolonialismushat der Kolonialismus die Beziehungen zwischen den Geschlechtern häufig grundlegend zum Schlechteren verändert. → Musa DubeDube, Musa, Theologin und Bibelwissenschaftlerin aus Botswana, zeigt, wie der Umgang der europäischen Missionare mit den vorkolonialen Gottesauffassungen in Botswana von patriarchalen und eurozentrischen Vorurteilen geprägt war und zu innerkulturellen Störungen der Beziehungen zwischen den Geschlechtern führen konnte2.
Denn vor der Ankunft der MissionarInnen kannte die einheimische Bevölkerung ein System von höheren und niederen Gottheiten, die sie sich als genderneutral vorstellte. Auch die AhnInnen, die in diese spirituelle Struktur eingebunden waren, wurden mit einem geschlechtsneutralen Plural bezeichnet. Die „Priesterfiguren“3, die es in der Setswana-Kultur gab, konnten sowohl männlich als auch weiblich sein; Frauen hatten in der religiösen Tradition der ethnischen Gruppe der Batswana die Möglichkeit, ihre spirituellen Fähigkeiten in die Gemeinschaft einzubringen und sich mit göttlichen Wesen zu identifizieren und in Beziehung zu setzen.
Durch die Mission und die Einführung einer ins Setswana übersetzten Bibel wurde Modimo, die ehemals geschlechtsneutrale höchste Gottheit, vermännlicht und mit dem biblischen Vatergott identifiziert. Die niederen Gottheiten wurden zu Dämonen erklärt, und die priesterlichen Rollen und Funktionen, die vorher beiden Geschlechtern offenstanden, in die Nähe eines Hexenkultes gerückt. Auf diese Weise veränderte der Kolonialismus die Geschlechterbeziehungen auf drastische Weise:
„Der koloniale Prozess entfremdete die Batswana von ihren kulturellen Machtsymbolen und drängte ganz besonders die eingeborenen Frauen an den Rand; die Männer konnten sich zumindest mit Modimo, dem Gottvater identifizieren, und mit seinem Sohn, der das Oberhaupt der Kirche ist, so wie die Männer die Oberhäupter der Familie sind (Eph 5,22Eph 5,22 ).“4
Diese theologisch-biblische Unterordnung von (männlichem) Gott und Dämonen, Männern und Frauen, Ehemännern und Ehefrauen wurde in der kolonialen Praxis durch Bildungs- und Verwaltungseinrichtungen, Wirtschaftsstrukturen und Handelssysteme, die nach europäischem Vorbild patriarchal organisiert waren, verstärkt. Auf diese Weise paarte sich die essentialistische Gottesauffassung eurozentrischer Theologie mit einem hierarchischen Geschlechterdualismus und der patriarchalen Organisation des Alltags zu einer fatalen ↗ epistemischen Gewalt, deren Opfer vor allem Frauen waren.
→ KwokKwok, Pui-lan Pui-lan nennt weitere Beispiele aus Asien und Afrika dafür, wie gesellschaftliche und kulturelle Geschlechterverhältnisse durch den Kolonialismus verschlechtert wurden5. Die von ihr zitierte philippinische Ordensfrau und Theologin Mary John MananzanMananzan, Mary John beschreibt die drastischen Auswirkungen der katholischen spanischen Mission auf den Philippinen für die Rolle der Frauen in der Gesellschaft und ihr Selbstverständnis:
„Im 16. Jahrhundert brachte Spanien das Christentum und die westliche Zivilisation mit ihrer patriarchalen Prägung in die Philippinen. Die gleiche frauenfeindliche Grundstimmung, die in der westlichen Kirche herrschte, wurde auf die Inseln mitgebracht.“6
Während Frauen auf den Philippinen vor der Ankunft der MissionarInnen weitgehend gleiche Rechte und gesellschaftliches Ansehen genossen wie Männer, wurden ihre Aufgaben durch den Kolonialismus auf den Bereich des familiären Haushalts beschränkt und ihre gesellschaftliche Teilhabe massiv beschnitten. Die Begründungen mit biblischen und theologischen Argumenten lagen der europäischen Kultur der Zeit entsprechend auf der Hand.
Für die bolivianische Theologin Cecilia TitizanoTitizano, Cecilia „haben indigene Frauen unter der kolonialen Zivilisationsmission furchtbare Gewalt erlitten“7, da koloniale Ausbeutung und sexuelle Gewalt mit einer Dämonisierung indigener Kosmovision einherging, die weibliche Gottheiten sowie Lebenserfahrungen und Weisheit von Frauen gleichermaßen abwertete. Der Einsatz für die Würde und die Rechte der Frauen erfordert es für Titizano daher, Herausforderung des patriarchalen christlichen Vatergottesdas patriarchale christliche Gottesbild des Vatergottes herauszufordern.
Stattdessen verweist sie auf die vorkoloniale weibliche Gottheit der Mama Pacha (oder Pachamama) als einer Identifikationsfigur sowohl für weibliche als auch für indigene Erfahrungswelt. Als ‚Erd-Mutter‘ (eine mögliche Übersetzung des andinen ‚Mama Pacha‘) integriert sie auch agrarische und ökologische Welt- und Schöpfungserfahrung. TitizanoTitizano, Cecilia beansprucht nicht, den christlichen Vatergott durch Pachamama zu ersetzen, sondern macht auf die Chancen eines ganzheitlicheren Gottesbildes aufmerksam und beschreibt die Zerstörungen, die durch die koloniale Mission angerichtet wurden.
Eine andere postkoloniale Strategie der Wiederaneignung der weiblichen Aspekte der Gottheit beschreibt der peruanisch-mexikanische Theologe und Anthropologe Héctor LaportaLaporta, Héctor. Seine Feldforschungen in verschiedenen Marienwallfahrtsorten Lateinamerikas zeigten, dass die Figur der Gottesmutter von ihren VerehrerInnen kultisch und im Fest aufgewertet wurde:
„Meine ethnografischen Forschungen bestätigen, dass die Verehrung Unserer Lieben Frau von Guadalupe [in Mexiko] die koloniale Ordnung unterbricht und die Dogmen und die Politik der katholischen Kirche übertritt. Dabei bricht die Verehrung Unserer Lieben Frau von Guadalupe mit den auferlegten kolonialen Werten wie Macht, Rasse, Sprache und untergräbt die katholische Lehre und verlässt die Kontrolle des materiellen Raums der Kirche.“8
Zwar nicht in der liturgischen Sprache, wohl aber in der Festpraxis wird die Gestalt der Guadalupe wie eine Göttin – insbesondere als Verkörperung der altmexikanischen Gottheit Tonantzin – behandelt9. In dieser Praxis werden koloniale Muster durchbrochen. Gleichzeitig werden auch andere gesellschaftliche und kulturelle Werte durch das Fest übertreten. Die Prozession mit der Heiligenfigur und das anschließende Fest, die beide außerhalb des ummauerten kirchlichen Raums stattfinden, interpretiert LaportaLaporta, Héctor als ein Verlassen der kolonialen Ordnung und einen Bruch mit dieser. Selbst der exzessive Alkoholkonsum und die sexuelle Permissivität, die auf diesen Festen erlebt werden können, gelten ihm als Anzeichen eines Bruchs der kolonialen Gesellschaftsordnung, motiviert und unterstützt durch die Wiederaneignung der Göttin: „Maria springt von der offiziellen Bühne und nimmt aktiv an der fiesta teil, in der die Musik, das Trinken, Essen und Flirten ein wichtiger Teil der Feiern sind.“10
Kritisch anzumerken ist jedoch, dass Gewalt gegen Frauen in Lateinamerika häufig auch unmittelbare Folge des massiven Alkoholkonsums nicht zuletzt auf diesen Festen ist. Eine allzu unkritische Bewertung dieser Feiern als Bruch mit der kolonialen Ordnung verbietet sich daher. Dennoch zeigt das Beispiel, wie eine postkoloniale Auseinandersetzung mit religiösen Institutionen und Vorgängen zu einem entscheidenden theologischen Perspektivwechsel beitragen kann.
Diese wenigen Beispiele zu kolonialen und postkolonialen Geschlechterbeziehungen und Strategien ihrer Überwindung können nicht in das komplexe Feld postkolonialer feministischer Theologien oder Studien einführen11. Sie verweisen vorerst nur auf die grundlegende Bedeutung feministischer Kritik im Postkolonialismus. In den folgenden Abschnitten und Kapiteln werden noch mehr Beispiele aus feministischen Perspektiven beschrieben, die weitere wichtige Aspekte zu diesem transversalen Thema beitragen werden12.