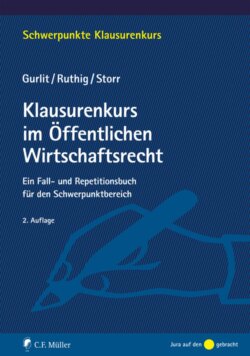Читать книгу Klausurenkurs im Öffentlichen Wirtschaftsrecht - Stefan Storr - Страница 117
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Anmerkungen
Оглавление[1]
Zum Verhältnis zum Gewerbesteuerrecht BVerwG, NVwZ 2011, 1390.
[2]
Vgl § 13d HGB; die Eintragung als solche basiert auf EU-Richtlinien, so dass nur Folgefragen an den Grundfreiheiten geprüft werden. S. etwa EuGH, NJW 2006, 3195 zur Unionsrechtskonformität des Kostenvorschusses für die Handelsregistereintragung.
[3]
Dazu schon BVerwG, NJW 1978, 904: die Pflichtmitgliedschaft finde ihren verlässlichen Anknüpfungspunkt allein in dem durch den Kammerpflichtigen selbst bestimmten Gegenstand, nicht dagegen in dem nur begrenzt steuerbaren und zeitlich schwankenden Umfang seiner beruflichen Tätigkeit.
[4]
Davon zu unterscheiden ist die Frage, inwieweit sich L als juristische Person auf Art. 12 GG als Deutschengrundrechte berufen kann (dazu bereits Fall 2 und Fall 4). Dass Art. 12 GG ein Deutschengrundrecht ist, kann allerdings genauso wenig ein Argument gegen seine Anwendung auf die Zwangsmitgliedschaft sein wie der Umstand, dass auch bei Berufsausübungsregelungen die Anforderungen strenger sind als diejenigen nach Art. 2 Abs. 1 GG, s. aber in dieser Richtung Hatje/Terhechte, NJW 2002, 1849.
[5]
Scholz, in: MDHS, GG, Art. 9 Rn 91; Manssen, in: v. MKS, GG, Bd. I, Art. 12 Rn 213.
[6]
BVerfGE 13, 181, 186; 97, 228, 253. An dieser berufsregelnden Tendenz fehlt es, wenn die betreffende Maßnahme weder auf eine Berufsregelung zielt noch sich unmittelbar auf die berufliche Tätigkeit auswirkt, BVerfGE 13, 181, 186.
[7]
BVerfGE 10, 354, 363 zur Pflichtmitgliedschaft von Ärzten. Zur IHK BVerwGE 107, 169 (171 ff); die dagegen gerichtete Verfassungsbeschwerde wurde nicht zur Entscheidung angenommen, s. BVerfG, NVwZ 2002, 335.
[8]
BVerfGE 15, 235, 239.
[9]
Ruthig, in: Ruthig/Storr, Rn 122, 127 mwN. Zu diesem Merkmal auch Cornils, FS Bethge (2009), 137, 151 ff.
[10]
Cornils, FS Bethge (2009), 137, 151.
[11]
BVerfGE 10, 89, 102; aA Ipsen, Staatsrecht II, Rn 592 ff, der die negative Vereinigungsfreiheit generell Art. 2 Abs. 1 GG zuordnet.
[12]
Pieroth/Schlink, Rn 790 ff.
[13]
Insbesondere BVerfG v. 12.7.2017 – 1 BvR 2222/12 u. 1106/13 Rn 78; s. zuvor BVerfGE 38, 281, 298; 50, 290, 353; BVerfG, NVwZ 2002, 335; s. auch BVerwGE 107, 169, 172; Di Fabio, in: MDHS, GG, Art. 2 Abs. 1 Rn 22. Zu weiteren Argumenten s. Kluth, NVwZ 2002, 298, 299.
[14]
Anders insbesondere Schöbener, VerwArch 2000, 374, 385 ff mwN. Auch bei der parallelen Vorschrift des Art. 11 EMRK werden öffentlich-rechtliche Korporationen von der Vereinigungsfreiheit nicht erfasst, vgl OVG Münster: Beschluss v. 26.5.2010 – 17 A 2617/08.
[15]
BVerfG v. 12.7.2017 – 1 BvR 2222/12 u. 1106/13 Rn 81 f.
[16]
Dort wird sie von der Rspr weiterhin zugrunde gelegt, s. nur BGHZ 178, 192. Um die Gründungstheorie wird sie nach dieser Auffassung nur bei solchen Gesellschaften ergänzt, die nach dem Recht eines anderen EU-Mitgliedstaates gegründet worden sind und dort ihren satzungsmäßigen Sitz haben. Diese sind nach Maßgabe ihres Gründungsrechts im Inland rechts- und parteifähig, vgl BGHZ 154, 185 – Überseering; BGH, NJW 2005, 1648. Für die Frage der Grundrechtsfähigkeit spielt sie keine Rolle, da eine solche sich als inländische „juristische Person“ darstellt, was bei Art. 19 Abs. 3 GG keine Rechtsfähigkeit verlangt. Zu den gewerberechtlichen Konsequenzen aus der Gründungstheorie vgl Ruthig, in: Ruthig/Storr, Rn 264.
[17]
BVerfGE 129, 78. S. auch Ruthig, in: Ruthig/Storr, Rn 152; anders wäre bei (selbstständigen) Tochterunternehmen zu entscheiden.
[18]
An dieser Stelle zeigt sich, dass der obige Streit, was die Subsumtion der Zwangsmitgliedschaft unter ein bestimmtes Grundrecht angeht, keineswegs rein dogmatischer Natur ist, da Art. 9 Abs. 2 GG darüber hinausgehende Anforderungen an eine Rechtfertigungsmöglichkeit aufstellt.
[19]
BVerfG, NVwZ 2002, 335.
[20]
BVerfGE 38, 281, 299; BVerfG, NVwZ 2002, 335, 336.
[21]
Dazu insbes der ausführlich begründete Nichtannahmebeschluss BVerfG, NVwZ 2002, 335, 337; BVerfG v. 12.7.2017 Rn 88 ff.
[22]
BVerfG v. 12.7.2017 – 1 BvR 2222/12 u. 1106/13 Rn 94.
[23]
BVerfG aaO. Rn 102.
[24]
S. auch Ruthig, in: Ruthig/Storr Rn 142; vgl allg bereits Emde, Die demokratische Legitimation der funktionellen Selbstverwaltung, 1991, S. 435 f.
[25]
S. auch VG Ansbach, GewArch 2010, 301; anders verhält es sich bei der Handwerkskammer, vgl Ruthig, in: Ruffert, Europäisches Sektorales Wirtschaftsrecht § 3 Rn 73 ff.
[26]
EuGH, Rs. 8/74, Slg 1974, 837 Rn 5.
[27]
Frentzel/Jäkel/Junge, IHKG, 7. Aufl 2009, § 2 Rn 7; Kluth, NVwZ 2002, 298, 301; Burgi, in: Kluth, Jahrbuch des Kammerrechts 2002, S. 23, 35.
[28]
Classen, EWS 1995, 97, 103. Für eine Begrenzung auf den Marktzugang auch Kingreen, Grundfreiheiten, in: v. Bogdandy, Europäisches Verfassungsrecht, 2009, 705, 732 ; Eberhartinger, EWS 1997, 43, 49.
[29]
Diesen Ansatz ablehnend Diefenbach, GewArch 2006, 217. Der EuGH hat sich bislang noch nicht abschließend geäußert. Allerdings hat er – ohne die dort nicht entscheidungserhebliche Frage zu vertiefen – im Fall Corsten (der die Dienstleistungsfreiheit betraf) lediglich die Rechtfertigung einer Pflicht zur Mitgliedschaft in der Handwerkskammer problematisiert, eine Beschränkung also ohne nähere Erörterung angenommen, vgl EuGH v. 3.10.2000, Rs. C-58/98 – „Josef Corsten“, Slg 2000, I-7919 = EuZW 2000, 763. S. dazu Ruthig, in: Ruthig/Storr, Fall 3 (Rn 46).
[30]
So aber Kluth, Funktionale Selbstverwaltung, 1997, S. 337 f. Hier gilt nichts anderes als im Verfassungsrecht, wo auch das BVerfG in der Pflichtmitgliedschaft zu Recht einen (rechtfertigungsbedürftigen) Eingriff in die Freiheitssphäre gesehen hat, vgl oben Rn 67 ff.
[31]
Vgl zur Zusammenfassung des Prüfprogramms EuGH v. 30.11.1995, Rs. C-55/94 – „Gebhard“, Rn 37, Slg 1995, I-4165, 4197. dazu Ruthig, in: Ruthig/Storr, Rn 63 f.
[32]
Kluth, Funktionale Selbstverwaltung, S. 339. Insofern ist zu berücksichtigen, dass der EuGH bei der Anerkennung der von den Mitgliedstaaten mit einer Regelung verfolgten Zwecke sehr großzügig ist, dann aber hohe Anforderungen an die Kohärenz der getroffenen Regelungen stellt, dazu Ruthig, in: Ruthig/Storr, Rn 68 ff; ders., in: Ruffert, Europäisches Sektorales Wirtschaftsrecht § 3 Rn 75.
[33]
Dies dürfte grundsätzlich auch der Auffassung des EuGH entsprechen, s. bereits EuGH v. 27.10.1983, NJW 1984, 2222, 2223. Im Zusammenhang mit einer Berufsgenossenschaft zuletzt EuGH v. 5.3.2009, Rs. 350/07, EuZW 2009, 290 m. Anm. Gundel. Zweifelhaft erscheint allerdings dabei die gängige Lesart in Deutschland, dass der EuGH die Zwangsmitgliedschaft in dieser Entscheidung (uneingeschränkt) bestätigt habe, so etwa Martens, GewArch 2011, 15. Ausführlicher hierzu Ruthig, in: Ruffert, Europäisches Sektorales Wirtschaftsrecht § 3 Rn 75.
[34]
Näher zur Regelungssystematik im Bereich der sog. „reglementierten Berufe“ am Beispiel des Handwerksrechts Ruthig, in: Ruffert, Europäisches Sektorales Wirtschaftsrecht § 3 Rn 30 ff.
[35]
Vgl zur stRspr BVerwG, GewArch 1999, 73; sehr weit gehend BVerwG, NVwZ-RR 2017, 427. Die Anknüpfung an die Gewerbesteuermessbeträge verweist daher nach dem BVerwG nicht nur auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Kammermitglieder, sondern zugleich auf das Gewicht des Vorteils, den der Beitrag abgelten soll. Dies basiert auf der Überlegung, dass leistungsstarke Unternehmen aus der Tätigkeit der Kammer in der Regel einen höheren Nutzen ziehen können als wirtschaftlich schwächere. Die Kammern vertreten in erster Linie die Gesamtbelange ihrer Mitglieder, so dass die Vorteile der einzelnen Kammerzugehörigen nicht konkret messbar sind. Daher hat auch der Kammerbeitrag keinen unmittelbaren wirtschaftlichen Vorteil auszugleichen, der sich bei dem einzelnen Kammerangehörigen niederschlägt.
[36]
BVerfG, GewArch 2002, 111; BVerwG, GewArch 1998, 410; BVerfG v. 12.7.2017 – 1 BvR 2222/12 u. 1106/13 Rn 105 ff.
[37]
In der Praxis führt dies dazu, dass häufig mehr als ein Drittel der Mitglieder einer IHK tatsächlich keine Beiträge zahlen.
[38]
VG Würzburg, GewArch 2011, 125: „Für eine entsprechende Anwendung dieser Vorschriften auf den vorliegenden Fall besteht kein Bedürfnis. Hätte der Gesetzgeber dies gewollt, hätte er dies geregelt. Die Beitragsbefreiung stellt nun einmal auf das formale Element der Eintragung im Handelsregister ab. Wer für die Eintragung optiert, kann nicht nur selektiv die Vorteile des Kaufmannstandes genießen, sondern muss auch die Nachteile in Kauf nehmen“.
[39]
So auch VG Würzburg, GewArch 2011, 125; ausf Rieger, in: Kluth, Handbuch des Kammerrechts, 2. Aufl, § 13 Rn 107.
[40]
Folgt man den Grundsätzen der Rechtsprechung zur Niederlassungsfreiheit von Gesellschaften (vgl insb EuGH v. 30.9.2003, Rs. C-167/01 – „Inspire Art“, Slg 2003 I-10155; dazu Ruthig, in: Ruthig/Storr, Rn 237ff) sind Anforderungen an die Errichtung von Zweigniederlassungen zumindest rechtfertigungsbedürftig. Eine solche Rechtfertigung für die Beitragspflicht ist nicht ohne weiteres ersichtlich, wie das Sekundärrecht bestätigt. Art. 16 Abs. 2 lit. b der DienstleistungsRL lässt die Pflichtmitgliedschaft nur noch in den ausdrücklich gemeinschaftsrechtlich geregelten Fällen zu und auch Art. 6 lit. a der BerufsanerkennungsRL lässt eine Pro-Forma-Mitgliedschaft nur zu, wenn sie für den Betreffenden keine Kosten verursacht, s. auch Schmidt-Kessel, in: Schlachter/Ohler, Dienstleistungsrichtlinie, Art. 16 Rn 56.
[41]
Zu solchen näher Ruthig, in: Kopp/Schenke, § 40 Rn 55.
[42]
GmS-OGB,; ausführlich zu den bei der Auslegung dieser Ausgangsthese verbundenen Schwierigkeiten Ruthig, in: Kopp/Schenke, § 40 Rn 6 ff.
[43]
S. auch Schöbener, in: Kluth, Handbuch des Kammerrechts, 2. Aufl, § 14 Rn 32. Nicht überzeugend BGH, NJW 1987, 329, der bei einer Äußerung einer Handwerkskammer im Wettbewerb (auch) eine Streitigkeit nach § 1 UWG angenommen und für diese den Zivilrechtsweg bejaht hatte. Krit zur damit verbundenen Annahme einer Doppelnatur Ehlers, in: Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner, VwGO § 40 Rn 287. Im vorliegenden Fall ist diese jedoch schon deswegen nicht einschlägig, weil die Äußerung gerade nicht „zu Zwecken des Wettbewerbs“ erfolgte.
[44]
StRspr, vgl BVerwGE 95, 25, 27. Speziell zum Kammerrecht BVerwGE 112, 69; Jahn, GewArch 2001, 146, 151.
[45]
Kopp/Schenke, VwGO § 43 Rn 28; Hufen, Verwaltungsprozessrecht, § 18 Rn 5 f.
[46]
So allerdings BVerwG 112, 69, 71; OVG Münster, GewArch 2003, 418; krit auch hier die Literatur, vgl Schöbener, in: Kluth, Handbuch des Kammerrechts, 2. Aufl, § 14 Rn 84.
[47]
S. nur zum Streit um die (vorläufige) Vollstreckbarkeit eines entsprechenden Leistungsurteils VGH Mannheim v. 3.11.2011 – 6 S 2904/11.
[48]
BVerwGE 107, 169, 174 f; 112, 69, 72. Ausf Nachweise zum Unterlassungsanspruch im Rahmen der Begründetheitsprüfung unter II 1.
[49]
Ausf Laubinger, VerwArch. 80 (1989), 261, 289 ff. Zum öffentlich-rechtlichen Unterlassungsanspruch auch Antweiler, NVwZ 2003, 1466 (bezogen auf kommunalwirtschaftliche Betätigung); Büllesbach/Köckerbauer/Peter, JuS 1991, 373; Kemmler, JA 2005, 908. Das BVerwG hat zu dieser Frage bisher noch keine eindeutige Stellung bezogen.
[50]
BVerwGE 112, 69, 72; OVG Münster, GewArch 2000, 378. Das Verhältnis zum allgemeinen öffentlich-rechtlichen Unterlassungsanspruch ist nicht geklärt. Jahn, GewArch 2002, 353 sieht darin einen „mitgliedschaftsrechtlichen, also öffentlich-rechtlichen Unterlassungsanspruch“, will damit aber nur von zivilrechtlichen Ansprüchen abgrenzen. Die grundlegende Untersuchung von Laubinger, VerwArch 80 (1989), 261, 268 beschränkt sich von vornherein auf andere in der Praxis häufigere Fallkonstellationen.
[51]
Zu dieser „Anwendungserweiterung des deutschen Grundrechtsschutzes“ ausf BVerfG, NJW 2011, 3428, 3430 ff.
[52]
BVerwGE 122, 69, 72 f; VGH München, GewArch 2007, 417, 418; krit dazu weite Teile der Literatur, vgl Fröhler/Oberndorfer, Körperschaften des öffentlichen Rechts und Interessenvertretung, 1974, S. 77; Laubinger, VerwArch 74 (1983), 263, 272 ff; Hendler, DÖV 1986, 675, 683; Kluth, DVBl. 1986, 716; ausf Schöbener, in: Kluth, Handbuch des Kammerrechts, 2. Aufl, § 14 Rn 97 mwN.
[53]
S. auch Schöbener, in: Kluth, Handbuch des Kammerrechts, 2. Aufl, § 14 Rn 98; Jahn, GewArch 2001, 146, 151. Auch BVerfG, NVwZ 2002, 335, 337 argumentiert bei der Prüfung der Zumutbarkeit der Pflichtmitgliedschaft ausdrücklich mit dem mitgliedschaftsrechtlichen Unterlassungsanspruch.
[54]
Zu dieser Differenzierung BVerwGE 112, 69, 72 f; Schöbener, in: Kluth, Handbuch des Kammerrechts, 2. Aufl, § 14 Rn 98.
[55]
Möllering, in: Frenzel/Jäkel/Junge, IHKG, 7. Aufl, § 1 Rn 18.
[56]
BVerwG, GewArch 2010, 400; s. auch VGH Mannheim, GewArch 2001, 422, 424; Schöbener, in: Kluth, Handbuch des Kammerrechts, 2. Aufl, § 14 Rn 106.
[57]
Möllering, in: Frenzel/Jäkel/Junge, IHKG, 7. Aufl, § 1 Rn 6.
[58]
BVerwG, GewArch 2010, 400 m Anm Eisenmenger. S. auch Möllering, GewArch 2011, 56; Schöbener, in: Kluth, Handbuch des Kammerrechts, 2. Aufl, § 14 Rn 106.
[59]
Frenz, Hdb. Europarecht, Bd. 1, Rn 316.
[60]
S. EuGH v. 12.12.1974, Rs. C-36/74 – ,,UCI“, Rn 4 ff, Slg 1974, 1405, 1418 ff.
[61]
EuGH v. 17.6.1981, Rs. C-113–80 – ,,Kommission/Irland“, Rn 21, Slg 1981, 1625; s. auch Epiney, in: Ehlers, Europäische Grundrechte und Grundfreiheiten, § 8 Rn 15.
[62]
Forsthoff, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der EU Art. 49 AUEV Rn 76.
[63]
EuGH, Rs. C-321-324/94, Slg 1997, I-2324 (2374, Rn 42 ff) – Pistre.
[64]
Wichtig war an dieser Stelle zu erkennen, dass vorliegend die typische „Buy Irish“-Konstellation nicht gegeben ist, da es dort, wie in den Folgeentscheidungen auch, um einen Verstoß gegen die Warenverkehrsfreiheit gegenüber solchen Unternehmen ging, die in dem entsprechenden Land keine Produktions- und Vertriebsstätte unterhielten, der grenzüberschreitende Bezug also (anders als hier) ohne Weiteres bejaht werden konnte.
[65]
Dazu näher Ruthig, in: Ruthig/Storr, Rn 66.
[66]
EuGH, Rs. 8/74, Slg 1974, 837 Rn 5.
[67]
Vgl die vergleichbare Argumentation des EuGH in: Rs. C-325/00, Slg 2002, I-9977 – CMA.
[68]
EuGH verb. Rs. C-267 u. C-268/91, Slg 1993, I-6097, Rn 17 – Keck und Mithouard. Dazu Ruthig, in: Ruthig/Storr, Rn 61.
[69]
EuGH, Rs. C-120/78, Slg 1979, 649 Rn 8 – Cassis de Dijon. Zur Frage, ob alle oder nur offen diskriminierende Maßnahmen vom Anwendungsbereich der Formel ausgenommen sind vgl Kingreen, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 34-36 AEUV Rn 82 ff; kritisch zu der dogmatisch „nicht zu befriedigenden“ Rechtsprechung des EuGH Streinz, Europarecht Rn 946.
[70]
EuGH, Rs. 13/78, Slg 1978, EuGH, Slg. 1978, S. 1935, Rn 31 – Eggers.
[71]
Ehlers, JZ 1996, 776, 781; Wernsmann, Jura 2000, 657; aA Bauer/Kahl, JZ, 1995, 1077, 1085.
[72]
Herdegen, in: MDHS, GG, Art. 1 Abs. 1 Rn 94.
[73]
Vgl BVerfGE 105, 252, 253 ff. Ebenso zum Vergaberecht BVerfGE 116, 135, 151 f; 116, 202, 221.
[74]
Vgl auch Ruthig, in: Ruthig/Storr, Rn 118. Ausf Kritik an der Glykolweinentscheidung bei Schoch, NVwZ 2001, 193, 198; grundlegend zur Rechtsprechung des BVerfG zum staatlichen Informationshandeln ders., NVwZ 2011, 193.
[75]
BVerfGE 105, 279, 292 ff.
[76]
S. auch BVerwG, NJW 1996, 3161, 3162 zur Veröffentlichung von Warentests durch eine Landwirtschaftskammer; s. auch Schöbener, in: Kluth, Handbuch des Kammerrechts, 2. Aufl, § 14 Rn 129; aA noch OVG Koblenz, GewArch 1994, 234, 235 f.
[77]
OVG Münster, GewArch 1990, 136; Tettinger, KammerR, B III 4b; Frentzel/Jäkel/Junge, IHKG, 7. Aufl, § 6 Rn 3.
[78]
Ausf und krit am Beispiel des kommunalrechtlichen Organstreitverfahrens Schenke, Verwaltungsprozessrecht Rn 228.
[79]
BVerwG, NVwZ 1989, 470; OVG Münster, NVwZ-RR 2002, 135.
[80]
BVerfG v. 12.7.2017 – 1 BvR 2222/12 u. 1106/13.
[81]
Allg zu den Anforderungen an die Geltendmachung der Rechtsverletzung Schenke, Verwaltungsprozessrecht Rn 493 ff.
[82]
Schenke, Verwaltungsprozessrecht Rn 462.
[83]
VGH Kassel, 18.8.1999 – 8 U 2200/99.
[84]
S. OVG Münster, GewArch 2007, 113 auch zur Anwendbarkeit auf Informationsanträge von Mitgliedern der Vollversammlung, die sie zugleich als natürliche Personen stellen.
[85]
So die Lösung des OVG Münster, NVwZ 2003, 1526. Diesen Ansatz ablehnend die Revisionsentscheidung BVerwGE 120, 255.
[86]
Frentzel/Jäkel/Junge, IHKG § 4 Rn 1.
[87]
Groß, in: Kluth, Handbuch des Kammerrechts, 2. Aufl, § 7 Rn 23.
[88]
Zum Informationsanspruch eines Abgeordneten BVerfGE 70, 324, 335.
[89]
Groß, in: Kluth, Handbuch des Kammerrechts, 2. Aufl, § 7 Rn 23.
[90]
BVerfGE 107, 59; daran anknüpfend für das Akteneinsichtsrecht von Mitgliedern der Vollversammlung BVerwGE 120, 255.
[91]
Dazu Groß, in: Kluth, Handbuch des Kammerrechts, 2. Aufl, § 7 Rn 15.
[92]
S. auch BVerwGE 120, 255.
[93]
Vgl BVerfGE 70, 324, 342 f für den Abgeordneten. Ausf Groß, Das Kollegialprinzip in der Verwaltungsorganisation S. 319 mwN.
[94]
Nicht überzeugend daher BVerwGE 120, 255, 261 f, das allein mit der einfachgesetzlichen Ausgestaltung argumentiert und Parallelen zum Kommunalverfassungsrecht ausdrücklich ablehnt und auf das Demokratieprinzip nur sehr allgemein eingeht.
[95]
Ebenso OVG Münster, NVwZ 2003, 1526; Groß, in: Kluth, Handbuch des Kammerrechts, 2. Aufl, § 7 Rn 101; aA BVerwGE 120, 255. Nicht ohne weiteres übertragbar die Entscheidung BGH, NJW-RR 2001, 996, 997 zur BRAO. Dort ist die erforderliche Unterrichtung und Information der Kammerversammlung zu erteilen (vgl § 73 Abs. 2 Nr. 7 BRAO).
[96]
Einen Anspruch gar aus Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG bejahend: OVG Lüneburg, NJW 1996, 1489, 1490; für einen Anspruch aus allgemeinen rechtsstaatlichen Gründen Kopp/Schenke, VwGO, § 100 Rn 2; Lang, in: Sodan/Ziekow, § 100 Rn 13.
[97]
Vgl § 1 Abs. 1 IFG Bund sowie etwa § 4 Abs. 1 iVm § 2 IFG NRW; vgl zu letzterem OVG Münster, GewArch 2007, 113, insbesondere auch zu der Problematik, dass dem einzelnen Mitglied über das einschlägige IFG als natürliche Person ein weiterreichender Auskunftsanspruch zukommen kann, als sich ein solcher aus der Stellung als Vollversammlungsmitglied ergibt. Zur Zulässigkeit solcher Regelungen neben dem IHKG BVerwG, GewArch 2007, 478.