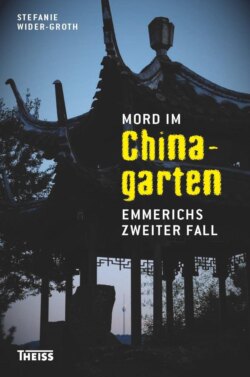Читать книгу Mord im Chinagarten - Stefanie Wider-Groth - Страница 13
4
ОглавлениеWährend er an Frenzels Seite stadteinwärts gefahren wurde, drückte Emmerich wortreich seine Hoffnung aus, von esoterischem Brimborium wie beispielsweise Halbedelsteinen, die etwas über die Qualität der gerade waltenden Schicksalskräfte aussagten, verschont zu bleiben.
„Wird schon nicht so schlimm werden“, unterbrach Frenzel irgendwann in fürsorglichem Ton das Lamento seines Vorgesetzten. „Wir müssen doch nicht einmal zu ihr in die Wohnung. Sie wartet vor dem chinesischen Garten auf uns.“
„Wunderbar“, entgegnete Emmerich grimmig. „Ist dir schon aufgefallen, dass es schneit? Ich werde mir den Tod holen.“
„Du wirst doch wohl den Fundort unserer Leiche selbst in Augenschein nehmen wollen. Hast du keinen Mantel dabei?“
„Hängt noch im Büro.“
„Oh Mann.“ Frenzel hatte die Kurve erreicht, an der der chinesische Garten lag, bog nach links ab und parkte im Halteverbot. „Du lernst es nie, was? Kann man dir eigentlich auch mal etwas recht machen?“
Vor dem Tor zum Garten stand eine dick eingemummelte Frauengestalt und trat von einem Fuß auf den anderen. Emmerich schlug den Kragen seines bejahrten Cordsamtjacketts hoch und stieg aus.
„Tag, Frau Schloms“, grüßte er knapp und überlegte, ob es sich lohnte, seine Hand aus der Hosentasche zu ziehen. Eleonore Schloms machte keine Anstalten, ihm die ihrige zu reichen und so beließ er sie dort.
„Herr Emmerich“, sagte Frau Schloms. „Ich habe wirklich nicht erwartet, Sie so schnell wiederzusehen.“
„Ganz meinerseits“, gab Emmerich höflich zurück.
„Der Mann ist also gestorben“, stellte Frau Schloms, in den Kragen ihres sicherlich warmen Mantels hinein, fest. „Und Sie untersuchen den Fall. Das wird eine schwierige Sache.“
„Wie kommen Sie darauf?“, fragte Frenzel, der hinzugetreten und im Fall Diebold nicht mit Eleonore Schloms in Berührung gekommen war.
„Meine Karten sagen mir das, junger Mann. Dieser Tote trug ein Geheimnis mit sich herum.“
„Das lassen Sie mal unsere Sorge sein“, sagte Emmerich streng. „Wo haben Sie ihn gefunden?“
„Kommen Sie mit.“
Eleonore Schloms wandte sich um und ging in den Garten hinein. Trotz der nassen, weißen Flocken, die immer dichter vor seinen Augen wirbelten, sich aber auf dem Boden sofort in Wasser verwandelten, fühlte Emmerich sich in eine andere Welt versetzt. Der Garten war nicht besonders groß, aber von einer beinahe zauberhaften Anmut. Ein besseres Wort fiel ihm nicht ein, obwohl er normalerweise nicht zu poetischen Beschreibungen neigte. Sein erster Blick fiel auf einen kleinen Wasserfall, der zwischen künstlich angelegten Felsen in einen Teich hinunterplätscherte. Trittsteine führten hindurch auf die andere Seite. Rechts stand ein weißes Gebäude mit einem Dach, das Emmerich für typisch chinesisch hielt, er kannte sich da nicht besonders gut aus. Daneben blühte, in zartem Rosa, ein Baum und dieser Baum war es, der das Ganze aussehen ließ, wie eine asiatische Postkartenidylle. Eleonore Schloms folgte nicht den Trittsteinen und schenkte weder dem Baum noch dem Gebäude besondere Aufmerksamkeit, sondern stieg neben dem Wasserfall, der von einer Pagode gekrönt wurde, ein paar Stufen hinauf. Von hier eröffnete sich eine Aussicht über den Stuttgarter Talkessel, die man bei besserem Wetter sicherlich genießen konnte, doch jetzt fuhr ein kalter Windstoß durch Emmerichs dünnes Jackett und ließ ihn zittern.
„Da hat er gesessen“, sagte Eleonore Schloms und wies auf eine steinerne Bank, die in exponierter Lage aufgestellt worden war. „Ganz still und ein bisschen schief. Das Wetter war so ähnlich wie jetzt. Deshalb habe ich mich gewundert und ihn angesprochen. Er war aber schon ziemlich … na, ja … hinüber.“
Emmerich sah fröstelnd die Bank an und drückte sich in den Windschatten eines künstlichen Felsens.
„Um wie viel Uhr war das?“
„Zwanzig nach sieben, schätze ich. Glücklicherweise hatte ich mein Handy dabei.“
„Sie haben den Notarzt gerufen?“
„Was hätte ich sonst tun sollen?“
„Nichts, vermutlich.“ Emmerich suchte mit den Augen den Boden ab und wunderte sich über die mit zahllosen leeren Sekt- und Schnapsflaschen gefüllten Papierkörbe.
„Warum waren Sie in dieser Herrgottsfrühe hier?“
„Ich liebe diesen Garten. Hier kommen um diese Zeit selten Leute her. Ich finde, die Umgebung reinigt den Geist. Verstehen Sie etwas von Feng-Shui?“
„Nein.“
„Ich auch nicht. Aber hier kann ich fühlen, dass es funktioniert.“
„Aha“, sagte Emmerich wenig einfallsreich, stieg die Stufen wieder hinunter und strebte dem Ausgang zu, einem zweiflügeligen Tor, das in eine weiße Mauer eingefügt war. Vor dem Tor stand, umgeben von Gestrüpp, ein weißes Blechschild, das ihm beim Hineingehen nicht aufgefallen war. Die Aufschrift besagte, dass der Garten aufgrund seiner filigranen Beschaffenheit zwischen 20.00 Uhr abends und 7.00 Uhr morgens geschlossen wurde. Die Mitarbeiter des Gartenamtes hatten das Recht, noch verweilende Besucher hinauszuwerfen.
„Also dann vielen Dank, Frau Schloms“, setzte Emmerich zur Beendigung der Ortsbegehung an und sah sich nach Frenzel um, der hinter der weißen Mauer zurückgeblieben war.
„Er hat noch etwas gesagt, bevor die Sanitäter gekommen sind“, sagte Eleonore Schloms und stieß kleine, weiße Atemwölkchen aus. „Falls Sie das interessiert.“
„Was denn?“
„Es war sehr schwer zu verstehen. Ich habe lange darüber nachgedacht und die Worte aufgeschrieben, die ich glaubte, gehört zu haben. Hier.“
Emmerich wurde ein kleiner, gelber Notizzettel gereicht.
„Nelken sehen“, las er stirnrunzelnd. „Atmosphäre … Sieger … geblieben. Was soll das bedeuten?“
„Ich sagte doch, es wird eine schwierige Sache“, meinte Eleonore Schloms von oben herab. „Aber Sie werden erfolgreich sein.“
„Wie beruhigend für mich.“ Frenzel trat durch das Tor und warf einen letzten Blick in den Garten. „Fertig, Mirko? Können wir gehen?“
„Schwierige Sache“, grummelte Emmerich, als sie wenig später zurück im Büro waren. „Feng-Shui und geistige Reinigung. Hast du die Schnapsflaschen gesehen? Bestimmt ausgesprochen wirksam, was das anbelangt. Ich kann diese Orakelei nicht ausstehen. Was weiß jemand wie die Schloms schon von unserem Job?“
„Bleib cool, Mann. Du hast sie hinter dir.“ Frenzel nickte Frau Sonderbar, deren Büro sich mittlerweile wieder im gewohnt aufgeräumten Zustand befand, freundlich zu. „Haben Sie gefunden, was Sie gesucht haben?“
„Ja“, sagte Frau Sonderbar schlicht, was Emmerich dazu veranlasste, sie wie vom Donner gerührt anzustarren.
„Ja?“, wiederholte er ungläubig. „Das Gesicht des Toten ist tatsächlich auf einem alten Fahndungsplakat? Sie müssen ein Gedächtnis haben wie ein Elefant.“
„Im Allgemeinen kann ich mir Gesichter ganz gut merken“, erklärte Frau Sonderbar mit einem dünnen Lächeln und griff nach einem gerollten Stück Papier. „Bitte sehr.“
Emmerich nahm das Papier und zog es auseinander.
„Verdacht auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung“, las er laut vor. Unter der Überschrift war das schwarz-weiße Foto eines ungefähr Dreißigjährigen mit langem, dunklem Haar und einem sauber gestutzten Vollbart zu sehen. „Nopper, Peter, geboren am 17. April 1954“, las Emmerich weiter. „Vermisst seit dem 18. Dezember 1989. Mutmaßlicher Unterstützer der Rote Armee Fraktion (RAF). Peter Nopper ist 1,78 Meter groß und schlank. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.“
„RAF?“ Frenzel ließ einen leisen Pfiff hören. „Da müssen wir wohl das LKA benachrichtigen.“
„Abwarten.“ Emmerich rollte das Papier wieder zusammen und sah seine Sekretärin nachdenklich an. „Warum haben Sie das denn aufgehoben? Ist ja immerhin schon fast zwanzig Jahre her?“
„Aus familiären Gründen“, sagte Frau Sonderbar ausweichend. „Frau Nopper war eine Kundin meines Vaters.“
„Also war er verheiratet?“
„Darüber weiß ich nichts. Ich rede von seiner Mutter. Sie war eine wirkliche Dame. Er dagegen …“
„Sprechen Sie ruhig weiter.“
Frau Sonderbars Gesicht rötete sich einmal mehr.
„Ein Casanova“, schnaubte sie, trotz des zeitlichen Abstandes nach wie vor sichtlich empört. Emmerich vermutete, dass diese Empörung weniger auf die „familiären Gründe“, sondern auf persönliche Erfahrungen der jungen Frau Sonderbar zurückzuführen war, behielt diese Annahme aber für sich.
„Lebt sie noch, die Mutter?“, fragte er sachlich.
Frau Sonderbar schüttelte heftig den Kopf.
„Sie ist vor einigen Jahren verstorben, ich habe die Anzeige gesehen. Aber fragen Sie mich nicht, wann genau das war.“
„Warum haben wir seine Fingerabdrücke nicht im Archiv, wenn er bei der RAF war?“, wollte Frenzel wissen.
„Ich glaube, das kann ich erklären“, meinte Frau Sonderbar, deren Gesichtsfarbe wieder ihren normalen Ton angenommen hatte. „Es gab damals keinen konkreten Verdacht gegen Peter Nopper. Nur Gerüchte. Er soll konspirative Wohnungen angemietet und mit RAF-Mitgliedern verkehrt haben. Richtig los ging dieses Geschwätz aber erst, als er plötzlich sang- und klanglos verschwunden ist.“
„So, wie der aussah“, meinte Emmerich lakonisch, „wundert mich das gar nicht. In den 70er-Jahren waren lange Haare bei einem Mann Grund genug für einen derartigen Verdacht.“
„Sie sagten aber doch, dass er erst Ende der 80er-Jahre vermisst wurde“, vergewisserte sich Frenzel.
„Kurz nach dem Fall der Mauer“, nickte Frau Sonderbar. „Deshalb kann ich mich ja noch so gut an den Zeitpunkt erinnern.“
„Liebe Güte“, seufzte Emmerich, der die Geschehnisse dieses denkwürdigen Herbstes noch in lebhafter Erinnerung hatte, kopfschüttelnd. „Auch das ist schon wieder fast zwanzig Jahre her. Und seither ist er nicht wieder aufgetaucht?“
„Ich bin leider noch nicht dazugekommen, es zu überprüfen.“ Frau Sonderbar wies mit dem Kinn auf einen Stapel Akten. „Es ist nämlich nicht so, dass ich in diesem Büro nichts zu arbeiten hätte.“
„Ach, Hildegard …“, schmachtete Mirko mit verdrehten Augen und erntete ein angewidertes „Pfft“.
„Lass das“, raunzte Emmerich ihn an. „Komm lieber mit in mein Büro.“
Er ging voraus, entledigte sich seiner feuchten Jacke und nahm hinter seinem Schreibtisch auf dem ihm angestammten, in jahrelanger Polizeiarbeit mühevoll durchgesessenen Drehstuhl Platz. Statt des gewohnten leisen Ächzens gab der Stuhl ein unheilvolles Quietschen von sich und fuhr samt seinem Besitzer mit sachtem Schwung in die Tiefe.
„Heiligs Blechle“, fluchte Emmerich, dessen Nase gerade noch so über die Kante der Schreibtischplatte ragte, und rappelte sich mühsam wieder hoch. „Was hat das jetzt zu bedeuten?“
„Ich schätze, es bedeutet, dass du dich mit einem moderneren Sitzmöbel anfreunden solltest“, grinste Frenzel amüsiert.
„Quatsch.“ Emmerich bückte sich und suchte unter der Sitzfläche nach einem geeigneten Knopf, der den Stuhl wieder auf sein herkömmliches Niveau bringen konnte. „Der da ist noch pfenniggut.“
„Selbstverständlich“, entgegnete Frenzel trocken. „Und vollkommen zeitgemäß. Steht höchstens so lange da, wie Herr Nopper vermisst wird.“
„Man muss nur ein bisschen ruckeln“, verteidigte Emmerich seinen geliebten Weggefährten und führte die entsprechenden Bewegungen aus. „Siehst du, so. Mein Kreuz ist an diesen Stuhl gewöhnt.“ Vorsichtig setzte er sich wieder, alles blieb ruhig. „Na, bitte. Also weiter im Text. Unser Toter hat jetzt immerhin einen Namen.“
„Eine ordentliche Identifizierung ist das nicht“, gab Frenzel zu bedenken und setzte sich gegenüber hin. „Ein altes Plakat und eine unbekannte Anruferin.“
„Aber ein Anhaltspunkt.“ Emmerich vollführte einige behutsame Drehbewegungen und nickte zufrieden. „Ich habe mir was überlegt, da oben im chinesischen Garten.“
„Respekt“, entgegnete Frenzel. „Bei diesen Temperaturen.“
„Rechne mal nach“, fuhr Emmerich unbeirrt fort. „Um sieben Uhr morgens wird der Garten geöffnet, das stand auf diesem Schild. Zwanzig Minuten später hat die Schloms den Mann gefunden. Wie soll man sich das praktisch vorstellen?“
„Er hatte getrunken“, meinte Frenzel. „Vielleicht war er depressiv. Wenn einem einmal alles egal ist …“
„Nein.“ Emmerich schüttelte den Kopf. „Ich mache es ungern, aber ich muss Zweigle recht geben. Irgendetwas stimmt da nicht. Bei diesem Wetter, um diese Zeit … selbst wenn ich sturzbesoffen wäre, würde ich mir für einen Selbstmord andere Umstände aussuchen.“
Es klopfte an der Tür, Frau Sonderbar kam mit einer Mappe in der Hand herein und legte sie vor Emmerich auf den Schreibtisch.
„Von der KTU“, sagte sie ausdruckslos, wandte sich an Frenzel und reichte ihm einen Zettel. „Ich soll Ihnen ausrichten, dass der Anruf von einem Anschluss im Grasigen Rain kam. Das gehört bereits zu Fellbach. Bofinger, Rosemarie.“
„Danke.“ Frenzel steckte den Zettel ein. Emmerich schlug die Mappe auf, nahm ein einzelnes Blatt heraus und überflog den Inhalt.
„Da haben wir den Salat“, sagte er nachdrücklich. „Auf der Schachtel mit den Tabletten ist kein einziger Fingerabdruck. Und Handschuhe hat der Tote nicht getragen, es wurden auch keine bei ihm oder in der Umgebung gefunden.“
***
Für Elke Bofinger war es kein guter Tag. Das Bild aus der Zeitung spukte noch in ihrem Kopf herum, als sie an ihrem Arbeitsplatz anlangte und spürte, dass auch hier etwas merkwürdig war. Die Stimmung in der Bank hatte sich auf schwer zu beschreibende Weise verändert, anstatt der üblichen „Guten Morgen“- und „Mahlzeit“-Grüße wurde auf den Gängen und in den Aufzügen getuschelt, die Angestellten wirkten bedrückt. Auf dem Weg ins Büro schnappte Elke vereinzelte Wortfetzen auf. „Internationale Finanzkrise“ hieß das häufigste Schlagwort, dazwischen war von möglichen Entlassungen die Rede. Um mehr zu erfahren, verbrachte sie ihre Mittagspause ausnahmsweise in der Kantine, die zwar „Betriebsrestaurant“ genannt wurde, von dem, was Elke unter einem Restaurant verstand, aber etwa so weit entfernt war wie der Stuttgarter Fernsehturm vom Mount Everest, weshalb sie die alte Benennung bevorzugte. Natürlich hatte auch sie bereits von der sich weltweit anbahnenden Finanzkrise gehört, das Ganze jedoch bislang für ein vorwiegend amerikanisches Problem gehalten. Elkes Arbeitsplatz lag nicht in der internationalen Welt der Hochfinanz, sondern in den Niederungen des Privatkundengeschäfts, wo sie ihre Zeit mit verlorenen Scheckkarten, falsch verbuchten Lastschriften und der Beratung schusseliger Senioren verbrachte. Der Informationsgehalt der Kantinengespräche erwies sich als wenig ergiebig. Womöglich hatte auch ihr Arbeitgeber sich beim großen Spiel mit den amerikanischen Hypotheken verkalkuliert, doch über die unmittelbaren Auswirkungen schien niemand Bescheid zu wissen. Verdrossen schob Elke den letzten Löffel eines garantiert kalorienarmen, dafür aber absolut geschmacksneutralen Fruchtpuddings in den Mund und wandte sich wieder ihrem eigentlichen Problem zu. Kais Vater war aus der Nicht-Existenz wieder aufgetaucht, nur um sich gleich darauf abermals, und diesmal endgültig, zu verabschieden. Elke hatte keine Vorstellung davon, wo Peter sich in den zurückliegenden Jahren herumgetrieben haben mochte, es interessierte sie auch nicht besonders. Was sie jedoch wusste, war, dass er vor seinem Verschwinden der Sohn recht vermögender Eltern gewesen war. Diese Eltern hatten sich hartnäckig geweigert, Kai als ihren Enkel anzuerkennen, doch das waren andere Zeiten gewesen. Heute gab es eindeutige Möglichkeiten, eine Vaterschaft festzustellen. Elke erinnerte sich an den Fall eines Tennisspielers, der in diesem Zusammenhang zu zweifelhaftem Ruhm, weit über seine sportlichen Erfolge hinaus, gekommen war. Es lag ihr wenig daran, die Vergangenheit aufzuwühlen und noch weniger wollte sie Kai mit Dingen belasten, die keine Aussicht auf Erfolg versprachen, doch das Bild in der Zeitung beinhaltete eine Chance. Sie musste nur noch einen Weg finden, der diese Chance für sie greifbar machen würde. Wenn sie es richtig anfing, bestand immerhin die Möglichkeit, dass die Auswirkungen der internationalen Finanzkrise sowohl ihr als auch Kai letztendlich egal sein konnten. Lieber Gott, hilf mir, das Richtige zu tun, schickte Elke, die im Allgemeinen wenig religiös war, ein Stoßgebet zur hell verschalten Kantinendecke hinauf und brachte ihr Tablett zum Fließband.