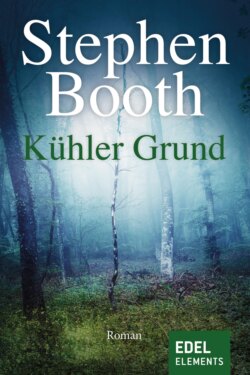Читать книгу Kühler Grund - Stephen Booth - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление6
Die Kriminalbeamten waren kaum gegangen, als sich das kleine Cottage erneut mit Menschen füllte. Helen, die in der Tür zur Küche stand, sah zu, wie ihre Mutter und ihr Vater ins Esszimmer liefen und sich aufgeregt um ihre Großeltern scharten. Sie sprachen mit ihnen wie mit ungezogenen Kindern, die eine Strafpredigt und Trost zugleich verdient hatten.
»Du lieber Himmel, ihr zwei. Was ist denn passiert? Das ganze Haus voller Polizei. Was hast du bloß angestellt, Harry?«
Zu einem kurzärmeligen Baumwollhemd mit einem etwas gewagten blaugrünen Muster trug Andrew Wilner noch die dunkelgraue Hose des Anzugs, den er immer ins Büro anzog. Er roch schwach nach Seife und Whisky. Helen wusste, dass ihr Vater bereits geduscht hatte, als er von der Arbeit nach Hause gekommen war, und sich das erste Glas Glenmorangie gegönnt hatte, als ihn ihr Anruf erreichte. Den Sonnenschutz an seiner Brille hatte er nach oben geklappt, als er ins Haus getreten war. Jetzt standen die dunklen Gläser waagerecht von seiner Stirn ab wie übertriebene Augenbrauen.
Harry blickte ohne ein Lächeln der Begrüßung aus dem Sessel zu Andrew hoch.
»Helen hat euch bestimmt schon alles gesagt, was es zu sagen gibt.«
Margaret Milner fächelte sich mit einem Strohhut Luft zu. Sie war eine korpulente Frau, die stark unter der Hitze litt. Ihr bunt geblümtes Kleid schwang um ihre Knie, und wenn sie sich bewegte, verbreitete sich im Zimmer der penetrante Geruch von Deospray.
»Eine Leiche. Wie schrecklich. Ihr Ärmsten.«
»Was dein Dad gefunden hat, war ein Schuh«, sagte Gwen aufgeregt. »So einen Turnschuh. Sie haben gesagt, dass da auch ein totes Mädchen lag, aber dein Dad hat sie nicht gesehen. Du hast sie doch nicht gesehen, oder, Harry?«
»Es war Jess«, sagte Harry. »Jess hat den Schuh gefunden, nicht ich.«
»Und da war … War da wirklich Blut dran?«
»Scheint so.«
»Der junge Polizist hat ihn mitgenommen«, sagte Gwen.«
»Der junge Cooper.«
»Wer?«
»Der Sohn von Sergeant Cooper. Der Polizist. Du erinnerst dich doch sicher noch an die Geschichte?«
»Ach, jetzt weiß ich wieder.« Margaret wandte sich ihrer Tochter zu. »Warst du nicht in der Schule mit ihm befreundet, Helen? Jetzt erinnere ich mich. Du mochtest ihn, nicht wahr?«
Helen war verlegen. Am liebsten wäre sie in die Küche geflüchtet, um schnell noch eine Kanne Tee zu kochen. Sie liebte ihre Eltern und ihre Großeltern, aber mit allen vieren in einem Raum fühlte sie sich immer unbehaglich. Sie kam gut mit jedem einzelnen zurecht, aber wenn sie als Familie zusammen waren, schien kein Gespräch mehr möglich.
»Ja, Mum. Ben Cooper.«
»Ihr habt euch gut verstanden. Aber es ist nie etwas aus euch geworden. Ich fand das immer sehr schade.«
»Mum …«
»Ich weiß, ich weiß. Es geht mich nichts an.«
»Lass es gut sein, Mum. Ein andermal.«
»Man hat eine Leiche gefunden«, sagte Gwen klagend, fast flehend, als ob sie hoffte, jemand würde sie trösten oder ihr sagen, dass überhaupt nichts geschehen war.
»Und es ist wirklich die kleine Vernon?«, fragte Andrew ungeduldig. Helen hörte den leichten schottischen Akzent ihres Vaters heraus, das gerollte R, das immer durchklang, wenn er unter Stress stand. »Steht schon fest, dass es Laura Vernon ist?«
»Sie muss erst noch identifiziert werden, haben die zwei Beamte gesagt.« Gwen sah Harry herausfordernd an. Er sollte ruhig wissen, dass sie an der Tür gelauscht hatte, als er von der Polizei befragt worden war. Harry nahm keine Notiz davon. Er betastete seine Jackentasche, als ob er sich nichts sehnlicher wünschte, als sich mit seiner Pfeife in das Wohnzimmer zurückzuziehen, in seinen sicheren Hafen.
»Sie glauben schon, dass sie es ist«, sagte Harry.
»Das arme Ding«, sagte Margaret. »Sie war doch noch ein Kind. Wer würde so etwas tun, Helen?«
»Sie war fünfzehn. Möchtet ihr Tee?«
»Fünfzehn, eben. Noch ein Kind. Sie haben ihr alles gegeben, ihr Vater und ihre Mutter. Privatschule, eigenes Pferd. Was das gekostet haben muss, überleg doch mal. Und nun so etwas.«
»Ich frage mich, wie Graham Vernon es aufnehmen wird«, sagte Andrew.
»Wie meinst du das, Dad?«
»Es ist so schrecklich. Stell dir doch mal vor, in was für einer Verfassung er jetzt ist. Und dann muss es ausgerechnet mein eigener Schwiegervater sein, der sie findet.«
»Ich bitte dich, was spielt das denn für eine Rolle? Seine Tochter ist tot, da ist es doch vollkommen egal, wer sie gefunden hat.«
»Aber unangenehm ist es trotzdem.«
»Andrew gefällt sich in der Rolle von Graham Vernons treuem Lakaien«, sagte Margaret. »In den Mord an seiner Tochter verwickelt zu sein, passt nicht besonders gut ins Bild.«
»Verwickelt? Also wirklich nicht«, protestierte Andrew.
»Wenn auch nur am Rande, natürlich«, sagte Margaret mit einem zufriedenen Lächeln. »Aber das reicht wahrscheinlich, um dir Angst zu machen, es würde etwas an dir hängen bleiben.«
»Hör auf, Margaret.«
»Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn Dad einfach weitergegangen wäre und niemandem etwas gesagt hätte. Für dich wäre es auf jeden Fall besser gewesen. Ich bin überrascht, dass er in dem Moment überhaupt nicht an deinen guten Ruf gedacht hat. Wie konntest du nur, Dad?«
Harry holte seine leere Pfeife heraus, kaute auf dem Stiel herum und sah von einem zum anderen. Helen hatte den Eindruck, dass er der Einzige im Zimmer war, der an dem Gespräch seine Freude hatte.
»Andererseits ist es um den Ruf der Vernons natürlich auch nicht besonders gut bestellt«, sagte Margaret.
»Das ist nicht fair. Sie sind angesehene Leute.«
Margaret schnaubte verächtlich. »Angesehen? Aber nicht in diesem Haus. Was sagst du dazu, Dad?«
»Verdammte Geldsäcke. Ungehobeltes Gesindel.«
Helen lächelte. »Das musste auch mal gesagt werden. Sie haben unserer Familie genug angetan. Wieso sollten wir unsere Meinung wegen dieser Sache ändern? Es tut mir Leid für sie, aber es ist ihre Angelegenheit, nicht unsere. Und mit Großvater hat es gleich gar nichts zu tun. Zum Teufel mit den Vernons. Wir müssen uns um Grandma und Granddad kümmern.«
»Aber natürlich. Andrew?«
»Schon gut, schon gut.«
»Wie gut, dass wir eine richtige Familie sind, die zusammenhält«, sagte Margaret. »Nicht wie die Vernons. Das ist nämlich genau das Problem bei denen. Das war auch der Grund für alles, was vorgefallen ist. Sie wissen nicht, was eine Familie ist. Und ihr werdet sehen, das ist auch diesmal wieder der Grund.«
»Wir müssen darüber reden«, sagte Helen. »Wir hätten schon längst darüber reden sollen.«
»Er will nicht«, sagte Gwen. »Er will mit keinem darüber sprechen.«
»Dafür gibt’s keinen Grund«, sagte Harry. »Lasst es gut sein.«
Helen ging zu seinem Sessel und legte ihm die Hand auf den Arm. »Granddad?«
Er tätschelte ihre Hand und lächelte ihr zu. »Glaub mir, Kind, es gibt keinen Grund.«
Sie seufzte. »Nein, wir haben noch nie über irgendetwas Wichtiges gesprochen. Noch nie, die ganze Familie nicht. Außer wenn wir wütend oder aufgeregt sind. Und in so einem Augenblick kann man nichts besprechen. In so einem Augenblick kann man gar nichts tun.«
»Also, ich weiß wirklich nicht, was du meinst«, sagte Margaret. »Ich bin durchaus in der Lage, über alles zu reden, ohne mich aufzuregen.«
Ihre Stimme klang schrill. Sie warf den Kopf nach hinten, nestelte an ihrem Ohrring und funkelte ihren Mann an, als ob sie seinen Widerspruch herausfordern wollte. Aber Andrew wandte sich mit hängenden Schultern ab. Sein Blick fiel auf Jess, die sich ins Zimmer geschlichen hatte und ihn mit traurigen Augen ansah. Ihre Ohren zuckten, während sie versuchte, den Klang der Stimmen einzuordnen und die Stimmung zu deuten. Was sie hörte, schien ihr nicht zu gefallen.
»Es war wirklich nicht nötig, dass ihr hergekommen seid«, sagte Harry. »Überhaupt nicht nötig. Wir sind wunderbar allein zurechtgekommen, wir und Helen.«
»Wir konnten euch doch nach einem solchen Schreck nicht einfach allein lassen«, sagte Margaret. »Wir sind schließlich eure Familie.«
Harry stand auf und ging langsam auf die Treppe zu. »Ich gehe mir ein bisschen die Beine vertreten«, sagte er.
Bevor ihn jemand fragen konnte, was er vorhatte, war er verschwunden. Das Rauschen von Wasser und das Knarren einer Schranktür drangen durch die alten Dielenbretter zu ihnen herunter.
»Wo will er denn hin?«, fragte Andrew.
»Doch nicht ins Pub?«, sagte Margaret. »Doch nicht an einem solchen Tag?«
»Und ob«, sagte Gwen. »Er ist mit denen verabredet.«
Eine halbe Stunde später war Harry aus dem Cottage geflohen. In der vertrauten Atmosphäre seiner Stammkneipe ließ er sich nicht lange bitten, seine Geschichte zu erzählen. Als er fertig war, würdigten nachdenkliche Ruhe, ein paar Schluck Bier und kameradschaftliches Schweigen den Ernst der Lage.
»Mann, Harry. Die Polizei im Haus.«
»Aye, die Polizei, Sam. Ein ganzer Haufen Polizisten.«
»Die können einem sicher ganz schön auf die Nerven gehen.«
»Versuchen tun sie es. Aber mich stören sie nicht.«
Die Ecke im Drover zwischen Kamin und Fenster roch nach alten Männern und nassen Hunden. Die Sitze der hölzernen Wandbänke waren von den Männern über die Jahre blank poliert und abgewetzt worden, und ihre Stiefel fanden wie von selbst die vertrauten Dellen in dem dunklen Teppich.
Sam Beeley hatte seinen Spazierstock an den Tisch gelehnt. Der Schäferhundkopf aus Elfenbein, der den Griff bildete, starrte verächtlich auf die Tischplatte aus gehämmertem Messing. Hin und wieder strich Sam mit der knochigen Hand über das Elfenbein, kraulte dem Schäferhund mit gelben Fingern die abgestoßenen Ohren oder klopfte mit seinem verwachsenen Daumennagel auf die Ecke der Messingplatte. Seine Knie knackten, wenn er sich bewegte, und obwohl seine Füße in weichen Wildlederschuhen steckten, schien er keine Stellung zu finden, die ihm keine Schmerzen bereitete. Er war der hagerste der drei Männer, doch das sah man kaum, da er trotz des warmen Abends mehrere Schichten Kleidung übereinander trug. Seine Hagerkeit zeigte sich am deutlichsten an den Händen und im Gesicht. Die Wangen waren eingesunken, und die trüben, blauen Augen lagen tief in den dunklen Höhlen.
»Verdammte Bullen«, sagte er, die Stimme rau vom Zigarettenrauch. »Was meinst du, Wilford?«
»Auf die können wir verzichten, Sam.«
»Recht hast du.«
»Aye.«
Wilford Cutts hatte seine Mütze abgenommen. Die helle Kopfhaut mit dem weißen Haarkranz hob sich scharf von seiner gesunden Gesichtsfarbe ab. Er hatte einen struppigen weißen Schnurrbart und spärliche Koteletten, die früher einmal buschiger gewesen waren. Sein breiter, sehniger Hals ging in schwere Schultern über, die sich weich und kraftlos unter seinem Pullover abzeichneten. Seine Handflächen starrten vor Dreck, und die Finger, mit denen er das Bierglas umschloss, hatten schwarze Nägel. An seiner Cordhose mit den abgewetzten Knien, die er sich stramm in die Socken gestopft hatte, hingen dunkle Fasern. Die Füße hatte er unter die Bank geschoben, damit der Wirt die festgeklebte Erde an den Sohlen seiner Schnürstiefel nicht sehen konnte.
»Dann ist es also ein Mordfall, Harry? Wissen sie schon, was mit dem Mädchen passiert ist?«
»Haben sie nicht gesagt, Wilford.«
»Nein?«
»Nein.«
»Verdammte Bullen.«
Harry behielt seine Mütze auf. Natürlich war er der Held des Tages und stand im Mittelpunkt des Interesses, aber das war noch lange kein Grund, aus dem Häuschen zu geraten. Er hatte für den Besuch im Pub ein frisches Hemd angezogen und sich einen Schlips mit einem dezenten Paisley-Muster umgebunden. Die Füße hielt er weit von sich in den Raum gestreckt, sodass sich das Licht der Wandlampen in den gewienerten Kappen seiner Stiefel spiegelte.
Ab und zu grüßte ein anderer Gast herüber, was Harry mit einem Kopfnicken zur Kenntnis nahm, nicht unhöflich, aber reserviert. Finster musterte er eine laut lachende Gruppe Jugendlicher, die er nicht kannte. Sie standen am anderen Ende des Pubs und versuchten einander an Lautstärke zu übertreffen, und ab und zu grölten sie ein Lied.
Nach einer stillschweigenden Übereinkunft saß Sam dem Kamin am nächsten, obwohl es Sommer war und kein Feuer brannte. Wilford hatte den entferntesten Platz, mit dem Rücken zur Tür, im Schatten der Nische verborgen. Auf dem Tisch standen zwei große Gläser Marston’s Bitter und ein kleines Glas Stout, daneben ein Haufen zerschrammter Dominosteine, die genauso dalagen, wie sie aus der Schachtel gefallen waren. Zusammen mit dem Bier hatte auch eine Tüte Bacon-Chips den Weg zum Tisch gefunden. Wilford steckte sie ein.
»Und wie kommt die Familie damit klar?«, fragte Sam. »Wahrscheinlich ein ziemlicher Schock für die Frauen, was?«
Harry zuckte die Achseln. »Mein Herr Schwiegersohn ist das größte Waschweib von allen«, sagte er. »Er ist fix und fertig. Hat Angst um seine kostbare Stelle bei Vernon.«
»Der würde nie im Leben dichthalten. Tut mir Leid, wenn ich das sagen muss, Harry. Aber wenn der Knabe Dreck am Stecken hätte und unter Verdacht stünde, würde er garantiert singen wie ’ne Kreissäge.«
Harry schmunzelte leise. Genau wie Sam hatte er den Slangausdruck am Abend vorher im Fernsehen gehört, in einer Krimiserie, die in der Londoner Drogenszene spielte und wo die Polizisten schlimmere Verbrechervisagen hatten als die Verbrecher.
»Und? Hat er?«, fragte Wilford plötzlich.
»Hat wer was?«
»Hat Andrew Milner Dreck am Stecken?«
»Dass ich nicht lache«, antwortete Harry. »Unsere Margaret kennt ihn in- und auswendig, bis zum kleinsten Loch in der Socke. Der arme Trottel könnte nicht mal einen Pickel am Popo geheim halten.«
»Aber die Polizei ist sowieso unfähig«, sagte Sam. »Sie wissen nie, mit wem sie reden müssen oder welche Fragen sie stellen sollen. Wenn die hier bei uns was aufklären wollen, muss ihnen schon Kommissar Zufall helfen.«
Wilford lachte. »Nicht wie im Fernsehen, Sam.«
»Im Fernsehen kriegen sie den Täter immer. Ist doch auch klar. Es sind bloß Geschichten. Deshalb werden sie ja im Fernsehen gezeigt.«
»Dabei werden sie gar nicht geschnappt«, sagte Sam. »Jedenfalls nicht im richtigen Leben. Die eine Hälfte wird nie erwischt. Und die paar, die doch gefasst werden, lässt der Richter wieder laufen. Sie kriegen Bewährung oder … Wie heißt das noch?«
»Sozialdienst«, sagte Harry langsam, als ob er das Wort noch nie laut ausgesprochen hätte, sondern es nur vom Hörensagen oder aus den Gerichtsreportagen des Buxton Advertiser kannte.
Sam verzog den Mund. »Aye. Sozialdienst. Und so was nennt sich Strafe? Die Halunken zu ehrlicher Arbeit zu zwingen? Da kann man sie genauso gut gleich freisprechen. Es stimmt schon, heutzutage kommt man mit allem ungeschoren davon. Sogar mit Mord.«
»Aber die Leute, die vor dem Fernseher sitzen, wissen das nicht«, sagte Wilford. »Die meisten haben nicht die leiseste Ahnung. Sie denken, was sie in der Flimmerkiste sehen, ist das wahre Leben. Vor allem die Kinder. Und natürlich die Frauen. Die kennen den Unterschied nicht. Sie denken, wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, kommt der gute alte Inspector Morse aus dem Fernsehen, setzt sich mit seinem Bleistift und einem Stück Papier in eine Kneipe, tüftelt gemütlich aus, wer der Täter ist, und schon sitzt der Mörder hinter Gittern.«
»Hinter Gittern, genau. Lebenslänglich.«
Sie versanken wieder in Schweigen, starrten auf die Biergläser und versuchten sich vorzustellen, wie es wohl sein mochte, den Rest seines Lebens im Gefängnis zu verbringen. Eine lebenslange Freiheitsstrafe konnte zehn, zwanzig oder sogar dreißig Jahre bedeuten – für einen Mann, der die siebzig oder achtzig überschritten hatte, lief es auf das Gleiche hinaus. Er würde nie wieder herauskommen.
»Nie mehr an die frische Luft zu kommen, das muss schrecklich sein«, sagte Sam.
Die beiden anderen nickten und drehten automatisch den Kopf zum Fenster, wo trotz der Dämmerung die Umrisse der Witches zu erkennen waren, die sich schwarz und zerklüftet vom südlichen Himmel abhoben. Ein unbehagliches Gefühl machte sich am Tisch bemerkbar. Sam fröstelte und packte unwillkürlich seinen Stock fester, als ginge von dem glatten Elfenbein etwas Beruhigendes aus. Wilford kratzte sich nervös am Kopf und griff nach seinem Glas. Selbst Harry wirkte plötzlich verschlossener und eine Spur vorsichtiger.
»Nein. Das wäre nicht zum Aushalten«, sagte er. »Ums Verrecken nicht.«
Die drei alten Männer sahen sich von der Seite an, sie verstanden sich auch ohne Worte. Eine bedächtige Handbewegung oder eine bestimmte Neigung des Kopfes genügte. So hatten sie sich schon während ihres Arbeitslebens miteinander verständigt, abgeschnitten vom Rest der Welt, abgesondert in einer Umgebung, in der das Sprechen überflüssig und manchmal sogar unmöglich gewesen war. Noch immer konnten sie die Welt einfach ausblenden, so taub und blind für das lärmende Treiben im Wirtshaus, als wären sie wieder in einem dunklen Stollen, anderthalb Kilometer unter der Erde.
Sam kramte eine Schachtel Embassy und Streichhölzer heraus und zündete sich eine Zigarette an. Der Rauch, der reglos in der Luft stand und sein Gesicht verschleierte, ließ ihn blinzeln. Wilford fuhr sich mit den schmutzigen Fingern durch das Haar, wobei für einen Augenblick eine unnatürlich weiße, kahle Stelle zum Vorschein kam, an der sich die Kopfhaut, dünn wie Papier, über dem Knochen spannte. Harry nestelte an seiner kalten Pfeife und schob mit dem Stiel ein paar verdeckt auf dem Tisch liegende Dominosteine auseinander. Er starrte sie gebannt an, als ob er durch die gemusterten Rückseiten die Zahlen erkennen könnte.
»Aber es gibt sicher auch welche, denen würde ihre Tat schwer auf dem Gewissen liegen«, sagte Wilford. »Und das soll schlimmer sein als jede Strafe.«
»So was kann einen um den Verstand bringen«, pflichtete Sam ihm bei.
»Als wäre man in seiner eigenen Hölle, so stelle ich mir das vor. Das wäre wirklich eine Strafe, die sich gewaschen hat.«
»Auf jeden Fall schlimmer als Sozialdienst.«
»Schlimmer als das Gefängnis?«, fragte Harry.
Sie machten ein skeptisches Gesicht. Sie sahen es vor sich, enge, schmale Zellen und Gitter, zusammengepfercht mit Hunderten anderer Männer, eine Stunde Hofgang am Tag. Für immer von Licht und Luft abgeschnitten.
»Natürlich muss man erst mal ein Gewissen haben«, sagte Wilford.
»Und wer hat das heute schon«, stimmte Sam ihm zu.
Sie sahen Harry an und warteten auf seine Antwort. Doch der schien darüber nicht nachdenken zu wollen. Er stand mit steifen Gliedern auf, sammelte die Gläser ein und ging zur Theke. Ohne nach links oder rechts zu schauen, bahnte er sich den Weg durch die Jugendlichen, den Rücken durchgedrückt, wie ein Mann, der mit sich selbst genug zu schaffen hatte. Die anderen Gäste machten ihm automatisch Platz, und der Wirt schenkte ein, ohne dass Harry die Bestellung aussprechen musste.
Mit Jackett und Schlips wirkte Harry seltsam fehl am Platz zwischen den T-Shirts und Shorts der anderen Gäste, wie ein Bestattungsunternehmer, den es auf eine Hochzeitsfeier verschlagen hatte. Wenn er den Kopf drehte, schien der Schirm seiner Mütze die Kulisse aus Freizeithemden und sonnenverbrannten Gesichtern zu durchschneiden.
»Und der Kerl, der die Kleine umgebracht hat«, sagte Harry, als er an den Ecktisch zurückkam. »Meint ihr, der kommt auch ungeschoren davon?«
»Kommt darauf an«, antwortete Wilford. »Kommt darauf an, ob die Bullen Glück haben. Vielleicht hat einer was gesehen und beschließt, es ihnen zu erzählen. Oder ein Bobby stellt aus Versehen die richtige Frage. Anders kriegen sie ihn nicht.«
»Sie haben sicher einen Verdacht.«
»Ein Verdacht allein genügt nicht. Ohne Beweise können sie überhaupt nichts machen«, sagte Wilford zuversichtlich.
»Beweise. Aye, sie werden Beweise brauchen.«
»Die haben sie nötig. Bitter nötig.«
»Der junge Sherratt soll ausgebüchst sein«, sagte Sam.
»So ein Trottel.«
»Aber solange die Bullen nach ihm fahnden, haben sie wenigstens was zu tun. Er ist bestimmt der Hauptverdächtige.«
»Außer, sie wollen es einem aus der Familie anhängen«, sagte Wilford. »Da vermuten sie den Täter immer zuerst.«
»Aye«, sagte Sam. Plötzlich hellte sich seine Miene auf. »Oder sie verdächtigen ihren Freund.«
»Aber welchen?«, sagte Harry.
»Eben. Das ist genau die Frage, bei dem Früchtchen.«
»Und gerade mal fünfzehn Jahre alt«, sagte Sam.
Sie schüttelten ratlos den Kopf.
»Aber das ist das einzig Gute daran, nicht wahr, Harry?«
»Aye«, sagte Harry. »Das ist das Beste, dass bei den Nachforschungen alles Mögliche ans Licht kommen wird, auch über die Vernons. Dann weiß die Polizei endlich, mit was für einer feinen Familie sie es zu tun hat.«
»Und dann …«
»… dann sind sie vielleicht nicht mehr so versessen darauf, den Täter zu finden.«
»Vielleicht verleihen sie ihm sogar einen Orden«, sagte Harry.
Die Jugendlichen am anderen Ende des Raumes drehten sich erstaunt um und starrten herüber. Ausnahmsweise war das Gelächter der drei alten Männer noch lauter als ihr eigenes. Und noch unechter.
Helen stand mit ihrer Großmutter im Hauseingang des Cottage und sah zu, wie die Rücklichter des Renault hinter der Kurve bei der Kirche verschwanden. Es war ein klarer, warmer Abend, und die Sterne leuchteten am tiefblauen Himmel. Nur im Umkreis der Straßenlaternen hier und da schien es wirklich dunkel zu sein.
»Es war nett, Sergeant Coopers Sohn wieder zu sehen. Hat er sich nicht prächtig herausgemacht?«
»Ja, Grandma.«
»Ben heißt er, richtig?«
»Ja.«
»Er ist der, den du früher manchmal nach der Schule mit nach Hause gebracht hast, nicht wahr, Helen?«
»Nur ein-, zweimal, Grandma. Und das ist schon Jahre her.«
»Aber ich erinnere mich trotzdem noch daran. Ich weiß genau, wie du ihn angesehen hast. Und einmal hast du gesagt, du willst ihn heiraten, wenn du groß bist. Das weiß ich noch.«
»Alle kleinen Mädchen haben einen Schwarm. Jetzt haben wir überhaupt keinen Kontakt mehr. Ich hätte ihn fast nicht erkannt.«
»Mag schon sein. Aber er hat schöne Augen. Dunkelbraun.«
Sie gingen wieder ins Haus. Helen bemerkte, dass Gwen sich kaum überwinden konnte, in die Küche zu schauen, geschweige denn hineinzugehen, obwohl die Polizei den blutigen Turnschuh und die Seiten des Buxton Advertiser längst mitgenommen hatte.
»Jetzt sind sie sicher oben in der Villa«, sagte Helen. »Um diese Aufgabe sind sie nicht zu beneiden. Sie müssen Mr. und Mrs. Vernon sagen, was sie gefunden haben.«
Ihre Großmutter sah auf die Uhr, nestelte an ihrer Strickjacke, zog ein rosa Papiertaschentuch aus dem Ärmel und faltete es umständlich auseinander.
»Einer von ihnen muss die Leiche identifizieren. Ich nehme an, das wird er machen. Aber sie wird es hart treffen, Charlotte Vernon. Meinst du nicht auch, Grandma?«
Gwen schüttelte den Kopf, und Helen sah, dass sich in ihrem Augenwinkel eine kleine Träne gebildet hatte, die die trockene Haut ihrer Wange einen Augenblick lang hell aufschimmern ließ.
»Ich weiß ja, ich weiß«, sagte Gwen. »Eigentlich müssten sie mir Leid tun. Aber sie tun mir nicht Leid. Ich kann nichts dagegen machen, Helen.«
Helen setzte sich auf die Armlehne des Sessels, in dem ihre Großmutter saß, und legte ihr den Arm um die schmächtigen Schultern.
»Ist schon gut, Grandma. Das ist verständlich. Nimm es dir nicht so zu Herzen. Soll ich dir einen Kakao machen? Vielleicht finden wir etwas im Fernsehen, was du dir ansehen möchtest, bis Granddad nach Hause kommt.«
Gwen nickte und suchte schniefend nach einem frischen Taschentuch, um sich die Nase zu putzen. Helen tätschelte ihr die Schulter, stand auf, ging ein paar Schritte in Richtung Küche, bis die Stimme ihrer Großmutter sie stoppte. Sie klang schrill und ängstlich, der Verzweiflung nahe.
»Was wird nur mit Harry passieren?«, sagte sie. »Lieber Gott, was werden sie nur mit Harry machen?«