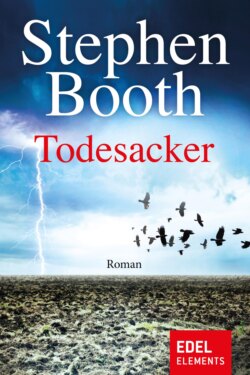Читать книгу Todesacker - Stephen Booth - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление6
Oh, I’m a man from a distant land,
A place where camels roam
It’s hot and flat, and dry as bone
And if they don’t like your face, they’ll cut off your hand
It’s the place that I call home!
Der Straßenhändler wandte sich der Tanzgruppe zu, die in das Lied einstimmte. Alle waren als chinesische Bauern verkleidet – mit farbenfrohen Tuniken und Kuli-Hüten. Binnen Minuten hatte sich das Geschehen auf die Straße vor dem Haus der Witwe Twankey verlagert, was bedeutete, dass bald der Herrscher Ping Pong mit seiner wunderschönen Tochter eintreffen würde.
Im Royal Theatre in Edendale war beim Highlight des Jahres, dem alljährlichen Märchenspiel an Weihnachten, jeder Platz besetzt. Ben Cooper saß einige Reihen von der Bühne entfernt, hinter Dutzenden aufgeregten Kindern, die darauf warteten, bei jeder Gelegenheit zu buhen, zu pfeifen und »Oh, nein, hast du nicht!« zu rufen.
Vom Textbuch zu Aladin gab es verschiedene Versionen, doch die Eden Valley Operatic Society schien sich für eine der politisch inkorrekteren Varianten entschieden zu haben. Nicht dass es in Aladin, wo Figuren wie Wishy Washy oder Inspector Chu von der chinesischen Polizei auftraten, überhaupt so etwas wie politische Korrektheit gegeben hätte. Besondere Bedenken hatte Cooper bei Abdulla O’Reilly, der im Programm als »irischer Schwachkopf« aufgeführt war, und bei Ugga-Wugga, dem Häuptling des Kannibalenstamms.
Cooper wand sich auf seinem Sitz. Es waren schon wegen weniger eklatanter Beispiele rassistischen Humors kriminalpolizeiliche Ermittlungen eingeleitet worden. Doch hier handelte es sich um ein Märchenspiel für Kinder, das eine lange Tradition hatte. Schließlich ging niemand ins Theater, ohne eine genaue Vorstellung davon zu haben, was ihn erwartete, oder? Billige Witze, komische Namen, ein heiteres Durcheinander ethnischer Klischees.
Liz, die neben ihm saß, stupste ihn an und flüsterte: »Ben, hast du dir schon überlegt, ob du am ersten Weihnachtsfeiertag mit zu meinen Eltern kommst?«
»Nein«, flüsterte Cooper zurück.
»Nein, du hast es dir noch nicht überlegt? Oder nein, du kommst nicht mit?«
»Lass uns das später besprechen.«
»Ja, gut. Aber du bist immer so beschäftigt.«
Ein Chor von Buhrufen kündigte den ersten Bühnenauftritt des bösen Zauberers Abanazar an. Binnen Sekunden war klar, dass er als arglistiger Araber dargestellt wurde, der sich in eine chinesische Stadt verirrt hatte. Das verlieh den Textzeilen der Eröffnungssongs natürlich eine besondere Schärfe: »And if they don’t like your face, they’ll cut off your hand«, »und wenn ihnen dein Gesicht nicht gefällt, schneiden sie dir die Hand ab.«
Cooper rutschte in seinem Sitz ein Stück tiefer und hoffte, nicht erkannt zu werden. Er war schon im Foyer von einem Dutzend Bekannten gegrüßt worden.
Liz stieß ihn abermals an. »Was ist denn los?«
»Nichts.«
»Du schaust so unzufrieden aus.«
»Danke.«
»Gefällt dir das Stück nicht?«
»Doch, es ist toll.«
»Wir können aber noch nicht gehen. Nicht bevor meine Freunde ihren Auftritt hatten. Sie spielen chinesische Polizisten und treten erst in der zweiten Hälfte von Akt zwei auf.«
Oh, Gott. Die chinesischen Polizisten. Ganz bestimmt würden ein paar Polizistenwitze gemacht werden, und die Leute würden ihn ansehen, wenn sie lachten.
»Nein, alles in Ordnung, ich möchte nicht gehen. Hör auf zu reden, sonst werden die Leute noch sauer.«
Jedes traditionelle Märchenspiel für Kinder hatte seine Standardfiguren. Es gab immer einen sehr offensichtlichen Bösewicht – in diesem Fall Abanazar, der eine große und anspruchsvolle Rolle innehatte, vor allem dann, wenn er seinen Turban und seinen Krummsäbel überzeugend tragen wollte. Und dann gab es natürlich noch die groteske alte Dame. In dieser Inszenierung führte die Witwe Twankey auf althergebrachte Weise eine chinesische Wäscherei, was die Voraussetzung dafür schuf, dass die üblichen uralten Witze gemacht werden konnten.
Cooper warf einen Blick in sein Programm und kniff die Augen zusammen, um die Druckschrift im gedämpften Licht des Theaters lesen zu können. Viele der Namen auf der Besetzungsliste waren ihm vertraut. Auch wenn er nicht alle Darsteller persönlich kannte, waren ihm zumindest ihre Eltern mehrfach begegnet. Oder, im Fall der Kinder, ihre Großeltern. Doch bei den meisten handelte es sich um Menschen, mit denen er in einem positiven Zusammenhang in Kontakt gekommen war. Märchenspiele schienen ehrbare Bürger anzusprechen.
»Worüber denkst du nach, Ben?«
»Über nichts«, flüsterte er. »Ich sehe mir nur das Programm an.«
»Denkst du etwa an die Arbeit?«
»Nein, natürlich nicht.«
»Daran ist gar nichts ›natürlich‹. Ich kenne dich doch.«
Cooper überflog die Liste und sah die Namen der chinesischen Polizisten. Bis auf Inspector Chu waren alle Darsteller Frauen. Und ihre Namen stammten alle aus der Gegend: Beeley, Holmes, Wragg, Marsden, Brindley. Letztere war vermutlich mit dem Schauspieler verwandt, der Abanazar spielte, da beide denselben Nachnamen hatten. Er war sich nicht sicher, nach wem von ihnen er Ausschau halten sollte.
»Liz, wie heißen deine Freundinnen gleich wieder?«
»Cheryl Hague und Harriet Marsden.«
»Hague? Kenne ich die?«
»Wahrscheinlich.«
»Ist das die attraktive Blondine, die wir letzte Woche im Pub getroffen haben?«
»Hey, hattest du nicht gesagt, wir sollen uns nicht unterhalten?«
Abanazar wurde von einem Sturm von Buhrufen und Gejohle begrüßt, als er, die Zauberlampe triumphierend hochhaltend, eine Felsbrockenattrappe vor den Höhleneingang rollte, um Aladin einzukerkern. Das bedeutete, dass bald ein Dschinn erscheinen würde.
Cooper schielte zu Liz hinüber, doch sie war völlig in die Vorstellung vertieft. Und sie hatte recht – allmählich kannte sie ihn tatsächlich. Sie waren jetzt seit ein paar Monaten ein Paar, wesentlich länger, als alle seine früheren Beziehungen gehalten hatten. Was ihm daran gefiel, war unter anderem die Tatsache, dass er ständig neue Seiten ihres Charakters entdeckte und einen Einblick in unvermutete Bereiche ihres Lebens gewann. Sie überraschte ihn stets aufs Neue. Da Weihnachten vor der Tür stand, hatte sie sogar seiner Katze ein Geschenk gekauft.
Bis vor ein paar Tagen war ihm nicht bewusst gewesen, dass Liz sich für Märchenspiele interessierte. Vermutlich konnte er von Glück reden, dass sie nicht selbst in einem Kostüm dort oben auf der Bühne stand. Gott behüte, sie könnte womöglich sogar versuchen, ihn zu überreden, dem Ensemble beizutreten.
Cooper schauderte und zog sein Jackett enger zusammen, um den Eindruck zu vermitteln, als zitterte er nicht vor Abscheu, sondern vor Kälte.
»Bist du sicher, dass mit dir alles in Ordnung ist, Ben?«
»Alles bestens. Ich genieße jeden Augenblick.«
Und dann kamen sie endlich, die komischen Polizisten. Eine kleine Truppe von ihnen, sechs oder sieben Frauen unterschiedlicher Größe, die mit Uniformröcken und Strumpfhosen bekleidet waren und kleine ulkige Knüppel trugen. Ihre nach unten gekrümmten Fu-Manchu-Schnurrbärte machten sie unkenntlich, doch Liz schien zufrieden damit zu sein, ihnen willkürlich zuzujubeln.
Tja, vielleicht würden sie den Bösewicht tatsächlich verhaften, dann konnte Cooper ihnen auch zujubeln. Doch bis dahin mussten sie sich noch etliche fürchterliche Witze anhören.
Als Aladin vorbei war, strömten sie mit der Menge aus dem Theater nach draußen und hofften, irgendwo etwas essen zu können, bevor alle Restaurants voll waren. Es war nicht die erste Aladin-Vorstellung gewesen, die Cooper besucht hatte. Er erinnerte sich, als Teenager dasselbe Stück im selben Theater gesehen zu haben. Vermutlich hatte er insgesamt sogar drei oder vier leicht unterschiedliche Inszenierungen davon gesehen.
Es gab nur eine Handvoll traditioneller Märchenspiele, und die schienen regelmäßig neu aufgeführt zu werden, als gäbe es einen strengen Turnus. In einem Jahr Aschenputtel, im nächsten Mutter Gans. Allerdings hatte er gehört, dass manchmal auch andere Geschichten verwendet wurden. Peter Pan, Sindbad, der Seefahrer, Robinson Crusoe. Robinson Crusoe? Eine Geschichte mit nur zwei Figuren? Vielleicht sollte er irgendwann einmal ein wenig abenteuerlustig sein und sich auf die Suche nach einer Vorstellung machen, damit er sah, wie die Handlung hingebogen wurde, um eine groteske alte Dame auf eine verlassene Insel zu verfrachten.
Der Jahrmarkt im Victoria Park mit seinen Fahrgeschäften war in vollem Gang. Ein Riesenrad ließ grüne Lichter über den Park kreisen, während es sich drehte, und ein Karussell sorgte dafür, dass die Gesichter der Menge pinkfarben leuchteten. An die Besucher wurden kostenlos Plätzchen und Glühwein verteilt.
Die Vorweihnachtszeit war mit Abstand die geschäftigste Jahreszeit im gesellschaftlichen Kalender von Edendale. Gegen Ende der Woche war eine Kneipentour der E-Division geplant. Eine weitere alljährliche Tradition. In diesem Jahr hatten sich die Organisatoren ein Motto ausgedacht: Saisonbier, das sie in der ganzen Stadt aufzustöbern gedachten. Es waren jede Menge Sorten zu haben. Die Brauereien brachten jedes Jahr Biere mit Namen wie Rocking Rudolph, Hark oder Black Christmas auf den Markt.
Doch Cooper würde keine Gelegenheit bekommen, sie zu probieren. Er würde seine Kollegen diese Woche nicht auf der Kneipentour begleiten, wie er es in den vorangegangenen Jahren getan hatte. Seine Prioritäten hatten sich in den letzten zwölf Monaten geändert, denn er war im Gegensatz zu früher kein Single mehr.
»Tja, wenn du mich an Weihnachten schon nicht begleitest, dann denk bitte wenigstens an die Taufe am Sonntag, ja?«, sagte Liz.
»Ich freue mich schon darauf. Ja, ehrlich.«
Liz’ beste Freundin hatte vor zwei Jahren einen Fitnesstrainer geheiratet, und am Sonntag sollte das erste Baby der beiden in Edendale getauft werden. Er sagte immer »erstes Baby«, da er die Freundin kennengelernt hatte und sich sicher war, dass sie noch einen ganzen Haufen Kinder bekommen wollte.
»Sie findet in der Kirche statt, also werden sich alle fein anziehen, Ben.«
»Ja?«
»Du hast doch einen Anzug mit Krawatte, oder?«
»Oh, äh … selbstverständlich.«
Cooper dachte an seinen Bruder, der sich vor kurzem zum ersten Mal in diesem Jahr in einen Anzug gezwängt hatte. Nachdem Matt inzwischen zu alt war, um am Young Farmers’ Christmas Ball teilzunehmen, war das Krippenspiel vor den Weihnachtsferien an Josies Grundschule sein einziges gesellschaftliches Ereignis gewesen. Im Gegensatz zu dem Märchenspiel war bei dieser Inszenierung jedoch die herkömmliche Handlung abgeändert worden. Es hatte keine Auftritte von Maria und Joseph gegeben. Nicht einmal das Christuskind war zu sehen gewesen. Stattdessen war die Geschichte von der Geburt Christi aus der Perspektive des Inhabers des Gasthauses in Bethlehem und seiner Familie erzählt worden, um die Bedeutung für deren Leben zu erforschen, nachdem sie mit dem plötzlichen Zustrom von Hirten und Weisen zurechtkommen mussten. Bestimmt konnten sich viele Gastwirte im Peak District in die schwierige Situation hineinversetzen, Touristen und Einheimische unter einen Hut zu bekommen.
Auf Matt hatte die Inszenierung allerdings keinen großen Eindruck gemacht. Mit zunehmendem Alter wurde er immer mehr zum eingefleischten Traditionalisten. Neue Ideen beunruhigten ihn.
In dieser Woche würde Ben noch mit dem Männerchor der Polizei in der Methodistenkirche singen, ein Konzert für ältere Bürger, gefolgt von einer Party für Kinder. Die Senioren waren verrückt danach, vor allem zur Weihnachtszeit. Außerdem war es gute Öffentlichkeitsarbeit.
Cooper erinnerte sich, als er Diane Fry nach ihrer Versetzung von der West-Midlands-Polizei nach Derbyshire kennengelernt hatte. Damals hatte sie für alles nur Spott übrig gehabt und war so gereizt gewesen, dass er es sich bald zur Angewohnheit gemacht hatte, ihre Bemerkungen völlig zu ignorieren. Als er ihr erzählt hatte, dass er im Chor sang, war sie erwartungsgemäß höhnisch gewesen. »Singst du Sopran?«, hatte sie gefragt. »Nein, Tenor.« Die Spitze war ihm erst viel später aufgefallen.
Nun ja, mittlerweile war Fry etwas umgänglicher geworden. Auf jeden Fall. Cooper runzelte leicht die Stirn. Es bestand natürlich auch die Möglichkeit, dass er einfach nur sehr gut darin geworden war, alles an sich abprallen zu lassen.
Als er den Schalthebel losließ, griff Liz nach seiner Hand und hielt sie einen Augenblick lang zärtlich fest.
»Danke, dass du mit mir zu dem Märchenspiel gegangen bist, Ben.«
Cooper empfand an diesem Abend ein Gefühl der Zufriedenheit, als er aus der Stadt hinaus nach Bakewell fuhr, um Liz nach Hause zu bringen. Unter ihnen markierte ein Lichtermeer die ausufernden Umrisse von Edendale, doch der größte Teil des Peak District lag in der Dunkelheit. Nach allem, was in seinem Leben geschehen war, schienen sich die Dinge endlich zum Guten zu wenden. Er hatte jemanden gefunden, der ihm etwas bedeutete. Und allem voran befand er sich an dem einzigen Ort auf der ganzen Welt, an dem er jemals leben wollte.
Mit einem Anflug blinder Wut packte Diane Fry ihre Schwester am Arm, zerrte sie zurück, sodass sie das Gleichgewicht verlor, und schubste sie aufs Bett.
»Hey!«, schnaubte Angie, schockiert über den plötzlichen Gewaltausbruch.
»Angie, was, zum Teufel, hast du vor?«
Diane hörte ihre eigene Stimme als gehässiges Fauchen. Sie klang schrecklich, doch sie konnte nichts daran ändern. Eine Flut von Emotionen überwältigte sie und schnürte ihr den Hals zu. Ärger, Verbitterung, das Gefühl, verraten worden zu sein. Und andere Emotionen, die sie noch nie zuvor empfunden hatte und die zu flüchtig waren, als dass sie sie hätte einordnen und benennen können.
»Ich?« Angie versuchte, die Angelegenheit mit einem Lachen abzutun, setzte sich auf dem Bett auf und zog ihren Ärmel glatt, als handelte es sich nur um ein Spiel, um eine Balgerei zwischen Geschwistern. »Du weißt doch, dass ich ständig was vorhabe, Schwester. Schließlich bin ich schon immer ein Problemkind gewesen.«
»Das ist mein Ernst. Ich möchte wissen, was das werden soll.«
»Komm schon, Di. Krieg dich wieder ein.«
Diane spürte, wie sie vor Wut rot anlief. Sie hatte sich vorgenommen, sich nicht über ihre Schwester zu ärgern. Doch hier war sie, all die Wut, die unmittelbar unter der Oberfläche brodelte. Jede Kleinigkeit konnte sie zum Überkochen bringen, ein falsches Wort oder eine unbedachte Bemerkung.
»Versuch nicht, mich an der Nase herumzuführen, Angie«, sagte sie. »Versuch das bloß nicht. Das mag früher funktioniert haben, aber heute tut es das nicht mehr. Zwischen uns ist einiges anders geworden. Ich bin nicht mehr deine kleine Schwester.«
»Ach, wirklich?«
»Ja, wirklich. Das muss dir endlich klar werden, sonst hat das mit uns keine Zukunft mehr.«
»Aber das ist doch nichts Neues, oder?«, schnappte Angie. »Das mit uns hatte noch nie eine Zukunft.«
»Was soll das heißen?«
»Wir haben eine Vergangenheit, das ist alles. Das ist das Einzige, was uns verbindet, die eine Sache, die wir gemein haben. Die Vergangenheit, mehr nicht. Wir wären niemals zusammengeblieben, Di. Ich weiß, dass dir das damals nicht bewusst war, aber ich wollte schon immer meinen eigenen Weg gehen, und der war nicht derselbe wie deiner. Wir hätten uns ziemlich bald getrennt, und du wärst an dein College gegangen und zu deiner Polizeiausbildung und hättest dich für deine große Schwester geschämt. Du solltest mir dankbar für das sein, was ich getan habe. Es war die beste Lösung.«
Diane spürte, wie ihr Ärger verflog. Er wurde von einem merkwürdigen Kältegefühl abgelöst, das ihr über die Haut kroch wie das erste Anzeichen einer Grippe.
»Aber jetzt sind wir wieder zusammen. Wir müssen darüber nachdenken, wie die Zukunft aussehen soll«, sagte sie. »Wir müssen ein paar Dinge regeln, damit diese Zukunft funktioniert.«
Angie erhob sich vom Bett, und Diane trat einen Schritt zurück, um für etwas Abstand zwischen ihnen zu sorgen.
»Du hast mir nicht zugehört, habe ich recht?«, sagte Angie. »Du hörst immer nur das, was du hören möchtest. Ich habe gerade gesagt, dass wir keine Zukunft haben. Wir hatten damals keine, und wir haben auch jetzt keine. Wir haben nichts gemein, Di. Und das wird sich auch nie ändern. Wenn du irgendwas anderes glaubst, machst du dir selbst was vor.«
»Nein, da täuschst du dich.«
»Oje. Das passt nicht ins Konzept, oder? Hast du dir ein nettes rosiges Bild ausgemalt, wie Angie und Di sich gemeinsam niederlassen und über Mädchenthemen wie Freunde und Babys reden? Wie wir uns gegenseitig die Hand halten, wenn uns danach ist, Rotz und Wasser zu heulen, und wie wir ein gutes Buch lesen und gemeinsam im Bett kichern? Das wird nicht passieren, Schwester. Also wird es Zeit, dass du der Realität ins Auge siehst.«
»Mir ist schon klar, dass du dich verändert hast. In der Hinsicht habe ich weiß Gott Zugeständnisse gemacht. Kein Wunder, dass wir in all den Jahren, die wir voneinander getrennt waren, unterschiedliche Wege eingeschlagen haben …«
»Verändert? Da hast du verdammt recht. Ja, ich bin diejenige von uns beiden, die erwachsen geworden ist. Ich bin schon vor langer Zeit erwachsen geworden.«
»Ach ja? Heroin zu nehmen, ist kein Zeichen dafür, dass man erwachsen ist.«
»Leck mich doch.«
Diane trat einen Schritt vor. Als sie sah, dass Angie begann, sich langsam in Richtung Tür zu bewegen, wurde ihr bewusst, dass ihre Schwester tatsächlich Angst vor ihr hatte. Ihr Wutausbruch wenige Minuten zuvor hatte Angie überrascht und ein wenig eingeschüchtert. Auch sie entdeckte Dinge an ihrer kleinen Schwester, die ihr womöglich nicht besonders gefielen.
»Komm, das kriegen wir schon hin, Angie. Wir müssen nur ehrlich zueinander sein.«
»Aha, und du willst, dass ich den Anfang mache, richtig? Es ist Zeit zu beichten, nicht wahr? ›Komm schon, meine Liebe, erzähl der netten Polizistin alles, was zu weißt. Wie wär’s, wenn du mir zuerst mal die Namen und Adressen aller deiner Freunde verrätst?‹ Di, du kapierst es einfach nicht, oder?«
Diane antwortete nicht. Sie merkte, wie sich ihr Verhältnis nach und nach umkehrte, wie sich ihre große Schwester in ihrer Gegenwart immer unwohler fühlte, als sei sie ein schuldbewusstes Kind. Zum ersten Mal in ihrem Leben hatte Diane das Gefühl, dass sie diejenige war, die die Macht hatte. In gewisser Weise war sie in der Lage, Angies Leben zu beeinflussen, anstatt umgekehrt. Das wusste sie, doch sie verstand nicht, weshalb es so war. Und dieses Wissen sorgte nicht dafür, dass sie sich besser fühlte.
Angie sah sie unsicher an und schlüpfte in ihre Jacke. »Ich gehe dann mal zur Arbeit.«
»Du kannst nicht immer davonlaufen. Wir müssen bald mal einiges zwischen uns klären.«
»Ja, ja. Wie du meinst.«
Als Diane beobachtete, wie Angie sich zur Tür stahl, war sie zwischen widersprüchlichen Impulsen hin- und hergerissen: dem Wunsch, ihre Schwester näher an sich zu binden, und gleichzeitig dem Verlangen, ihr wehzutun.
»Es gibt da eine Sache, die du auch nicht verstehst, Angie«, sagte sie.
»Die kannst du mir ein andermal erzählen.«
Dann war ihre Schwester aus dem Zimmer geschlüpft, und ihre Schritte klapperten auf den Treppenstufen, als sie zur Haustür lief.
Diane stand oben an der Treppe, und irgendetwas in ihr weigerte sich, die Auseinandersetzung als beendet zu betrachten.
»Und warum bist du ausgerechnet zu Ben Cooper gegangen?«, schrie sie ihr hinterher. »Ganz am Anfang – warum bist du zu ihm gegangen?«
Angie blieb stehen, doch nur um zurückzuschreien. »Weil ihm etwas an anderen Menschen liegt!«
»Ach ja? Tja, mir liegt auch etwas an anderen Menschen. Mir liegt bloß nichts an dir!«
Kaum war die Haustür ins Schloss gefallen, da bereute Diane ihre letzten Worte. Doch jetzt war es zu spät.
Sie starrte eine der Studentinnen aus der Nachbarwohnung zornig an, die den Kopf um die Ecke gestreckt hatte, um nachzusehen, was los war. Als die Studentin wieder verschwand, fragte sich Diane, ob sie noch jemals die Gelegenheit bekommen würde, Angie zu sagen, was es war, das sie nicht verstand.
Diane ging zurück in ihre Wohnung und sammelte die Kissen auf, die auf den Boden gefallen waren. Sie war überrascht, was für eine Unordnung herrschte. Es hatte beinahe den Anschein, als sei jemand in die Wohnung eingebrochen und habe sie durchwühlt. Wenn es sich um einen Tatort gehandelt hätte, an den sie gerufen worden war, hätte sie gesagt, dass es Anzeichen für eine gewalttätige Auseinandersetzung gab.
Hatte Angie womöglich noch immer ein Heroinproblem? Eigentlich war sie nicht der Meinung, doch Abhängige brauchten regelmäßig große Geldbeträge. Viele Frauen gingen sogar auf den Strich, um sich mit Stoff versorgen zu können. Mit Heroin oder mit Crack oder mit beidem. Drogen waren vielleicht nicht der Auslöser dafür gewesen, dass sie in der Gosse gelandet waren, doch Heroin sorgte dafür, dass sie dort blieben.
Diane wusste, dass schon vor Jahren Drogendealer aus den Großstädten in kleinere Städte wie Edendale umgesiedelt waren. Inzwischen bekam man Drogen an jeder Ecke, und zwar fast alles, was das Herz begehrte. Billig waren sie obendrein. Vielleicht war das eine Art Marketingtrick, um den Kundenstamm zu erweitern, doch die Statistiken zeigten, dass Edendale zu den billigsten Städten im Land gehörte, was Drogenpreise anbetraf. Das Letzte, was sie gehört hatte, war, dass Heroin für ungefähr zwanzig Pfund pro Tütchen zu haben war.
Sie hatte sich nach und nach etabliert, die Verbindung zwischen Heroin und Prostitution, und mittlerweile waren die beiden unzertrennbar. Der Teufelskreis war in vollem Gang.
Diane war überrascht von einem plötzlichen Geschmack in ihrem Mund. Dunkel, bitter, beruhigend. Es war ein überaus vertrauter Geschmack, voller Erinnerungen, der ihr ganzes Leben in sich zu vereinen schien, all die Tiefpunkte und die einsamsten Momente, vereint in einem kurzen Prickeln der Geschmacksknospen.
Ihre alte Lust auf Schokolade war zurückgekehrt, und die Vertrautheit war so intensiv, dass sie beinahe erschrak. Im Grunde genommen hatte sie seit Monaten nicht mehr über diese Lust nachgedacht. Doch irgendein Instinkt war in die Nervenenden in ihrem Mund gesickert, ausgelöst von Stress.
Es war nicht so einfach, eine Sucht loszuwerden. Sie konnte einen noch lange, nachdem man glaubte, sie bezwungen zu haben, beschleichen und überraschen. Sie lauerte im Körper und wartete auf einen schwachen Augenblick. Doch Diane Fry wusste, dass sie nicht schwach war – nicht mehr.
Abhängigkeit war etwas für andere, aber nicht für sie.