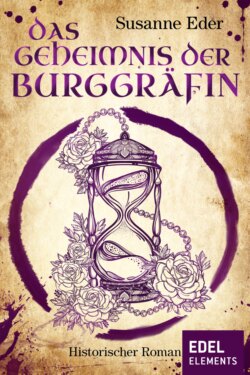Читать книгу Das Geheimnis der Burggräfin - Susanne Eder - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 3
ОглавлениеAmen«, beendete Bruder Fridegist das Tischgebet und fuhr im selben Atemzug fort: »Ich will Euch keineswegs drängen, Burggraf, doch Vater Hademar wird das Feuer auf dem Mittelberg bei Sonnenuntergang segnen. Wir sollten uns mit der Mahlzeit beeilen.«
Bandolf von Leyen, der während des Gebets auf den graubraunen Inhalt seiner Schüssel gespäht und sich gefragt hatte, was für eine Art Eintopf das darstellen sollte, hob den Kopf.
Da der Palas noch nicht fertiggestellt war, hatte sich der Burggraf von Worms, seit jüngster Zeit auch Vogt des Königs auf der Buchenburg, bei seiner Ankunft in Sachsen in die bedrückende Enge des Bergfrieds einquartiert gefunden. Zwar maß der stattliche Turm von außen gut und gerne fünfunddreißig Fuß von Kante zu Kante, im Innern konnten es jedoch kaum mehr als fünfundzwanzig sein. Einen Gutteil des Raumes nahm die Wendeltreppe ein, die zur Waffenkammer und weiter hinauf zum Ausguck führte. Der klägliche Rest der düsteren Kammer diente ihm als Halle.
Nur wenig Sonnenschein gelangte durch die Schießscharten von draußen ins Innere des Turms, und das Herdfeuer spendete mehr Qualm als Licht. Zwar hatte man versucht, der Dunkelheit mit Fackeln beizukommen, doch der Erfolg war allenfalls mäßig.
Der Burggraf warf einen Blick über den Tisch, an dem sich das Burggesinde zur abendlichen Mahlzeit versammelt hatte.
Zu seiner Rechten saß Bruder Fridegist, wie es ihm als Burgkaplan zukam, und neben ihm Meister Sigbrecht, der vierschrötige Baumeister. Gegenüber dem Kaplan, zu Bandolfs Linken, hatte sein Marschalk Herwald Platz genommen. Der große, hagere Mann löffelte den Eintopf bedächtig und ebenso schweigsam wie Ingild, die oberste der sächsischen Mägde. Eine weitere Magd und zwei Knechte taten sich am unteren Ende der Tafel am Eintopf gütlich. Zwischen Ingild und Herwald klaffte eine Lücke. Hier pflegte Prosperius, sein junger Schreiber, die Mahlzeiten in sich hineinzuschaufeln.
Der Burggraf runzelte die Stirn. Er hatte Prosperius nach dem Mittagsmahl nach Egininkisrod geschickt. Das Dorf lag höchstens eine Wegstunde von der Burg entfernt, und jetzt war es bereits nach der Vesper. Was hielt den Burschen nur so lange auf?
»Wir sollten uns nicht allzu spät auf den Weg machen«, brachte sich Bruder Fridegist in Erinnerung.
»Wozu die Eile?«, erkundigte sich Bandolf. Bislang hatte er nicht den Eindruck gehabt, als pflegte sich sein Burgkaplan durch übermäßigen Eifer hervorzutun.
Bruder Fridegists wulstige Lippen zerflossen zu einem Lächeln.
»Das Landvolk erwartet, dass Ihr dem Fest beiwohnt, und Vater Hademar wäre es gewiss schmerzlich, würdet Ihr erst nach dem Segen auf dem Fest erscheinen«, gab er zur Antwort.
»Tatsächlich? Man möchte kaum glauben, dass dem Abt von Sankt Mauritius so sehr an meiner Anwesenheit gelegen wäre«, bemerkte der Burggraf trocken.
»Nun, womöglich habt Ihr Vater Hademars zurückhaltende Natur ein wenig missdeutet?« Bruder Fridegist nickte, und sein erstaunlich großer Kopf schwankte bedenklich, als wolle er jeden Augenblick von seinem dürren Hals herunterfallen. Er war von schmächtigem Wuchs, mit dünnen Armen und Beinen. Im Gegensatz dazu wölbte sich sein Leib jedoch recht üppig über die Kordel seiner Kutte.
»Das denke ich nicht.«
»Es mag Vater Hademar womöglich auch ein wenig verstimmt haben, dass Ihr dem Kloster das Wegerecht und Jagdprivileg zwischen Mittelberg und Buchenfels abgesprochen habt?«, meinte Bruder Fridegist mit einem Hüsteln.
»Weder Jagdprivileg noch Wegerecht waren je das Eigen des Klosters, und nicht ich forderte die Privilegien zurück, sondern der König«, erklärte Bandolf scharf.
»Gewiss, gewiss.«
Gereizt verdrehte der Burggraf die Augen. Allmählich war er es leid, die Aufträge seines jungen Herrschers ständig zu rechtfertigen, und während er sich einen Löffel des unansehnlichen Breis in den Mund schob, dachte er an den vor Zorn erstarrten Abt von Sankt Mauritius, nachdem einer seiner Mönche den Brief des Königs an ihn vorgelesen hatte.
Bandolfs Miene verfinsterte sich noch mehr, als der saure Geschmack essiggetränkter Linsen seine Eingeweide zusammenzog. Er warf Ingild einen verärgerten Blick zu, den die Magd jedoch nicht zu bemerken schien. Am Morgen hatte er ihr gesagt, eine Spur mehr Würze würde ihren Mahlzeiten gewiss nicht schaden, und nun hatte sie seine Missachtung ihrer Kochkünste offenbar mit einem tiefen Griff ins Essigfass gerächt.
Während Bandolf mit Abscheu in seine Schüssel starrte und wehmütig an die schmackhaften Eintöpfe dachte, die seine Gattin und ihre Magd zu zaubern verstanden, überfiel ihn unversehens tiefe Sehnsucht nach seinem Weib und seinem Heim.
Er seufzte schwer.
Trotz ihrer heftigen Einwände hatte Bandolf seine Gemahlin in Worms zurückgelassen.
»Aber ich bin nur schwanger, nicht siech«, hatte Matthäa empört widersprochen, als er ihr erklärte, dass er ohne sie nach Sachsen aufbrechen würde.
»Eine solche Reise ist unsicher, mein Herz. Wegelagerer und alles mögliche Gesindel treiben auf den Straßen des Königs ihr Unwesen. Die Burg im Harudengau ist zudem noch im Bau befindlich, da stünden Euch weder Palas noch Kemenate zur Verfügung. Und ringsherum gibt es nichts weiter als düstere Wälder. Ganz abgesehen davon wollt Ihr unseren Sohn doch auch gewiss nicht ohne den Beistand der Heilerin zur Welt bringen?«
Matthäa hatte ihm ein nachsichtiges Lächeln geschenkt und mit einem Blick aus ihren schönen, rehbraunen Augen bedacht, der seinen Entschluss gefährlich ins Wanken brachte.
»Das schreckt mich nicht, glaubt mir. Ihr macht Euch viel zu viele Gedanken. Nicht einmal die Kaiserin Agnes hat gezögert, ihren Gatten über die Alpen zu begleiten, als sie schwanger war. Wie sollte ich mir da über ein paar Unbequemlichkeiten den Kopf zerbrechen? Und was den Beistand betrifft: nun, ich habe Garsende gefragt. Sie wäre bereit, uns nach Sachsen zu begleiten.«
›So ein verflixtes Weibsbild‹, hatte Bandolf im Stillen geflucht, war er doch davon überzeugt gewesen, dass Garsende die Erste wäre, seiner Gattin eine solche Reise in ihrem Zustand auszureden.
»Macht doch kein so bärbeißiges Gesicht«, hatte Matthäa gelacht. »Ich versichere Euch, Eurem Sohn und mir wird nichts geschehen.« Und mit einem Kuss, den sie auf seine bärtige Wange hauchte, hatte sie ihn stehen lassen.
Solange sie die Heilerin an ihrer Seite wüsste, würde er Matthäa die Reise nur schwer ausreden können, zumal er auch nicht die geringste Lust verspürte, sein Weib mit einem strengen Befehl zu kränken. Widerstrebend beschloss er, Garsende aufzusuchen.
Bandolf traf die Heilerin beim Anrühren einer ihrer streng riechenden Pasten an.
»Wie konntest du mir nur derart in den Rücken fallen«, fuhr er sie an, kaum, dass er ihre Hütte betreten hatte.
Garsende begrüßte ihn mit einem Seufzen. »Womit habe ich mir denn dieses Mal Euren Unmut zugezogen?«
»Matthäa besteht darauf, mich ins Sächsische zu begleiten«, fauchte er. »Und anstatt ihr die Flausen auszureden, bestärkst du sie auch noch darin.«
Erstaunt hob Garsende die Brauen. »Ihr messt mir zu viel Ehre bei, wenn Ihr glaubt, ich könne Eurer Gattin irgendetwas ein- oder ausreden.«
Bandolf warf ihr einen raschen Blick zu. Die hochgewachsene Gestalt der Heilerin steckte in einem schlichten Gewand, und der dicke, braune Zopf, der ihr über den Rücken bis zur Hüfte fiel, schien ihre Größe noch zu unterstreichen. Ein lebhaftes Lächeln pflegte Garsendes herbe Züge ansprechender zu machen, doch seit den Ereignissen im Frühjahr schien dieses Lächeln selten geworden zu sein.
Nachdenklich betrachtete Bandolf ihr schmales Gesicht. Er hatte nur mehr eine vage Erinnerung daran, was in jener Hütte geschehen war, aber bisher hatte sich nie die rechte Gelegenheit geboten, sie danach zu fragen. Für einen Moment überlegte er, ob er sich jetzt danach erkundigen sollte, doch sie fuhr bereits fort:
»Ich habe der Burggräfin wohl die Beschwerlichkeiten einer solchen Reise vor Augen geführt. Aber wie es scheint, ist sie gewillt, die Unbequemlichkeiten auf sich zu nehmen.«
»Matthäa hat bereits ein Kind verloren«, brummte Bandolf. »Soll es ihr wieder so ergehen?«
»Ein heftiger Sturz von der Treppe ist etwas ganz anderes als eine Reise. Noch dazu im Frühsommer.« Garsende runzelte die Stirn, und mit einem Mal sah er sich mit einem scharfen Blick bedacht. »Frauen haben ihre Männer zu allen Zeiten auf Reisen begleitet. Warum seid Ihr so beunruhigt? Da ist doch noch mehr, das Ihr befürchtet?«
Unschlüssig, was er ihr antworten sollte, ließ Bandolf seinen Blick über Töpfe, Tiegel, Krüge und die unzähligen Kräuterbündel wandern, die jeden freien Winkel in der Hütte zierten.
Er seufzte. Garsende würde ja doch keine Ruhe geben, ehe er ihr eine befriedigende Erklärung gegeben hatte. Mit einiger Mühe schob er seinen großen, stämmigen Körper auf die Bank hinter dem mit allerlei Grünzeug überladenen Tisch.
»Die Lage in Sachsen ist angespannt, um nicht zu sagen, feindselig«, sagte er endlich.
Schweigend nahm Garsende ihm gegenüber Platz.
»König Heinrich ist in Schwierigkeiten«, fuhr er fort. »Seit seine Mutter, Kaiserin Agnes, und später dann die Erzbischöfe Anno von Köln und Adalbert von Bremen in der Zeit ihrer Vormundschaft über den König seine Krongüter mit vollen Händen an die Fürsten verteilt haben, mangelt es dem König an Einkünften. Noch bevor er gestürzt wurde, verfiel Erzbischof Adalbert von Bremen auf den Gedanken, Heinrich könne seine Krongüter in Sachsen zurückfordern, um diesen Mangel zu beheben.«
»Das verstehe ich nicht«, unterbrach ihn Garsende. »Warum muss der König sie zurückfordern? Gehören sie ihm denn nicht?«
Der Burggraf verzog das Gesicht.
»Die Ländereien haben einst den Liudolfingern gehört, dem sächsischen Herrschergeschlecht der Ottonen«, erklärte er. »Als der letzte Kaiser aus dieser Sippe ohne direkten männlichen Nachkommen starb, wurde ein Salier zum König gewählt: Konrad II. aus fränkischem Geschlecht. Nach seiner Wahl forderte Konrad auch die Ländereien des letzten ottonischen Kaisers in Sachsen als sein Krongut ein. Er war der Ansicht, dass er als Erbe der Krone auch rechtmäßiger Erbe jener Ländereien sei. Die sächsischen Edlen, namentlich Verwandte der Ottonen, waren jedoch anderer Meinung und beanspruchten die Ländereien für sich.«
Für einen Augenblick hielt er inne und strich sich nachdenklich über den Bart. »Konrads Lage dazumal war verzwickt«, sagte er schließlich. »Die Sachsen taten sich ohnehin schwer damit, einen fränkischen Salier als König anzuerkennen. Hinzu kam, dass in jener Zeit auch Rudolf III., der König von Burgund, starb. Auch ohne direkten Nachkommen. Und König Rudolf von Burgund übergab seine Krone dem fränkischen Reich, in Gestalt Kaiser Konrads II. Auch Rudolfs Sippschaft war mit diesem Schritt keineswegs einverstanden und machte Konrad die Krone von Burgund mit Waffengewalt streitig. Konrad war damit beschäftigt, seinen Anspruch in Burgund durchzusetzen, und konnte es sich nicht leisten, sich auch noch durch eine Auseinandersetzung mit dem sächsischen Adel zu verzetteln. Also vernachlässigte er das sächsische Krongut, und sein Nachfolger, König Heinrichs Vater, tat es ihm gleich.«
Fragend sah er Garsende an. »Hast Du das verstanden?«
»Die Sachsen mochten das Krongut nicht hergeben, das der fränkische Konrad von seinem sächsischen Vorgänger geerbt hatte«, wiederholte sie gehorsam.
Für einen Augenblick runzelte er verdutzt die Stirn.
Garsende lachte nun doch. »Himmel, Burggraf, was gäbe es daran nicht zu verstehen?«
»Schön«, brummte er. »Da also kein salischer König das Krongut in Sachsen je mit dem nötigen Nachdruck eingefordert hat, haben sich im Lauf der Zeit die dort ansässigen Edlen auf dem Königsland breitgemacht. Und sind nun ausgesprochen unwillig, es wieder herauszugeben. König Heinrich kann jedoch nicht auf die Einkünfte aus diesen Ländereien verzichten. Also hat er beschlossen, seinem Anspruch Nachdruck zu verleihen, indem er Burgen auf den königlichen Ländereien erbauen lässt. Was wiederum nicht nur den sächsischen Adel, sondern auch das Bauernvolk gegen König Heinrich aufbringt.«
Garsende runzelte die Stirn. »Bliebe es denn für einen Bauern nicht gleich, wem er nun seine Fron zu leisten hat, dem König oder dem sächsischen Edlen?«, wollte sie wissen.
»Wenn es so einfach wäre, befände ich mich jetzt nicht in meinem Dilemma«, erwiderte der Burggraf und wedelte ungeduldig mit der Hand. »Zum einen sind die Bauern verpflichtet, Hand- und Spanndienste beim Bau einer Burg zu leisten, was bedeutet, dass sie ihr eigen Feld und Vieh vernachlässigen müssen. Und zusätzlich haben sie zu den üblichen Abgaben auch für die Verpflegung der Burgherren, deren Gefolge und Burgmannschaften aufzukommen.« Mit einer Grimasse fügte er hinzu: »Noch dazu hält sich der König selbst derzeit häufiger als gewöhnlich in Sachsen auf, um den Bau seiner Burgen zu überwachen. Nun sind Städte wie Quedlinburg und Goslar aber dazu verpflichtet, ihn und seinen Tross zu unterhalten. Das geht wiederum zulasten der sächsischen Bauern. Und um das Maß vollzumachen, bestellt König Heinrich, der den Sachsen nicht traut, nun auch noch Landesfremde als Verwalter seiner Burgen und Herren über Land und Leute. Königstreue aus dem Süden. Männer wie mich.« Bandolf seufzte. »All das nährt den Zorn der Sachsen, der vom Adel noch kräftig geschürt wird.«
»Ich finde den Groll der sächsischen Bauern gegen den König nicht unverständlich«, bemerkte Garsende, als er schwieg.
»Womöglich«, gab Bandolf zu. »Doch es müsste nicht so sein, gäbe der sächsische Adel dem König, was des Königs ist. Die Bauern sollten sich bei den widerborstigen, sächsischen Edlen über ihre missliche Lage beschweren, und nicht beim König, der nur einfordert, was ihm gehört.«
»Dann seid Ihr überzeugt, dass König Heinrich im Recht ist?«
»Gewiss. Wenn ich dir eine Hufe vererbe, dann gebe ich dir auch die Hörigen dazu, die das Gut bewirtschaften. Ansonsten ist dir das Land nur wenig von Nutzen. Und geht die Krone von einem König zum anderen, muss auch das Land gegeben werden, ansonsten kann das Reich nicht regiert werden.«
Der Burggraf schälte sich hinter Garsendes Tisch hervor und streckte seine strammen Glieder. »Noch ist es in Sachsen nicht zu offenem Widerstand gegen den König gekommen. Aber wenn du mich fragst, ist das nur eine Frage der Zeit. Und ich will verdammt sein, wenn ich mein schwangeres Weib in ein solches Wespennest setze.«
»Warum sprecht Ihr denn nicht mit Eurer Gattin, so wie Ihr mit mir gesprochen habt? Eure Vorbehalte würden ihr ganz gewiss einleuchten«, fragte die Heilerin. Auch sie hatte sich erhoben.
»Und Matthäa in ihrem Zustand dergestalt beunruhigen?«
»Wenn es in Sachsen zu Unruhen kommt, dann werden wir in Worms davon hören, so viel ist sicher.«
»Sollte es dazu kommen, wird es früh genug sein, dass mein Weib sich ängstigt«, erklärte er. »Dir habe ich auch nur darum davon berichtet, damit du sie von dem unsinnigen Wunsch abbringst, mich begleiten zu wollen.«
Garsendes Stirnrunzeln vertiefte sich. »Und wie dachtet Ihr Euch, soll ich das bewerkstelligen?«, erkundigte sie sich.
»Sag ihr, eine solche Reise würde dem Kind in ihrem Leib schaden. Ich denke, das wird genügen.«
»Bei allen Heiligen, Burggraf!«, rief sie empört. »Bildet Ihr Euch wirklich ein, das würde sie weniger beunruhigen?« Vehement schüttelte sie den Kopf. »Ich werde Eure Gemahlin gewiss nicht belügen!«
»Es ist mir ganz gleich, wie du es anstellst«, erklärte er unnachgiebig, »Hauptsache, Matthäa bleibt in Worms und bringt unseren Sohn mit Gottes Hilfe in Sicherheit zur Welt.«
Das selten gewordene Lächeln huschte über Garsendes Gesicht. »Wie kommt Ihr denn darauf, dass Eure Gemahlin einen Sohn gebären wird?«, erkundigte sie sich. »Womöglich bekommt Ihr ja eine kleine Tochter.«
»Unsinn. Matthäas Leib ist fest und rund, und ihre Wangen sind rosig. Da wird es ein Knabe«, erklärte er im Brustton der Überzeugung.
»Darauf würde ich mich nicht allzu sehr verlassen«, meinte die Heilerin, doch Bandolf winkte nur ab.
Letzten Endes hatte Garsende nachgegeben. Wie sie es zuwege gebracht und was sie zu seinem Weib gesagt hatte, wusste Bandolf nicht. Aber als er Worms Mitte Mai mit Herwald, seinem Marschalk, und Prosperius, seinem jungen Schreiber, verlassen hatte, schien Matthäa nicht unglücklich darüber zu sein, in der Stadt zu bleiben. Auf ihren Wunsch hatte die Heilerin sich bereit erklärt, während Bandolfs Abwesenheit in sein Haus zu ziehen, um ihr Gesellschaft zu leisten und da zu sein, wenn ihre Zeit kommen würde. Ein Umstand, der insgeheim zu seiner Beruhigung beitrug.
»Für die Burgkapelle ist ein Anbau am Palas vorgesehen. Und daran werde ich mich halten.« Die leise Verzweiflung in Meister Sigbrechts Stimme holte Bandolf aus seinen Gedanken. Er sah auf.
Der Baumeister warf Bruder Fridegist einen schrägen Blick zu und verzog sein Gesicht, als litte er an einem fauligen Zahn. »Ich bin nicht befugt, die Pläne eigenmächtig zu ändern.«
»Aber nein. Da sei Gott vor, dass ich mich vordrängen wollte, doch mir will scheinen, dass Euch keineswegs bewusst ist, welche Bedeutung einer Burgkapelle zukommt, mein Lieber.« Nachsichtig lächelnd schüttelte der Kaplan seinen großen Kopf.
»Wie ich Euch bereits mehrmals sagte, Bruder, habe ich die Pläne für die Buchenburg nicht gemacht«, erklärte Meister Sigbrecht ungeduldig. »Ich bin lediglich der Baumeister, nicht der Bauherr. Wenn Ihr eigens für die Burgkapelle einen freistehenden Bau wünscht, so müsst Ihr Euch an Benno von Osnabrück wenden. Er ist der Bauherr im Auftrag des Königs.«
Bandolf unterdrückte ein Seufzen. Seit seiner Ankunft auf der Buchenburg lag Bruder Fridegist nicht nur dem Baumeister, sondern auch ihm mit einem separaten Gebäude für die Burgkapelle in den Ohren. Ein Anliegen, das er zu Bandolfs Leidwesen bei jeder Mahlzeit auf den Tisch brachte.
»Wann werdet Ihr den Palas fertiggestellt haben?«, mischte er sich ein, bevor der Kaplan Gelegenheit hatte, seinen Herzenswunsch erneut ausführlich zu erörtern.
»Wenn alles so geht, wie es soll, was ich nachgerade bezweifle, solltet Ihr zum Tag des heiligen Paulinus in den Palas übersiedeln können«, antwortete Meister Sigbrecht.
Bandolf runzelte die Stirn. Noch über zwei Monate, und einen länger als vorgesehen.
»Gibt es Schwierigkeiten?«, wollte er wissen.
»Ich habe zu wenig Leute, Burggraf. Achtzig Steinmetze sollten es sein, aber man hat mir nur fünfzig zugestanden, und von den einhundertfünfzig Maurern, die ich bräuchte, gab man mir gerade hundert. Des Weiteren fehlen mir zu den dreihundert Sächsischen für Hand- und Spanndienste auch noch hundert, und die, die ich habe, sind unwillig und faul.« Ungeachtet des giftigen Blicks, den Ingild ihm zuwarf, fuhr der Baumeister fort: »Das ginge vielleicht noch an, würde wenigstens die Zulieferung so sein, wie sie sollte. Doch die Quader aus den Steinbrüchen treffen meist verspätet ein, und oft sind die Steine auch noch schadhaft und müssen ausgebessert werden.«
Und ebenso verhält es sich mit der Verpflegung, dachte der Burggraf verdrossen. Auch die Nahrungsmittel von den umliegenden Hufen trafen nur zögerlich auf der Burg ein, ab und an gar verdorben. Verantwortlich seien die Hände, die auf den Hufen zum Bestellen der Felder und zum Versorgen des Viehs fehlten, weil sie zum Bau der Burg gebraucht würden, bekam er wohl zu hören, die Hitze, die Getreide und Fleisch schnell verdarb, und das Salz, an dem es zu mangeln schien.
Zum Teil mochte das stimmen, doch Bandolf hegte den Verdacht, dass sich hinter so mancher Widrigkeit die Absicht verbarg, dem landesfremden Burggrafen so viele Steine wie möglich in den Weg zu legen.
›Dabei würde schon die Kochkunst dieser ewig mürrischen Magd vollauf genügen, mir den Aufenthalt hier zu verdrießen‹, überlegte er, während er die halb leere Schüssel angewidert von sich schob. Sein Magen knurrte, und er warf Ingild einen scheelen Blick zu. Gleichmütig vor sich hinstarrend, schob die Magd einen Löffel des sauren Breis nach dem anderen in ihren verkniffenen Mund und schien sich an der Unzulänglichkeit ihrer Kost nicht im Geringsten zu stören.
Mit einem Brummen wandte sich Bandolf ab. Mochte er auch Verständnis für die missliche Lage der Sachsen haben, so schwand dieses doch merklich mit jedem Fingerbreit, um den die Tunika um seinen stattlichen Leib weiter wurde.
Die Vorratshaltung der Burgküche zu überwachen gehörte zu den Aufgaben seines Schreibers. Aber ausgerechnet der ewig hungrige Prosperius, der sich sonst so prächtig darauf verstand, jede Köchin anzuspornen und selbst noch einem Geizkragen einen Kanten Brot abzuschmeicheln, gefiel sich neuerdings offenbar mehr im Pflegen seiner Säfte als im Füllen seines Magens. Ganz abgesehen vom vernachlässigten Magen seines Herrn.
Unwillkürlich fiel Bandolfs Blick wieder auf den leeren Platz zwischen seinem Marschalk und der Magd, und er runzelte die Stirn.
Gebockt hatte der Bengel wie ein Ochse, der zur Schlachtbank muss, als er hörte, dass er den Burggrafen ins Sächsische begleiten sollte, und die abenteuerlichsten Ausflüchte gefunden, warum er Worms auf keinen Fall verlassen könnte. Und seit sie im Harudengau angekommen waren, schien er bestrebt, sich unsichtbar zu machen.
›Da kommt er mir erst widerspenstig und will die Nase nicht vors Tor strecken, und jetzt vertrödelt sich der verflixte Bursche Gott weiß wo.‹
Verärgert beschloss der Burggraf, dass es höchste Zeit war, seinem Schreiber deutlich zu machen, dass er die Geduld seines Herrn weit über Gebühr strapazierte.
Eine feuerrote Sonne berührte die Wipfel der Bäume, als Bandolf mit Bruder Fridegist, Meister Sigbrecht und Herwald im Schlepptau auf der Hochebene des Mittelbergs eintraf. Aufgeregtes Stimmengewirr, Gelächter und der Duft nach Kräutern und Gebratenem schlugen ihnen entgegen. Jung und Alt aus den Dörfern und Hufen rund um den Buchenfels und Mittelberg hatten sich um den drei Mann hohen Holzstoß versammelt. Doch der fröhliche Lärm verebbte, als der Burggraf mit seinem spärlichen Gefolge den Festplatz betrat. Für einen Augenblick hatte er das Gefühl, als würde er von hundert Blicken durchbohrt. Endlich lösten sich ein alter Mann und eine Bauersfrau im Festtagsstaat aus der Menge und kamen, ein sichtlich widerstrebendes kleines Mädchen vor sich her schiebend, auf ihn zu.
»Seid willkommen, Herr«, murmelte die Bauersfrau mit einer Verbeugung und überreichte dem Burggrafen einen gefüllten Krug. Indem Bandolf sich unbehaglich der feindseligen Blicke bewusst war, rann der Met nur zäh durch seine Kehle, und er schickte ein Stoßgebet zum Himmel, dass der Honigwein nicht unbekömmlich wäre.
Nachdem er den Krug zurückgegeben hatte, trat der Greis vor. Sein hartes Gesicht war von unzähligen Falten durchzogen, und er starrte Bandolf finster an. Ob vom Alter eingeschränkt oder mit Vorsatz, neigte er nur andeutungsweise sein Haupt, bevor er mürrisch knurrte:
»Wer kein Holz zum Feuer gibt, erreicht das ewig’ Leben nicht.«
Dann stieß er Bandolf einen Holzscheit in die Hand, so rasch, dass der Burggraf ihn beinahe hätte fallen lassen.
Schließlich war das Kind an der Reihe. Das blonde Lockenköpfchen zur Seite geneigt, spähte es vorsichtig, doch offenkundig neugierig an Bandolfs großer, stämmiger Gestalt empor, während es ihm mit weit ausgestrecktem Arm einen schweißfeuchten Kranz entgegenhielt.
»Wie dieser Kranz ... möge all ... Euer Missgeschick ... verbrennen und ... in Nichts ver– ... zerfallen«, stieß es atemlos hervor.
Bandolf lächelte, und ein erleichtertes Grinsen huschte über das Gesicht des Mädchens. Unwillkürlich streckte er die Hand aus, um über den Kopf der Kleinen zu streichen, doch da wich es ängstlich vor ihm zurück.
›Vermutlich hat man ihm erzählt, ich trüge unsichtbare Hörner und Hufe unter meinen Stiefeln‹, dachte er launig und seufzte.
Nachdem er dem Brauch Genüge getan, sich für die Gaben bedankt und den Versammelten Gottes Segen gewünscht hatte, überhauchte nur noch ein schmaler Streifen Rot den Himmel im Westen. Während es rasch dunkler wurde, schwoll das Stimmengewirr allmählich wieder an.
»Geh und sieh nach, ob du Prosperius irgendwo in der Menge finden kannst«, befahl Bandolf seinem Marschalk. »Wenn er sich im Dorf vertrödelt hat, ist er womöglich mit den Leuten aus Egininkisrod heraufgekommen.«
»Vermutlich hat sich Euer Schreiber dem Trunk ergeben und schläft in einer Dorfgrube seinen Rausch aus«, mutmaßte Bruder Fridegist, leckte sich über die Lippen und schüttelte missbilligend den Kopf.
›Als würdest du dir Mäßigung auferlegen‹, dachte Bandolf mokant, hatte er den Kaplan doch erst kürzlich dabei ertappt, wie er begehrlich auf Ingilds magere Brüste gestarrt hatte.
Mit einem Schnauben wandte Bandolf sich von ihm ab. »Geh und such mir den Burschen«, wiederholte er seinem Marschalk.
»Scheint mir nicht angeraten, Herr, Euch zu verlassen«, erwiderte Herwald kurz angebunden. Sein hageres Gesicht zeigte keinerlei Regung, doch der starre Blick seiner hellen Augen schien jedermann deutlich machen zu wollen, dass es nicht bekömmlich wäre, dem Burggrafen zu nahe zu kommen.
»Was denn? Glaubst du wirklich, man würde mir ausgerechnet hier ein Messer zwischen die Rippen rammen?«, fragte Bandolf erheitert.
Sein Marschalk zuckte nur mit den Schultern, rührte sich jedoch nicht von der Stelle.
»Na schön, wie du willst.« Bandolf seufzte. »Dann halte wenigstens nach Prosperius Ausschau. Ich habe gute Lust, dem Bengel das Fell über die Ohren zu ziehen.«
Kaum hatte der Burggraf zu Ende gesprochen, als es unversehens wieder still wurde. Vom Pfad, der sich vom Waldrand unterhalb der Hochebene nach oben schlängelte, sah man Lichter aufflackern, und die milde Sommerluft trug leisen Gesang zum Berggipfel herauf.
Kurz darauf zog die Prozession der Mönche aus Sankt Mauritius auf dem Festplatz ein. Einer der Brüder trug ein mit Silber beschlagenes Kreuz voraus, dicht gefolgt vom Abt und den Mönchen, die mit Fackeln in den Händen hinter ihm einherschritten.
Füße scharrten. Holzpantinen klapperten. Die versammelte Menge ging in die Knie. Und mit ihnen der Burggraf.
Vater Hademar zeichnete das Kreuz in die Luft, ehe er, den Weihrauchkessel schwenkend, mit seinen singenden Mönchen dreimal um den Holzstoß zog.
Schließlich kam die Prozession dicht neben dem Platz des Burggrafen zum Stehen.
»A Iulgere, giandine et tempestate. Von Blitz, Hagel und Ungewitter«, intonierte der Abt.
»Libera nos, Domine, Jesu Christe. Erlöse uns, oh Herr, Jesus Christus«, antworteten die Mönche.
»Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam. Erzeige uns, Herr, deine Barmherzigkeit.«
Und während die Mönche antworteten, bemerkte Bandolf aus dem Augenwinkel, dass der Abt ihn anstarrte. Fragend erwiderte er den eigentümlichen Blick, doch Vater Hademar hatte seine Augen bereits wieder auf den Holzstoß gerichtet, sodass Bandolf sich fragte, ob der Schein der vielen Fackeln ihn nicht getäuscht hatte.
Der letzte rötliche Schimmer verschwand vom nächtlichen Himmel, und nur noch die Fackeln erhellten den Platz, als der Abt zum Ende kam: »Benedictio Dei omnipotentis, Patris et filii et Spiritus sancti, descendat super vos, locum istum, fructus terrae et maneat semper. Der Segen Gottes, des Allmächtigen, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, steige herab auf euch, diesen Ort, die Früchte der Erde, und bleibe immerdar. Amen.«
Bandolf bekreuzigte sich, erhob sich zusammen mit der Menge und schaute für einen Moment verdutzt auf die Fackel, die man ihm in die Hand drückte. Dann begriff er, dass ihm als Herr der Burg offenkundig die Ehre zukam, das Sonnwendfeuer zu entzünden.
Im Wormsgau wurde die Sonnenwende erst drei Tage später zum Fest Johannes des Täufers gefeiert, und es war Aufgabe der Priester, die Johannisfeuer zu entfachen. Doch in Sachsen pflegte man augenscheinlich den alten Brauch. Hier schien noch der weltliche Herr in der Pflicht zu stehen, die Gottheit dem Volk geneigt zu machen.
Mit einem flauen Gefühl im Magen trat der Burggraf vor. Wenn die Scheite mit seiner Fackel nicht Feuer fangen würden, wäre sein ohnehin spärliches Ansehen bei den Haruden gewiss vollends dahin. Mit einem Stoßgebet zum Allmächtigen warf Bandolf die Fackel in den Holzstoß, Scheit und Kranz hinterher, und hielt den Atem an. Unentschlossen züngelte die kleine Flamme herum, wurde kleiner, und für einen Moment schien sie verlöschen zu wollen. Doch dann fing das Reisig am Fuß des Holzstoßes Feuer, die Flämmchen leckten gierig an den Scheiten, bis die ersten brannten. Erleichtert holte Bandolf Luft, als die Leute jubelnd ihre Fackeln der seinen hinterherschickten.
Während die Mönche sich hinter ihrem Abt formierten und, das Te Deum laudamus anstimmend, an Bandolf vorbei dem Pfad bergabwärts zustrebten, sah er zu, wie das Feuer in den dunklen Nachthimmel loderte.
»Glaubt nicht alles, was Euch zu Ohren kommt«, raunte eine Stimme an seinem Ohr.
Der Burggraf fuhr herum, doch außer Herwald schien sich niemand in unmittelbarer Nähe zu befinden.
»Hast du das gehört?«, fragte er scharf.
»Was denn, Herr?«
Ohne zu antworten, schüttelte Bandolf den Kopf, während er sich wachsam umschaute.
Bruder Fridegist, der während der Segnung noch neben ihm gekniet hatte, war verschwunden, und von Meister Sigbrecht sah er just die kräftigen Schultern, die sich durch die Menge in Richtung der am Spieß bratenden Hühner schoben.
Die Aufmerksamkeit des Bauernvolks schien gänzlich auf den brennenden Holzstoß gerichtet, auf die Fässer mit Bier und Met, die man eigens zum Fest auf den Berg heraufgeschafft hatte, auf die Flötenpfeifer und Lautenzupfer, und auf die jungen Burschen und Mädchen, die bereits ausgelassen um das Feuer tanzten. Hie und da fing Bandolf verstohlene Blicke auf, die augenscheinlich ihm galten: manch einer argwöhnisch, einige neugierig, und viele feindselig. Das Volk hielt auffallend Abstand, als wäre er mit Aussatz behaftet.
Der Burggraf runzelte die Stirn. War er einer Sinnestäuschung erlegen? Hatte einer der Geister ihn genarrt, die zur Sonnenwende aus dem Totenreich emporstiegen, um mit den Lebenden ums Feuer zu tanzen? Die flüsternde Stimme war so leise und rasch an ihm vorbeigeweht, dass er sich nicht einmal sicher war, ob sie einem Mann oder einem Weib gehört hatte.
Glaubt nicht alles, was Euch zu Ohren kommt.
Was, zum Henker, sollte das bedeuten?