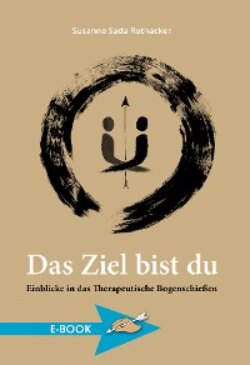Читать книгу Das Ziel bist du - Susanne Sada Rothacker - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 2
Im Folgenden wende ich mich einigen Themen zu, die sich im und durch das Bogenschießen zeigen können. Vorab ist mir dies noch wichtig: Alles, was ich beschreibe, kann sich so zeigen, muss es aber auch nicht. Für mich ist jede Bogenbegegnung, jeder Prozess einmalig, und daher soll das Folgende einzig Facetten von Möglichkeiten aufzeigen.
Der Bogen – Sinnbild für Schutz und Wehrhaftigkeit
Pfeile und Bögen waren über viele Jahrhunderte hinweg die wichtigste Verteidigungs- und Angriffswaffen vieler Kulturen. Sich schützen und wehren zu können ist daher das ursprünglichste Thema, das im Bogenschießen liegt. Und dies kann ein sehr wichtiges Thema in der therapeutischen Arbeit sein.
Viele meiner Klient*innen haben im Laufe ihres Lebens eindrückliche und tiefgehende Erfahrungen der Hilflosigkeit, Handlungsunfähigkeit oder gar Ohnmacht erlebt. Manche wurden in ihren aggressiven Impulsen gestoppt und bestraft; bei anderen von ihnen waren Gewalterfahrungen an der Tagesordnung.
In jenen blieb meist die tiefe innere Überzeugung zurück, dieser Welt schutz- und machtlos ausgeliefert zu sein. Für die meisten ging es darum, aushalten und durchhalten zu müssen, ohne etwas an der Situation selbst verändern zu können, und dabei einzig darauf zu warten, dass der Sturm an ihnen vorüberzieht. Ihr Lebenskonzept hieß daher vor allem erst einmal, zu überleben.
Kommen sie nun mit dem Bogen in Kontakt, ist einer der zentralen Momente oft derjenige, wenn sie diesen aufgespannt haben und sich an der Schusslinie positionieren.
Seitlich vor den Körper gehalten wird der Bogen durch seine gebogene Form zu Hülle und Schutz; er rahmt sie ein, setzt eine deutlich sichtbare Begrenzung, und vermittelt unmissverständlich
„Bis hierher – und nicht weiter!“
In diesem Moment erfahren sie oftmals, dass es tatsächlich so etwas wie einen Schutzraum geben kann, denn niemand würde dieses „Stopp!“ eines gespannten Bogens ignorieren – schon gar nicht, wenn noch ein Pfeil aufgelegt wird.
Aus diesem Schutz heraus fliegt ihr Pfeil nach außen, und dies kann nur durch sie selbst geschehen. Vielleicht agieren sie hier zum ersten Mal in ihrem Leben, anstatt wie bisher nur zu reagieren. Gleich, ob nun der Pfeil an der Scheibe vorbeifliegt oder diese trifft – es gibt auf jeden Fall ein sichtbares Ergebnis. Ihr Tun hat also tatsächlich eine Wirkung. Dies wirklich erleben und begreifen zu können, ist der erste Schritt heraus aus dem beengenden und beängstigenden Glaubensmuster des Ausgeliefertseins, der eigenen Ohn-Macht.
Jedoch kann dieser Moment auch etwas ganz anderes in Klient*innen auslösen. Denn alles, was sie sicht- und hörbar machen würde, lenkt auch Aufmerksamkeit auf sie. Und dies konnte früher für sie bedrohlich oder gar lebensgefährlich werden. Daher ist es für diese Klient*innen manchmal zunächst unmöglich, trotz des Schutzes des Bogens einen Pfeil abzuschießen.
Um sich wehren und verteidigen zu können, bedarf es der Fähigkeit, Aggressionen zuzulassen; wütend zu sein, zornig; bereit, sich zu wehren, zu kämpfen und vielleicht auch zu zerstören. Dies sind alles Impulse, die unserem Überleben dienen und für unser Leben notwendig sind. Oft ist es jedoch gerade für Klient*innen mit Gewalterfahrungen schwer, wenn nicht sogar unmöglich, diese zuzulassen oder gar auszudrücken. Denn all diese Impulse verbinden sie mit dem Menschen, der sie bedrohte, und in dessen Fußstapfen sie auf keinen Fall treten wollen.7)
Doch es bedarf nicht unbedingt dieser Erfahrungen, um sich schwer damit zu tun, aggressiv sein zu dürfen. Unsere Gesellschaft bewertet Aggression und Wut meist negativ, als schlechte oder gar böse Gefühle, und lehrt daher schon früh, diese zu unterdrücken oder zumindest zu beschönigen. Denn würden sie einfach zugelassen, dann würden sie „kein Gras mehr wachsen“ lassen.
Eine Befürchtung, die in ihrer Absolutheit meistens überzogen und irreal ist. Denn sie entbehrt völlig der Option, dass es auch möglich ist, den Ausdruck der Aggression angemessen an die jeweiligen Situationen anzupassen.
Zunächst kann dies auch für manche Klient*innen sicherlich so nicht sein. Denn wenn von ihnen über viele Jahre hinweg immer wieder ihre Aggression und Wut verneint und verdrängt wurden, konnten sie nicht ausprobieren und üben, mit diesen adäquat umzugehen. Dann bleibt die Furcht vor derer Allgewalt, und die Überzeugung, dass es auf jeden Fall besser und sicherer ist, ihnen weiterhin aus dem Weg zu gehen.
Da der Bogen unweigerlich mit seinem Waffenaspekt konfrontiert, kann der Umgang mit ihm eine Möglichkeit darstellen, dies Versäumte nachzuholen. Mit jedem Pfeil, den sie abschießen, können sie mehr mit ihren kriegerischen Impulsen in Kontakt kommen, ihren Ärger und ihre Wut ausdrücken. Geschieht dies mit innerer Achtsamkeit8), kann mit diesen verschiedenen Facetten experimentiert und erfahren werden, dass diese nicht per se blind und vernichtend sein müssen. Dies kann zu der Erlaubnis werden, wehrhaft zu sein und sich auch wehren zu dürfen.