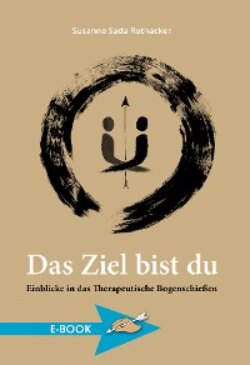Читать книгу Das Ziel bist du - Susanne Sada Rothacker - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 1
Die Ausrüstung und ihre therapeutische Bedeutung
Der Bogen
Braucht es einen bestimmten Bogen, um damit therapeutisch arbeiten zu können? Ich würde diese Frage weder kategorisch verneinen noch bejahen. Denn in erster Linie kommt es darauf an, um welche Erfahrungsmöglichkeiten in der Arbeit mit Pfeil und Bogen es gehen soll. Liegt z.B. die Entspannung (äußere wie auch innere) im Fokus; oder geht es mehr um wahrnehmen, zulassen und ausdrücken dessen, was ist? So wird für das Arbeiten an Entspannung, Rhythmus, Synchronizität etc. nicht unbedingt ein Bogen benötigt, der lange im vollen Auszug gehalten werden kann. Bei einer Arbeit, die sich mehr dem Untersuchen, Experimentieren und Ausdrücken des momentan Wahrnehmbaren verschrieben hat, kann dies jedoch wichtig sein.
Neben dieser Grundsatzfrage ist auch die eigene Vorliebe entscheidend. Da ich die ersten Schritte meines Bogenweges mit einem selbstgebauten Langbogen gegangen bin, und mich die Schlichtheit und Natürlichkeit darin sehr ansprach, habe ich diese Bogenart auch in meine therapeutische Arbeit übernommen, allerdings nicht mehr als einen reinen Holzbogen, sondern mit Glasfaser laminiert.
Der Langbogen ist „wie aus einem Guss“ hergestellt, alles ist schon in und an ihm vorhanden, nichts muss noch dazu geschraubt werden. Dies könnte schon als eine erste Metapher gesehen werden: Alles, was es braucht, ist schon vorhanden, geht ineinander über und gehört untrennbar zusammen.
Wie beim Bogen, so auch beim Menschen. Und wie der Mensch ist auch dieser Bogen nicht mehr ganz ursprünglich, sondern durch die Glasfaserschicht künstlicher, aber damit auch moderner geworden, der heutigen Zeit angepasst.
Die Glasfaserschicht macht den Bogen nicht nur widerstandsfähiger gegen Wettereinflüsse und Temperaturschwankungen, sondern auch gegen einen unvorsichtigen und vielleicht raueren Umgang. Er benötigt nicht immer eine so achtsame und behutsame Behandlung wie ein reiner Holzbogen. So kann er auch einmal über Stunden hin aufgespannt stehen bleiben und muss nicht nach längerem Ruhen jedes Mal vorsichtig erwärmt und eingeschossen werden. Ein solcher Bogen gestaltet das Mit-ihm-Sein ziemlich unbedenklich. Dies hat den großen Vorteil, dass die Aufmerksamkeit, statt auf den Bogen, auf das gerichtet werden kann, was in der Begegnung mit Pfeil und Bogen und sich selbst geschieht.
Ein laminierter Bogen kann aufgrund der größeren Belastbarkeit der Glasfasern viel länger im vollen Auszug gehalten werden als ein reiner Holzbogen. Für manche Klient*innen wird dies zu einem wahren Geschenk, denn im vollen Auszug kommen sie nicht nur unmittelbar mit der aufgebauten Spannung in Kontakt, sondern auch mit ihrer eigenen Kraft. Ich werde in einem späteren Kapitel noch ausführlicher darauf eingehen, was dies für sie bedeuten kann.2) All diese Gründe haben mich dazu bewogen, diese Art von Bögen für meine therapeutische Arbeit zu nutzen.
Daneben gibt es auch noch den ästhetischen Aspekt, denn Bögen sollen nicht nur funktional sein, sondern auch optisch und haptisch ansprechen. Ich schreibe hier ganz bewusst nicht „schön sein“, denn der Begriff der Schönheit hat ja meist auch einen sehr individuellen Aspekt. Ansprechend sein bedeutet für mich, dass mich etwas an diesem Bogen anzieht, mich in diesem Moment zu ihm hinzieht. Dies können sowohl ein Gefallen sein als auch Gefühle des Widerstreits oder eines inneren Aufbegehrens.
Oftmals spielen Assoziationen beim Betrachten des Bogens eine Rolle dabei, wie auf ihn reagiert wird. Manchmal sind diese für die Klient*innen nachvollziehbar, manches Mal sind sie jedoch auch überrascht von ihrer eigenen Reaktion. So griff eine Klientin stets nach Bögen mit sehr gleichmäßiger Struktur. Darauf einmal aufmerksam gemacht, antwortete sie spontan, dass jene mit einer ausgeprägten Maserung ihr einfach zu wild und für sie dadurch eher unberechenbarer seien.
Um eine möglichst große Bandbreite der Auswahl und auch der damit verbundenen Gedankenspiele bieten zu können, sind die Bögen, die ich nutze, mit unterschiedlichen Holzauflagen gearbeitet, und dadurch in einer helleren oder dunkleren Grundfarbe. Innerhalb einer bestimmten Holzsorte gibt es dann welche mit stärkerer Maserung oder mit Unregelmäßigkeiten, und solche mit einem sehr ebenmäßiges Aussehen.
Bei der Beschäftigung mit dem Bogenschießen stellt meistens die Zugstärke des Bogens einen zentralen Aspekt dar. Nicht umsonst lautet oft die erste Frage: „Wie stark ist der denn?“ Es kann für die therapeutische Arbeit mit dem Bogenschießen durchaus interessant und wichtig sein, die Klient*innen die Zugstärke der einzelnen Bögen wissen zu lassen. So kann einmal gemeinsam genauer erforscht werden, welchen Einfluss sie bei der Wahl eines Bogens hat, und wie sie sich davon leiten lassen.
Gerade bei Menschen, die gelernt haben, dass sie nur dann angenommen und geliebt werden, wenn sie Leistung erbringen und sich anstrengen, kann das Wissen um die Stärke des Bogens dazu führen, dass sie sich eher einen starken Bogen heraussuchen, den sie sich beweisen müssen oder mit dem sie zu kämpfen haben. Denn für sie ist dies der Ausdruck, sich wirklich angestrengt zu haben und damit die Aussicht auf Anerkennung zu erhalten. Oder sie landen, falls sie den Bogen nicht ziehen können und auf einen leichteren Bogen zurückgreifen müssen, der oft als „schwächerer“ Bogen gewertet wird, unweigerlich in dem Gefühl des Versagt-Habens. Ich selbst erwähne die Pfundzahl3) der einzelnen Bögen meistens nicht.
Zum einen, weil ich gerade den Leistungsorientierten ermöglichen möchte, sich nicht stetig überfordern zu müssen und auch einmal die Leichtigkeit des Seins erfahren zu können. Zum anderen, weil ich es oftmals bedeutsamer finde, wie die Wahl des Bogens ausfällt, wenn dieses Kriterium wegfällt, und von was sich die Klient*innen dann anziehen lassen.
Und es gibt noch einen weiteren wichtigen Gewinn, wenn das Wissen um die Zugstärke weggelassen wird. Gewohnte, oft stereotype Gedanken und Handlungsmuster funktionieren dann nicht mehr, und dies eröffnet meist erst die Möglichkeit für andere, neue und vielleicht auch überraschende Erfahrungen. Gerade in der Arbeit mit Paaren oder Gruppen entsteht so eine – möglicherweise ungewohnt – konkurrenzfreie Situation, denn das sonst so übliche Vergleichen und Messen fällt weg.
Dies kann für einzelne eine große Erleichterung bedeuten, da sie sich nun weder nach innen noch nach außen rechtfertigen müssen, warum sie „nur“ diesen leichten Bogen gewählt haben, oder vielleicht als einzige einen starken.
Andererseits kann es auch Verunsicherung, Verwirrung, Enttäuschung oder gar Ärger hervorrufen, das Zuggewicht nicht zu wissen, weil damit ein Prinzip aufgehoben wird, dem zu folgen wir so sehr gewohnt sind: die Unterteilung in weniger oder mehr, richtig oder falsch, gut oder schlecht.
Wird die Zugstärke also bedeutungslos und damit das Bewerten-Können, wird nicht nur eine Orientierungshilfe weggenommen, sondern auch ein gewohntes Ordnungsmuster in Frage gestellt, wenn auch nicht explizit und geradeheraus. Zumindest bietet es keine Ankerpunkte im Außen mehr, an denen sich festgehalten werden könnte. Es muss mir als Begleitung bewusst sein, dass ich damit möglicherweise auch eine, vorerst wichtige, Sicherheitsleine kappen kann.
Neben der Zugstärke kann auch die Länge eines Bogens Bedeutung erhalten. Üblicherweise werden die Bögen auf die Körpergröße der Schütz*innen abgestimmt und reichen dabei meist von 58 Zoll (dies entspricht einer Körpergröße von 1,20–1,30 m) bis 71 Zoll, was für Personen ab 1,76 m gedacht ist. Ich benutze hauptsächlich 68- und 70-Zoll Bögen, da ich meistens mit Erwachsenen arbeite.
Jedoch habe ich auch kürzere Bögen. Diese kommen oft dann zum Einsatz, wenn sich Klient*innen in bestimmten Gefühls-Zuständen befinden, sich z.B. schwach und verletzlich fühlen, und dann einen Bogen brauchen, der ihnen dazu verhilft, diese Gefühle auch zuzulassen und auszudrücken. Diese kleinen Bögen können auch dann wichtig werden, wenn die Klient*innen mit ihrem „inneren Kind“ in Kontakt kommen. Dieses kann voll ausgelassener Spielfreude, neugierig und abenteuerlustig sein, aber auch trotzig und verstockt, ängstlich und in sich verkrochen. Um damit sein zu können, braucht es neben dem wohlwollenden Da-Sein der Begleitung auch einen kindergemäßen Bogen, der sie ihr Klein-Sein sichtbar machen lässt, es unterstreicht und manchmal auch verstärkt.
Daher macht es Sinn, mehrere verschieden starke und lange Bögen zur Verfügung zu haben. Ich habe mich nach längerem Ausprobieren dazu entschlossen, mir Bögen herstellen zu lassen, die bei 15 lb beginnen und bis 36 lb gehen, da es nach meiner Erfahrung oftmals, und nicht nur zu Beginn, einen leichteren braucht als die im Handel üblichen 20-lb-Bogen.
Der Bogen nimmt in der therapeutischen Arbeit die Rolle eines Gegenübers ein, das gleichermaßen fördert und fordert. Daher sollte er „auf Augenhöhe“ der Klient*innen, und weder zu schwach angesiedelt noch zu überwältigend für sie sein. Er sollte stets für Dialog und Auseinandersetzungen zur Verfügung stehen und diesen nicht ausweichen. Es sollte den Klient*innen möglich sein, einen Bogen zu finden, der ihnen das Siegen nicht allzu leicht macht, der aber in seiner Stärke auch nicht so übermächtig ist, dass ein Scheitern an ihm vorprogrammiert wäre. Einen Bogen, der es ermöglicht, mit ihm zu experimentieren und zu forschen, zu flirten und zu ringen.