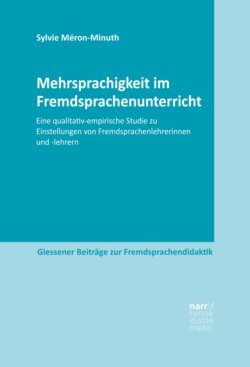Читать книгу Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht - Sylvie Méron-Minuth - Страница 13
2.1 Europäische Sprachen- und Bildungspolitik und Mehrsprachigkeit
ОглавлениеIm Folgenden wird zunächst ein theoretischer Umriss des Begriffs Sprachenpolitik im Allgemeinen und der europäischen Sprachenpolitik im Besonderen entwickelt werden, um dann im weiteren Verlauf die knapp sechzigjährige Geschichte der gemeinsamen europäischen Sprachenpolitik, die zentralen Ziele und konkreten Auswirkungen für den Fremdsprachenunterricht darlegen zu können.
Was versteht man unter Sprachenpolitik? In einem ersten Schritt grenzen einige allgemein gefasste Definitionen den Begriff etwas ein. Bußmann (1990) sieht als Sprachenpolitik
„[…] [p]olitische Maßnahmen, die auf die Einführung, Durchsetzung und Bestimmung der Reichweite von Sprachen zielen. [Dazu zählt auch die] [p]olitische Sprachregelung. [Sie ist ein] Eingriff in den Sprachgebrauch, meist durch staatliche Stellen und mit dem Ziel, bestimmte Bewusstseinsinhalte zu wecken oder zu unterdrücken.“ (Bußmann 1990: 713)
In diesem Sinne ist Sprachenpolitik die Ausübung staatlicher Einflussnahme auf den Sprachengebrauch und die Sprachenverwendung in einem Land oder einer Region. Sprachenpolitik kann zudem als politisch motivierter Eingriff in die sprachliche Situation einer Gesellschaft verwendet werden:
„Sprachenpolitik sieht sich der Problematik gegenüber, mindestens zwei oder mehrere Sprachen in einem Staat in ein Gleichgewicht zu bringen.“ (Haarmann 1988: 1661)
Die Möglichkeit des Missbrauchs der Sprachenpolitik für andere politische Ziele liegt auf der Hand: insbesondere sprachlichen Minderheiten gegenüber (vgl. dazu die „Charta der Regional- und Minderheitensprachen als Gegenentwurf des Europarates“, Europarat 1992). In einer Stellungnahme von 2005 hat die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) auf die vielfach missachteten Minderheitensprachen in Europa hingewiesen:
„In Frankreich haben die Verfassungsgerichte die Ratifizierung der Charta der Regional- und Minderheitensprachen und damit auch die Anerkennung der Vielsprachigkeit des Landes abgelehnt. Eine Umfrage unter 380000 französischen Staatsbürgern ergab, dass statistisch betrachtet 26 Prozent oder 11,5 Millionen Staatsbürger Frankreichs eine andere Sprache als die französische sprechen. Etwa zur Hälfte ist dies eine Minderheitensprache und zur Hälfte die eines anderen Landes. Im Dezember 2002 hat der Staatsrat entschieden, dass Französisch die einzige Unterrichtssprache ist. Diese Entscheidung hat Viele enttäuscht, insbesondere in der Bretagne, wo zahlreiche Modellschulen zweisprachig in bretonisch und französisch unterrichten. Auch andere Gegenden sind betroffen, so erhalten 8679 Schüler eine zweisprachige Erziehung mit Elsässisch, 3509 in Okzitanisch und 766 in Kalatanisch. Diese Entscheidung bedroht diese Sprachen in ihrer Existenz, insbesondere wenn man das Profil der Angehörigen von Minderheitensprachgruppen bedenkt. Mehr als die Hälfte aller, die Bretonisch sprechen, sind älter als 65 und 75 Prozent älter als 50.“ (Gesellschaft für bedrohte Völker 2005: ohne Seitenangabe)
Das Zusammenspiel von Sprachen in einem Land und seiner Gesellschaft (Sprachengemeinschaften) spielt eine wesentliche Rolle bei der Identitätsbildung. Die Sprachenpolitik ist, laut Louis-Jean Calvet (1996) im folgenden Zitat (Übersetzung durch die Verfasserin), die Sprachplanung, die sich in der Bestimmung der bedeutenden Entscheidungen bezüglich der Beziehungen zwischen Sprachen und Gesellschaft und ihrer konkreten Umsetzung manifestiert:
« […] détermination des grands choix en matière de relations entre langues et société […] » [et sa] « mise en pratique. » (Calvet 1996: 3)
Sprachenpolitik reguliert das Miteinander der Sprachen durch Sprachpflege ebenso wie Sprachförderung. Seit den Anfängen des zusammenwachsenden Europas nach dem zweiten Weltkrieg wird eine gemeinsame europaweite Sprachenpolitik politisch gewollt und vorangetrieben. Zwei große Institutionen spielen dabei eine wichtige Rolle, es sind die Europäische Union und vor allem der Europarat, die zwei unabhängige Organisationen der internationalen europäischen Politik sind. Während die Europäische Union erst 1951 mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft ihren Anfang nahm, besteht der Europarat, der durch den Vertrag von London gegründet wurde, bereits seit Mai 1949. Die Europäische Union lenkt heute die Geschicke von 28 Mitgliedstaaten (vgl. EU Länder 2017). Im Vergleich repräsentiert der Europarat 47 Staaten in Europa. Die Europäische Union ist seit ihrer Gründung traditionell stärker auf wirtschaftliche Zusammenarbeit ausgelegt, sie trägt folglich der Mehrsprachigkeit eher formal Rechnung, wohingegen der Europarat schon immer ein Garant für eine starke Sprachen- und Kulturpolitik in Europa war und ist (vgl. hierzu Informationen vom Conseil de l'Europe und der Union Européenne 2007).
Durch den Europarat gegründet befassen sich zahlreiche weitere Unterorganisationen noch detaillierter mit der Ausrichtung der europäischen Sprachenpolitik. Die „Unité des Politiques Linguistiques“ in Straßburg existiert seit 1957 und ist für die Konzeption und Koordination der Sprachpolitik des Europarates federführend.
Bereits in der Gründungsphase des Europarates (1949) und der Europäischen Gemeinschaft wurden die Wichtigkeit der Sprachenfrage erkannt und grundsätzliche Regelungen vertraglich festgehalten. Seit 1957 war der Gedanke der europäischen Mehrsprachigkeit immer wieder ausdrücklicher Bestandteil von Gründungs- und Vertragstexten der Europäischen Gemeinschaft bzw. der Europäischen Union. In diesem Sinne existiert seither auch eine Kommission zur Mehrsprachigkeit (vgl. u.a. Jostes 2006; Europäische Union 2007; Council of Europe 2007).
Dennoch genießt die Sprachenpolitik größere Aufmerksamkeit seitens des Europarates. Im Rahmen des Schutzes der Menschenrechte in Europa spielt ebenfalls der Erhalt und Austausch der europäischen Sprachen und Minderheitensprachen für die älteste europäische Organisation eine wichtige Rolle (vgl. umfangreiche Darstellung der Sprachenpolitik des Europarats in: Jostes 2005 und 2006). In diesem Zusammenhang ist die „Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen“ bedeutsam, wo es in der Präambel aus dem Jahr 1992 heißt, dass die unterzeichnenden Mitgliedsstaaten die jeweiligen Regional- oder Minderheitensprachen schützen werden und begründen dies:
„[…] in der Erwägung, daß es das Ziel des Europarats ist, eine engere Verbindung zwischen seinen Mitgliedern herbeizuführen, um insbesondere die Ideale und Grundsätze, die ihr gemeinsames Erbe bilden, zu wahren und zu fördern;
in der Erwägung, daß der Schutz der geschichtlich gewachsenen Regional- oder Minderheitensprachen Europas, von denen einige allmählich zu verschwinden drohen, zur Erhaltung und Entwicklung der Traditionen und des kulturellen Reichtums Europas beiträgt.“ (Conseil de l’Europe 1992; Hervorhebungen im Text)
Bei der Vielzahl der Entwicklungen in der Geschichte der europäischen Sprachenpolitik sind einige Ereignisse besonders hervorzuheben, die weitreichende Folgen bis in den Fremdsprachenunterricht in der Schule haben. Ein erster Meilenstein ist das „Europäische Kulturabkommen“ des Europarates von 1954, das insbesondere das Studium von Sprachen, Geschichte und Landeskunde der Staaten Europas anregen möchte, wie es folgender Auszug aus der europäischen kulturellen Konvention hervorhebt (vgl. u.a. Europarat 1954: 1; Council of Europe 2007):
Each Contracting Party shall, insofar as may be possible,
a encourage the study by its own nationals of the languages, history and civilisation of the other Contracting Parties and grant facilities to those Parties to promote such studies in its territory, and
b endeavour to promote the study of its language or languages, history and civilisation in the territory of the other Contracting Parties and grant facilities to the nationals of those Parties to pursue such studies in its territory. (Council of Europe 2007: 34; Absatzmarkierungen im Text)
Eine erste praktische Umsetzung bedeutete in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) der Artikel 149 des Gründungsvertrags (1957), der im Bildungswesen durch das Erlernen und die Verbreitung der Sprachen der Mitgliedstaaten in Europa die europäische Einigung institutionell vorantreiben sollte. Ein Jahr später wurden die offiziellen Sprachen der Mitgliedstaaten als gleichberechtigte Amts- und Arbeitssprachen anerkannt. Diese Verordnung gilt als Richtlinie für die weiteren sprachpolitischen Aktivitäten der Gemeinschaft. Ab 1992 ist es jedem europäischen Bürger möglich, den Schriftverkehr mit den europäischen Institutionen in seiner Muttersprache abzuwickeln. Zugleich tritt die „Charta der Regional- und Minderheitensprachen“ in Kraft (vgl. dazu auch Lebsanft & Wingender 2012), die vom Europarat ratifiziert wird und seitdem allgemein als richtungsweisend in Europa erachtet wird.
Seit die Europäische Union gegründet wurde, hat sie immer wieder Fragen zu Sprachen, ihrer Bedeutung und ihrer Förderung thematisiert. Im Vertrag von Maastricht im Jahr 1992 wurden die Entwicklung individueller Mehrsprachigkeit sowie auch das Sprachenlernen – in erster Linie die „großen“ Nationalsprachen der Gemeinschaft – in den Blick genommen. So heißt es in Artikel 126 folgendermaßen:
„Die Gemeinschaft trägt zur Entwicklung einer qualitativ hochstehenden Bildung dadurch bei, daß sie die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten fördert und die Tätigkeit der Mitgliedstaaten unter strikter Beachtung der Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Lehrinhalte und die Gestaltung des Bildungssystems sowie der Vielfalt ihrer Kulturen und Sprachen erforderlichenfalls unterstützt und ergänzt. Die Tätigkeit der Gemeinschaft hat folgende Ziele: Entwicklung der europäischen Dimension im Bildungswesen, insbesondere durch Erlernen und Verbreitung der Sprachen der Mitgliedstaaten.“ (Amtsblatt der europäischen Gemeinschaften 1992: C 191/01)
Im Jahr 1995 verkündet die „Charte Européenne de l’Éducation Plurilingue“ des Conseil Européen des Langues1 als wichtigste Zielsetzung, dass ein Minimum von zwei modernen Fremdsprachen von einer möglichst großen Zahl von europäischen Bürgerinnen und Bürgern erlernt werden soll (vgl. Meißner & Reinfried 1998). In diesem Zusammenhang sei Mehrsprachigkeit innerhalb der Europäischen Union "[…] ein Lernziel von hoher Verbindlichkeit" (Meißner & Reinfried 1998: 11).
Einige Jahre später – im Jahr 2000 – unterzeichnen die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Europarats und der Kommission die „Charta der Grundrechte der Europäischen Union“, die unter anderem die Achtung der Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen in Europa betont und jegliche Diskriminierung einzelner (Minderheiten-)Sprachen verbietet (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 2000, Artikel 21–22). Zwei Jahre später findet ein erster Europäischer Tag der Sprachen statt. Jedes Jahr sollen an diesem Tag aktuelle Fragen zum Thema „Sprache in Europa“ diskutiert werden. Der Ministerrat definierte dann 2002 in Barcelona konsequent das Ziel, dass jeder europäische Bürger seine Muttersprache plus zwei andere Sprachen beherrschen solle, was der Auslöser für eine aktive Förderung (z.B. Sprachprogramme) war (vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2002: 3).
Mit dem europäischen Jahr der Sprachen 2001 setzt sich nach und nach der Begriff der Mehrsprachigkeit durch. Eine im selben Jahr veröffentlichte, wichtige Initiative des Europäischen Rates und richtungsweisende Publikation ist der „Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen“ (GER) (Trim et al. 2001), der für Sprachlehrende und -lernende als umfangreiche Empfehlung zu verstehen ist. Der GER behandelt das Thema des Spracherwerbs, der Sprachanwendung und der Sprachkompetenz von Lernenden. Er stellt überdies den Plurilingualismus ins Zentrum der Reflexion – sowohl als erzieherisches als auch als politisches Projekt – im Dienste und zur Weiterentwicklung der demokratischen verfassten Staaten und ihrer Bevölkerung in Europa (vgl. Europarat 2001: 16).
Im November 2005 legte die europäische Kommission dann eine erste Mitteilung zum Thema Mehrsprachigkeit in Europa unter dem Titel „Eine neue Rahmenstrategie für Mehrsprachigkeit“ (Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2005) vor.
Die beiden großen europäischen Institutionen – der Europarat und die Europäische Union – haben sich in der Sprachenpolitik die Mehrsprachigkeit zum Ziel gesetzt und verschiedene Projekte zu deren pädagogischer Förderung initiiert. Die allgemeinen Zielsetzungen des Europarates bestehen in ihren Grundsätzen seit dem Europäischen Kulturabkommen; Die Europäische Union orientiert sich daran ebenfalls maßgeblich. Der Europarat hat es sich zur Aufgabe gemacht, Völkerverständigung, Demokratie und soziale Zusammengehörigkeit in Europa sowie die sprachliche Vielfalt und das Sprachenlernen im Bereich der Bildung zu fördern.
Das Ziel der Mehrsprachigkeit und einer mehrsprachigen Erziehung – so der Council of Europe 2007 in der englischen Fassung seiner sprachenpolitischen Erklärung – meint nicht das gleichzeitige Unterrichten einer Reihe von Sprachen, das Unterrichten durch den Vergleich verschiedener Sprachen oder noch das Unterrichten so vieler Sprachen wie möglich. Vielmehr geht es hier darum, eine mehrsprachige Kompetenz und eine interkulturelle Bildung zu entwickeln, im Sinne des friedlichen Zusammenlebens und einer sozialen Kohäsion:
“The aim of plurilingualism and plurilingual education is not simultaneously teaching a range of languages, teaching through comparing different languages or teaching as many languages as possible. Rather, the goal is to develop plurilingual competence and intercultural education, as a way of living together.” (Council of Europe 2007: 18)
Denn in einer Epoche der immer größer werdenden Mobilität, der Globalisierung und des Zusammenwachsens Europas haben sich die Anforderungen an die heutige Lernwelt grundlegend verändert (vgl. z.B. Meißner & Reinfried 1998). In einem multilingualen Europa und einer globalisierten Welt erfährt die Kenntnis fremder Sprachen eine zunehmend stärkere Aufmerksamkeit. Die Beherrschung oder zumindest das Verständnis der Sprachen der (europäischen) Nachbarn soll zur Ausbildung einer europäischen Identität und zur Friedenssicherung beitragen (vgl. Ahrens 2004: 14). Dabei werden die rund 220 geschätzten Sprachen in der europäischen Gemeinschaft nicht als Hindernis, sondern als Reichtum, als kulturelles Erbe angesehen, welches es zu schützen gilt (vgl. dazu Wiater 2006: 57 und Europäische Union 2007: 11).
In jedem Fall wird aber die individuelle Mehrsprachigkeit der europäischen Mitglieder von der europäischen Kommission als zu erreichendes Erziehungsziel erklärt, dessen Konkretisierung im Jahr 1995 im Weißbuch festgehalten wurde (vgl. Europäische Kommission 1995: 62). Der Europarat legt jedem europäischen Bürger nahe, das ganze Leben lang Sprachen aktiv zu lernen und zu sprechen und somit beständig die „europäische Idee“ der kulturellen Vielfalt zu leben. Zu diesem Zweck sei es notwendig, dass den Sprechern Mittel und Werkzeuge zur Einschätzung des eigenen Sprachvermögens und der kommunikativen Kompetenzen an die Hand zu geben; wichtige Errungenschaften des Europarats sind das europäische Sprachenportfolio oder noch der „Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen“.
Resümierend ist festzuhalten, dass die Sprachenpolitik des Europarats folgende Zielsetzungen für jeden einzelnen europäischen Bürger vorantreiben will:
LE PLURILINGUISME: tous les citoyens européens ont le droit d’acquérir un niveau de compétence communicative dans plusieurs langues, et ce, tout au long de leur vie, en fonction de leurs besoins
LA DIVERSITE LINGUISTIQUE: L’Europe est un continent multilingue et toutes ses langues ont la même valeur en tant que moyens de communication et d’expression d’une identité. Les Conventions du Conseil de l’Europe garantissent le droit d’utiliser et d’apprendre des langues
LA COMPREHENSION MUTUELLE: La communication interculturelle et l’acceptation des différences culturelles reposent fortement sur la possibilité d’apprendre d’autres langues
LA CITOYENNETE DEMOCRATIQUE: la participation aux processus démocratique et social dans des sociétés multilingues est facilitée par la compétence plurilingue de chaque citoyen
LA COHESION SOCIALE: l’égalité des chances en matière de développement personnel, d’éducation, d’emploi, de mobilité, d’accès à l’information et d’enrichissement culturel dépend de la possibilité d’apprendre des langues tout au long de la vie. (Conseil de l’Europe 2014: ohne Seitenangaben; Hervorhebungen im Text)
Die Sprachenpolitik in Europa fußt noch immer auf der ursprünglichen Grundüberzeugung des Europarats, der es sich seit seinem Bestehen zur Aufgabe gesetzt hat, den Erwerb eines hohen kommunikativen Kompetenzniveaus aller europäischen Bürgerinnen und Bürger voranzutreiben. Diese Initiative basiert zudem auf der verstärkten Mobilität und Zusammenarbeit auf europäischer und internationaler Ebene. Die Grundidee hat dabei bis heute ihre Aktualität in Zeiten der Globalisierung nicht verloren. Um am politischen, sozialen und wirtschaftlichen Leben teilzunehmen, sei das Beherrschen mehrerer Sprachen besonders im vielsprachigen Europa fast unvermeidbar geworden. Die Vielfalt der Sprachen wird als etwas Positives und Schützenswertes betrachtet. Für den Europarat ist Mehrsprachigkeit Garant für eine starke Demokratie und gesellschaftliche Einheit. Zudem ist Mehrsprachigkeit auch Voraussetzung für den interkulturellen Austausch im 21. Jahrhundert, der nicht zuletzt helfen soll, alte Grenzen, dank einer Sprachenvielfalt, zu überwinden (vgl. dazu Conseil de l’Europe 2014). Deshalb wird angestrebt, die europäischen Bürgerinnen und Bürger lebenslang, je nach Kommunikations- und Interaktionsbedarf, zum Zwecke einer größeren Mobilität und eines besseren gegenseitigen Verstehens und Zusammenarbeitens die notwendigen Voraussetzungen zur Kommunikation in jeder anderen Gemeinschaftssprache im Sinne einer funktionalen Mehrsprachigkeit entwickeln können, die sich in dem Aufbau folgender Kompetenzen niederschlägt:
1 Die europäischen Bürgerinnen und Bürger sollen zum Ersten kommunikative, darunter linguistische Kompetenzen2 für den persönlichen, publiken, schulischen und ebenfalls den professionellen Bereich erwerben; zum Zweck der Kommunikation sollen sie darüber hinaus pragmatische Kompetenzen erlangen, die eine angemessene Kenntnis und Bewältigung der sozialen Dimensionen des (verständlichen) Sprachgebrauchs umfasst;
2 Zum anderen sollen sie allgemeine Kompetenzen wie allgemeines Weltwissen und soziokulturelles Wissen, Fertigkeiten zur Vermittlung zwischen verschiedenen Kulturen, Lernfähigkeiten und Persönlichkeitskompetenz besitzen. (vgl. dazu Wiater 2006: 57)
Sowohl im sozialen als auch im bildungspolitischen Diskurs wird deutlich hervorgehoben, dass eine migrationsbedingte Mehrsprachigkeit eine wertvolle Ressource für das schulische Lernen, für Sprachbewusstheit, für die persönliche Entwicklung und interkulturelles Lernen darstelle und in diesem Sinn zu begreifen sei (vgl. z.B. Fürstenau 2011: 25).
Jedoch entsprechen die Migrantensprachen meistens nicht dem offiziellen, schulischen Sprachenkanon, werden gesellschaftlich nicht besonders wertgeschätzt und folglich in der Schule auch nicht eingebunden (vgl. Fürstenau et al. 2017: 49). Und Adelheid Hu (2010) konstatiert:
„Während für die Schüler/innen Mehrsprachigkeit und sprachlich-kulturelle Identität zentrale Kategorien darstellten, spielten diese für die Fremdsprachenlehrer/innen kaum eine Rolle.“ (Hu 2010: 67)
Brigitte Jostes weist zu Recht kritisch darauf hin, dass die sprachenpolitischen Vorgaben der verschiedenen europäischen Institutionen, die sie mit dem Globalziel „effektive Kommunikation“ (Jostes 2005: 28) bezeichnet, bei der entscheidenden Frage nach den Kriterien im Repertoire der sprachlichen Fähigkeiten unentschieden bleiben und die Globalziele auf personale Kompetenzen abzielen, bzw. den kommunikativen Verwertungsaspekt zu sehr in den Mittelpunkt stellen.
„Mit „effektiver Kommunikation“ als einzigem Ziel jeglichen Sprachenlernens – und so hat es den Anschein, Begründung des menschlichen Sprachbesitzes schlechthin – kommt erstens bei dieser „Komplementarität, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung aller Sprachen“ eine „affektive, identifikatorische, sozialisierende und enkulturierende Rolle einer oder mehrerer Muttersprachen“ überhaupt nicht in den Blick. Aus dem Blick gerät zweitens der andere Sprachgebrauch, der nicht auf „effektive Kommunikation“ abzielt und den Humboldt als den „rednerischen“ bezeichnet. Erst dieser Sprachgebrauch, in dem die Sprache „als Sprache“ erscheint, liefert doch dem Leitbild der Mehrsprachigkeit seinen zugrundeliegenden Begründungszusammenhang.“ (Jostes 2005: 28f.; Hervorhebungen im Text)
Diese Kritik verweist auf die Bemerkungen von Jürgen Trabant, der anmahnt:
„Ich meine damit, […] daß man fremde Sprachen nicht nur zum effektiven Kommunizieren lernt – das machen wir ja schon mit dem Englischen –, sondern daß man sich eine andere europäische Sprache wirklich als einen Kulturgegenstand zu eigen macht, daß man eine fremde Sprache als einen Bildungsgegenstand erwirbt.“ (Trabant 2005: 103)
Trabant ist weiterhin als kritische Stimme zu lesen, wenn er 2001 am Beispiel der Wissenschaftssprachen und der Wissensgesellschaft das Funktionieren und die Umsetzbarkeit der genannten europäischen Ziele vor dem Hintergrund ökonomischer Zwänge in Zweifel zog und erklärte:
„Daher sollten gerade wir Geistes- oder Kulturwissenschaftler bei der Redeweise von der Wissensgesellschaft genau hinhören. Wir können ja nicht umhin zu bemerken, wie unser Wissen, das Wissen von nahen und fernen Kulturen, Kunstwerken, Texten, vergangenen Zeiten und von Sprachen, zunehmend und rasant gesellschaftlich entwertet wird. Die Funktion des von uns produzierten Wissens ist ins Gerede gekommen. Sie wird deswegen diskutiert, weil die schönen Zeiten vorbei sind, in denen die Produktion des Wissens überhaupt – egal wovon – als kostbar angesehen wurde und von der Gesellschaft auch bezahlt wurde. Nun aber drängen die ökonomischen Zwänge – es sind eher vermeintliche Zwänge, shareholder-Zwänge eben – uns die Diskussion um die Legitimation unseres Wissens auf. Wir müssen uns vor dem Tribunal der zukünftigen Wissensgesellschaft verantworten: Nicht jedes Wissen ist da mehr willkommen und folglich finanzierbar, sondern offensichtlich nur noch solches, das der unmittelbaren Reproduktion des geld-generierenden Wissens dient. Warum sollte da z.B. – um ein Beispiel fernerliegenden Sprachwissens zu geben – einer Lateinisch oder Nahuatl studieren? Wie schnell sind dann auch das Erlernen des Französischen und das Studium der französischen Literatur und Sprache kaum mehr zu rechtfertigen.“ (Trabant 2001: 59)
Mit diesem kurzen historischen Abriss lässt sich bereits zeigen, dass eine Erziehung zur Mehrsprachigkeit in Europa – politisch und sprachenpolitisch gesehen – am Ende des 20. Jahrhunderts an zentraler Bedeutung gewonnen hat und politisch gewollt ist, dass aber die Umsetzung dieser politischen Vorgaben keineswegs einfach zu realisieren ist und mit gesellschaftlichen Widerständen zu kämpfen hat.