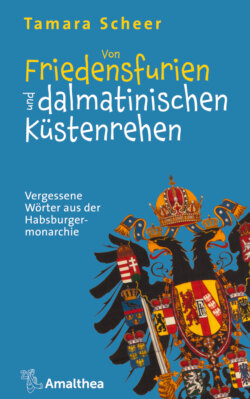Читать книгу Von Friedensfurien und dalmatinischen Küstenrehen - Tamara Scheer - Страница 10
Armeeslawisch
ОглавлениеDer ständige Sprachkontakt im Habsburgerreich aber veränderte nicht nur das Deutsche, sondern beeinflusste auch die slawischen Sprachen. Um die Jahrhundertwende bemerkte ein hochrangiger Beamter im k. u. k. Reichskriegsministerium, es wäre ein Irrglaube, dass jemand, der eine slawische Sprache beherrsche, auch automatisch alle anderen können würde. Gleichzeitig fanden hitzige Debatten im österreichischen Parlament in Wien über das sogenannte Armeeslawisch statt.
Wie so oft in der Habsburgermonarchie bestand der Ausgangspunkt der Kritik darin, dass es sich bei der Sprache um das höchste Gut einer Nation handelte. Für die Reinheit der Sprache galt es daher einzutreten und jede Vermischung und Verhunzung zu bekämpfen. Der böhmische Abgeordnete Josef Kadlčák machte das Armeeslawische zum Mittelpunkt seiner Rede, die er 1908 im Wiener Parlament hielt: »Es geht ja nicht anders, wie wollen Sie denn mit einem Böhmen, Polen oder Slowenen exerzieren, wenn er Sie nicht versteht, das geht nicht anders als in der Muttersprache, dann haben wir den berechtigten Wunsch und das Verlangen, daß sie wirklich eine Sprache ist, und nicht ein Gallimathias [Unsinn], das in der bisherigen Form für den Mann und den Offizier erniedrigend ist. Es muß endlich einmal gebrochen werden, mit dem ›strosaky na gangu pucovat, klenkübunky a kvergryvy‹ und mit solchen Sachen, die weder vom nationalen noch von irgend einem anderen Standpunkt aus geduldet werden dürfen. Wir verlangen, daß das, was Regimentssprache genannt wird, wirklich eine Sprache ist, daß, wenn die böhmische Sprache bei einem Regiment ist, das wirklich eine böhmische Sprache und nicht ein Kauderwelsch ist, nicht – ich möchte sagen – eine chinesische Sprache, die weder ein Böhme noch ein Deutscher noch irgendwer anderer versteht. (Zwischenruf: Eine österreichische Sprache) Man könnte es leider eine österreichische Regimentssprache nennen: die wahre Volkssprache.«
Unzählige Wörterbücher wurden gedruckt, um die Kommunikation zwischen den sprachlich so vielfältigen Staatsbürgern zu erleichtern.
Offenbar war das Armeeslawische tatsächlich weit verbreitet. Es findet sich wiederkehrend in Tagebüchern, Memoiren und Zeitungen. Der Offizier Alexander Lernet-Holenia beschrieb in seinem Roman Die Standarte eine Szene, bei der eine Wache vor dem Konak, dem ehemals osmanischen Gouverneurssitz in Sarajevo, mit einem Passanten sprach: »Er sagte wiederum etwas, der eine der Posten antwortete ihm, ich glaubte zu hören, daß die Auseinandersetzung im sogenannten Armeeslawisch geführt wurde, sie dauerte zwei oder drei Minuten.« In seinem Kriegsroman Das Salz der Erde lässt Joseph Wittlin seinen Protagonisten, einen einfachen Soldaten aus Galizien, folgenden Ausspruch tun: »Besonders seit Kriegsausbruch erschollen im Sniatyner Bezirk nicht wenige fremde Sprachen. Die Ohren der Huzulen begannen sich allmählich an das grausige Schnarren der rauhen deutschen Sprache zu gewöhnen und an das sogenannte Armeeslawisch, wie man ein Ragout aus sämtlichen slawischen Sprachen nannte.« Die Huzulen lebten in Galizien und der Bukowina und besaßen keinen eigenen Nationalitätenstatus. Aufgrund der Sprachähnlichkeit wurden sie zumeist den Ruthenen zugerechnet, seltener auch den Polen. Der Offizier Eduard Lakom hingegen bot – wie der böhmische Abgeordnete zuvor – gleich eine Kostprobe dieser »Sprache« an: »Ich schreie zurück: ›Ništa dodji – ovdje Vergatterung‹ (nichts kommt – hier Vergatterung).«
Doch was war es nun exakt, worüber sich der Abgeordnete so aufregte und was andere Zeitgenossen ständig erwähnten? Wie kam das Armeeslawische zustande? Wie schon beim Armeedeutsch und Marinedeutsch lag der Grund für die Ausprägung im Kultur- und Sprachkontakt der Bevölkerung. In diesem Fall aber wurde die Sprache noch zusätzlich durch eine Verordnung des k. u. k. Reichskriegsministeriums begründet. Die hohe Anzahl jener, die diese Verordnung betraf, förderte die Verbreitung. Soldaten, die aufgrund der allgemeinen Wehrpflicht in der Armee dienen mussten, zunächst für drei, später für zwei Jahre, hatten das verfassungsmäßig verbriefte Recht, in ihrer Muttersprache ausgebildet zu werden. Aus diesem Grund musste die Armee dafür sorgen, immer ausreichend Offiziere und Unteroffiziere bereitzustellen, die die Sprache der Soldaten beherrschten. Die Offiziere waren angehalten, bei sonstiger Nichtbeförderung, innerhalb einer Frist von drei Jahren jene Sprachen zu erlernen.
Eigentlich, sollte man meinen, könne dies keine allzu großen Schwierigkeiten bedeutet haben. Da aber gerade das Stammpersonal regelmäßig zumeist nach drei bis vier Jahren in einen anderen Garnisonsort versetzt wurde, und zwar meistens so weit weg, dass die Soldaten eine andere Sprache verwendeten, waren sie häufig gezwungen, wieder eine neue Sprache zu erlernen. Keine einfache Sache. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es keine organisierten Sprachkurse gab, wie wenig Zeit zur Verfügung stand, bevor es in die neue Garnison ging, und dass erwartet wurde, vom ersten Tag an die Soldaten auszubilden. Mit der Zeit waren aber einige speziell auf die Bedürfnisse der Soldatenausbildung ausgelegte Wörterbücher verfügbar. Wie die Bilder ahnen lassen, gab es darin so gut wie keine Grammatik, aber umso mehr Standardsätze für alle möglichen Alltagssituationen. Dennoch, meist war nicht ausreichend Zeit. Ludwig Hesshaimer erinnerte sich in seinen Miniaturen aus der Monarchie an die erste Garnison als junger Offizier. Sein Vorgesetzter war ein Kroate und sagte zu ihm bei der Begrüßung: »›Gehen Sie hinüber und halten Sie Mannschaftsschule.‹ Ich verstand nicht ganz. Erstens war ich parademäßig angezogen und zweitens, und wichtiger: Ich hatte doch erst die Regimentssprache zu erlernen, ein Gemisch aus Serbisch und Ungarisch, die Mannschaften waren Bunjevacen aus dem Banat. ›Herr Hauptmann, ich kann noch nicht‹ … ›Habe ich Sie gefragt?‹ Ein langer, knochiger Finger deutete Richtung Mannschaftszimmer. ›Abtreten‹.«
Natürlich lernten Offiziere wie Hesshaimer rasch einige Alltagsphrasen, aber exakt zu jenem Zeitpunkt, wo sie sich so halbwegs ohne Hilfe verständigen konnten, wurden sie meistens in eine andere Garnison versetzt. Bei vielen Offizieren finden sich in den Personalakten bei der Angabe ihrer Sprachkenntnisse im Verlauf der Jahrzehnte verwirrende Angaben. In dem einen Jahr wird dem Betreffenden bescheinigt, »Deutsch und etwas Slowenisch« zu können. Als er dann nach Prag versetzt wird, kann er plötzlich »Deutsch und etwas Tschechisch«. Als er schließlich in Galizien landet, kann er auf einmal nichts mehr von den beiden vorherigen Sprachen, dafür ein wenig Ruthenisch (aber nicht schreiben) und etwas Polnisch. Es darf angenommen werden, dass diese Person nur eine slawische »Sprache« wirklich beherrschte: Armeeslawisch. Hesshaimer konnte sich nämlich in einem Ragout aus mehreren slawischen Sprachen so halbwegs verständlich machen.
Viele Offiziere erwähnten aber immerhin in ihren Tagebüchern, dass dieses Ragout von einigen Vorgesetzten nicht geduldet wurde, wie Robert Nowak in seinen Fronterlebnissen schildert: »Da die Vorschrift bestimmte, es müsse jedem Soldaten möglich sein, in seiner Muttersprache mit den Vorgesetzten bis zum Kompaniekommandanten zu verkehren, mußten die Offiziere sie erlernen. […] Die ohne Sprachtalent halfen sich mit dem ›Armee-Slawisch‹ einem Kauderwelsch […] was manche Vorgesetzte nicht duldeten.«
Doch war es wirklich, wie der böhmische Abgeordnete anklingen lässt, ausschließlich Missständen der Armeeführung und der Faulheit oder Ignoranz der Offiziere geschuldet? Machen Sie doch einfach den Selbsttest – sofern Sie eine Voraussetzung mitbringen: die Kenntnis einer slawischen Sprache. Fahren Sie einmal für einen längeren Zeitraum in ein anderes slawisches Land als in eines, dessen Sprache Sie gelernt haben. Es wird Ihnen sicherlich – wie es auch mir häufig ergangen ist mit meinem Kroatisch – Folgendes rasch auffallen: Sie kommen in dieses Land und verstehen so in etwa, was gesprochen wird, können die Inhalte von Texten verstehen, und wenn Sie langsam und deutlich in kurzen Sätzen antworten, werden Sie verstanden. Mit der Zeit übernehmen Sie einzelne Ausdrücke, Satzstellungen und Aussprache. Sie denken sich, dass Sie nun mittlerweile die andere Sprache schon auch irgendwie beherrschen. Bis Sie in jenes Land reisen, dessen Sprache Sie eigentlich gelernt haben. Rasch werden Sie bemerken, dass Sie diese Sprache nun falscher beherrschen als zuvor und sich nicht mehr sicher sind, was nun zur einen oder zur anderen Sprache gehört. Voilà! Sie beherrschen nunmehr nur eines perfekt: das habsburgische Armeeslawisch. Bloß schade, dass diese Sprache niemals offiziell anerkannt wurde.