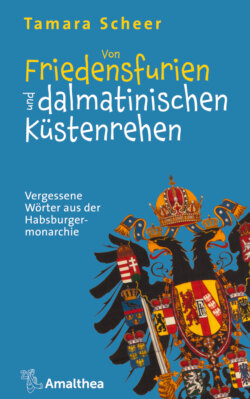Читать книгу Von Friedensfurien und dalmatinischen Küstenrehen - Tamara Scheer - Страница 7
Amnestiekarl
ОглавлениеDer letzte Militärkommandant des von Österreich-Ungarn im Jahr 1908 annektierten Bosnien-Herzegowinas schrieb den ganzen Ersten Weltkrieg hindurch Tagebuch. Es wird heute im Kroatischen Staatsarchiv in Zagreb aufbewahrt. Stefan oder eigentlich besser Stjepan Sarkotić bezeichnete sich selbst als kaisertreuen Kroaten. Im vierten und letzten Kriegsjahr, am 3. Juli 1918, kommentierte er einen Erlass basierend auf dem Wunsch des neuen Kaisers und Königs Karl: »Bin sehr betroffen. Brächte er uns dem Frieden näher, dann à la bonheur, aber ich befürchte, daß dies nicht der Fall sein wird und wir nur im Inneren noch mehr Feinde haben werden als früher.«
Es war keine leichte Aufgabe, mitten in einem Weltkrieg den Thron zu übernehmen. Der noch keine 30 Jahre alte Erzherzog Karl wurde nach dem Tode Franz Josephs im Herbst 1916 Kaiser und König eines Reiches, das bereits zwei Jahre lang einen Krieg mit abertausenden Toten geführt hatte. Der Alltag der Bevölkerung war gekennzeichnet von steigenden Nahrungsengpässen, Unruhen und unzähligen Verhaftungen aufgrund von Spionagevorwürfen. Karl versuchte die harte Kriegspolitik seines Vorgängers zu ändern, und dies so rasch wie möglich. Der neue Wind machte sich nicht nur an den kämpfenden Fronten, sondern auch an der Heimatfront bemerkbar. Karl befahl die Lockerung der Zensur und das österreichische Parlament durfte wieder tagen. Die Fälle von tausenden politisch Inhaftierten seit Kriegsbeginn wurden neu aufgerollt und etliche Betroffene aufgrund mangelnden persönlichen Fehlverhaltens freigelassen.
Obwohl sich dieser neue Kurs für viele unschuldig Inhaftierte positiv auswirkte, war das Gegenteil der Fall für jene, die für den alten Kurs verantwortlich gezeichnet hatten. In jenen Personenkreis fielen neben den Beamten auch die Offiziere der Armee, wie der oben zitierte Stjepan Sarkotić, der letztlich den harten Kurs lange Zeit in Bosnien-Herzegowina durchgesetzt hatte. In diesem Landesteil war es vor allem die serbische/orthodoxe Bevölkerung gewesen, die unter Verhaftungen und Todesurteilen zu leiden hatte. Sarkotić erwähnt den Beinamen, den der junge Monarch aufgrund seines Amnestieerlasses erhielt, nicht, obwohl er damals rasch gängig wurde. Ganz anders sein im von den Truppen Österreich-Ungarns besetzten Belgrad tätiger Offizierskamerad Imre Suhay.
Während des Krieges kam es zu tausenden Verhaftungen angeblicher Spione und Landesverräter.
Am 15. Juli 1918 – im letzten Jahr des Ersten Weltkrieges – notierte der aus Ungarn gebürtige Offizier Suhay in sein Tagebuch, welches heute im Budapester Militärarchiv verwahrt wird: »Auch in Kragujevac soll es wieder gähren, es sind revolutionäre Agenten hopp genommen worden […]. Lustige Aussichten, dann kommt der gnädige und warmherzige ›Amnestiekarl‹ spricht einerseits alle Gauner frei und zittert anderseits um seinen Thron und jammert wegen Disciplin et. Cetera.« Aus Karls Sicht wurden hunderte Unschuldige freigelassen, nach Suhays Einschätzung aber wurden potenzielle Feinde Österreich-Ungarns massenhaft enthaftet, die künftig eine Gefahr für die Sicherheit der eigenen Truppen darstellen würden. Deshalb auch die abschätzig und keineswegs positiv gemeinte Bezeichnung des neuen Kaisers und Königs und seines Regierungskurses: »Amnestiekarl«.
Imre Suhay diente zum Zeitpunkt seines Tagebucheintrages bereits zwei Jahre im von Österreich-Ungarn besetzten Serbien. Die Okkupation jenes Landes, dem in Österreich-Ungarn die Schuld für den Ausbruch des Ersten Weltkrieges gegeben und dessen Bevölkerung daher pauschal von der k. u. k. Verwaltung als feindlich gesinnt betrachtet wurde, war keine einfache Aufgabe. Die Besetzung Serbiens war geprägt von Aufständen gegen beziehungsweise von guerillaartigen Übergriffen auf die Besatzer. Diese führten zu massenhaften Verhaftungen und Geiselnahmen. Karls Kurs brachte nicht nur für die eigenen inhaftierten Staatsbürger Freilassungen, sondern es wurde befohlen, auch jeden einzelnen Fall aufseiten des inhaftierten Feindes neu zu untersuchen. Tatsächlich ergaben die Untersuchungen, dass viele Serben sich persönlich nichts hatten zuschulden kommen lassen. Mehr noch, ein Karton der Akten der österreichisch-ungarischen Besatzungsverwaltung in Serbien, welcher sich im Budapester Militärarchiv befindet, zeigt das Ausmaß der Lage drastisch. Dort aufbewahrt sind Formulare fürjeden einzelnen Inhaftierten, darin enthalten sein Name, sein Wohnort, sein Alter, Beruf, aber auch der Grund für die Inhaftierung. Der Großteil davon ist mit dem lapidaren Vermerk versehen: »aufgrund allgemeiner Inhaftierung«. Karls Amnestieerlass ergab, dass die vor Ort tätigen Beamten jeden einzelnen Fall neu untersuchen und die Ergebnisse in diese Formulare eintragen mussten. Hier zeigt sich deutlich, dass gegen viele Verdächtige keinerlei Beweise vorlagen.