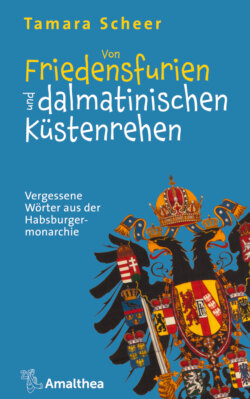Читать книгу Von Friedensfurien und dalmatinischen Küstenrehen - Tamara Scheer - Страница 9
Armeedeutsch
ОглавлениеWohl kaum ein Theaterstück schildert die letzten Tage der Donaumonarchie, ihr Auseinanderbrechen und die Schwierigkeiten der Träger des Systems, sich nun einem der Nachfolgestaaten zuzuordnen und sich damit für eine Nation zu entscheiden, so drastisch wie Franz Theodor Csokors 3. November 1918. Csokor, geboren 1885 in Wien, stellt in der Rollenaufteilung seines Stückes ganz zu Beginn nicht nur die Charaktere vor, sondern legt auch die zu verwendende »Sprache« fest, welcher sich die Schauspieler bei einer Aufführung zu bedienen haben: Armeedeutsch. Hätten die Schauspieler Hochdeutsch gesprochen, wäre dem damaligen Publikum die ganze Szenerie nämlich unnatürlich vorgekommen. Dies mag wohl mit ein Grund sein, warum dieses Stück bei Inszenierungen in anderen Sprachen ganz automatisch an Aussagekraft verlieren muss: Es wirkt einfach nicht mehr authentisch.
Doch was ist nun jenes Armeedeutsch, welches in der Zeit der Habsburgermonarchie ständig Verwendung fand? Tatsächlich ist der Gebrauch des Wortes, liest man zeitgenössische Zeitungen, durchaus verwirrend. Es ist schwierig herauszufinden, worum es sich tatsächlich handelte. Denn ein Wörterbuch für Armeedeutsch oder auch nur einen Eintrag in einem Lexikon gab es nie. Armeedeutsch war nämlich im Grunde keine Sprache, obwohl es von vielen Tausenden überall im Habsburgerreich so bezeichnet und verwendet wurde. Der Offizier Theodor von Lerch beschreibt sie in seinen Memoiren folgendermaßen: »Die Offiziere hatten eine bessere Sprache, das sogenannte Armeedeutsch. Bestimmte Ausdrücke, Redewendungen und Tonfall. Typisch für den Offizier. Man konnte ihn auch an dieser Sprache, auch wenn er Zivil trug, erkennen.«
Obwohl Lerch suggeriert, dass Armeedeutsch nur beim Militär zu finden war, beschränkten sich die Sprecher nicht auf diese Institution. Auch viele Familienangehörige bedienten sich seiner, ebenso wie jene, die im Laufe ihres Lebens in unterschiedlichen Teilen der Habsburgermonarchie lebten und, sei es durch Heirat oder Beruf, von einer Sprachregion in eine andere wechselten und sich auch irgendwann des Deutschen bedienen mussten.
Deutschnationale hatten mit dieser »Sprache« ihre liebe Not. Sie passte so gar nicht in ihr Bild der Reinheit der Sprache als dem höchsten Kulturgut einer Nation. Sie mokierten sich über die Benutzung jedes Fremdwortes und über jede andere als die angeblich korrekte deutsche Aussprache und Grammatik. Darunter fielen auch damals bereits viele englische Begriffe, wie lunchen für mittagessen, aber auch französische Begriffe, wie Trottoir für Gehsteig. Mehr noch störten sie Begriffe, die aus der Völkerbegegnung innerhalb der Donaumonarchie entstanden. Besonders verbreitet war das Armeedeutsch unter den Offizieren. Nicht nur, weil die meisten von ihnen Deutsch nicht als Muttersprache hatten. Zusätzlich wechselten sie alle paar Jahre ihren Dienstort und damit die sprachliche Umgebung. Vielerlei lokale anderssprachige Ausdrücke und Redewendungen fanden daher Eingang in ihren täglichen Sprachgebrauch. Für den künftigen ordentlichen Deutschunterricht forderten deshalb nationalistisch angehauchte Kritiker wie Georg Auffahrt in seinem Mahnwort zur Erhaltung soldatischer Ideale: »Wenn nun aber die Deutschen trotz ihrer außerordentlichen räumlichen Ausdehnung und Zersplitterung in Mundarten keine zentrale Sprachläuterungsanstalt wie z. B. Franzosen und Italiener besitzen, so sollten doch die Sprachlehrer vorher in jene Gegenden kommandiert werden, wo man reine deutsche Laute sprechen hört, und dieselben dann unwillkürlich selbst annimmt. Sprachlehrer sollen in Jena, Hannover, Göttingen einen längeren Aufenthalt nehmen. […] Bei Zöglingen sollte das Hauptaugenmerk auf tadelloser Aussprache liegen.«
Der Schriftsteller Friedrich Torberg, 1908 in Wien geboren und damit beim Ende der Donaumonarchie erst zehn Jahre alt, fand im Rückblick einen ironischen Zugang: »Welch ein irreführender Ausdruck der Alltagssprache unserer Vorfahren! Die deutsche Sprache ist ja viel zu arm, um den Bedarf an Ausdruck zu decken, den die k.u.k. Armee hatte. Und die elf Sprachen, in denen das Reglement gedruckt war, reicherte es an. Es ist sich anher zu melden […] hieß es auf Deutsch mit slawischem Einfluß. Gattje hieß offiziell die Unterhose, aus dem Polnischen kate stammend, Cvilinky hieß auch bei den Tiroler Kaiserjägern die Zwilchgarnitur, Bistuntaly die Bestandteile des Gewehres und Zupak – das war der altgediente Unteroffizier.«
Der kleine Bruder des Armeedeutschs war das sogenannte Marinedeutsch. Kleiner Bruder deshalb, weil zahlenmäßig weitaus weniger Personen direkt betroffen waren. Dennoch ist es hier zumindest einer Erwähnung wert. Verglichen mit den großen Seemächten wie Deutschland und Großbritannien nahm sich die österreichisch-ungarische Variante eher bescheiden aus. Dennoch, die k. u. k. Marine-Stützpunkte reichten von Pola (heute Pula in Kroatien) im Norden nach Cattaro (heute Kotor in Montenegro) im Süden. Der k. u. k. Marineoberkommissär außer Dienst Dr. Oswald Straub erklärte diese Sprache in seiner Darstellung In Memoriam. Erlebtes und Erlauschtes aus dem alten Pola (erschienen in Wien in einem Jahr, als es die k. u. k. Marine seit guten 15 Jahren nicht mehr gab) so: »Daß die vielgestaltigen sprachlichen Verhältnisse auch ihren Einfluß auf unser Marinedeutsch ausübten, ist begreiflich. Kein Wunder, daß insbesonders die am meisten verwendete italienische Sprache sich in Lehn- und Fremdwörtern einen gewissen Platz in unserer Sprache erworben hatte […] Die Krone der sprachschaffenden Betätigung der Marineure war aber das ›Marinedeutsch‹. Seinen Namen verdankt es dem Umstande, daß es in der Seeminenschule […] geboren wurde. […] Der Aufbau der Sprache war der denkbar einfachste. Keine Regeln, kein Vokabellernen, kein Conjugieren u. dgl. Man schaltete einfach zwischen jeder Silbe der deutschen Wörter eine neue Silbe ein, ich glaube ro oder ri oder ähnliches, und die Sprache war fertig. Böswillige Nörgler behaupteten freilich, das sei gar keine Sprache, sondern ein Blödeln, aber das war wohl nur Neid.«
Wie bei den Landstreitkräften auch, war in der Marine die offizielle Dienstsprache das Deutsche. Da aber der Großteil jener, die es täglich benutzen mussten, keine Muttersprachler waren, schien es nur logisch, dass sie dieses Deutsch durch Begriffe ihrer eigenen Sprache anreicherten. Umgekehrt passierte das auch den Muttersprachlern, die eben von den anderssprachigen Soldaten oder Seemännern Ausdrücke übernahmen. In der Marine war es noch bunter gemischt als in der Armee, da Fachleute von überall aus der Monarchie rekrutiert wurden. Irgendwann waren es so viele Kroaten und Italiener, dass vorgeschlagen wurde, deren Sprache anstelle des Deutschen als Dienst- und Umgangssprache zu verwenden. Ein Vorschlag, der auf Ablehnung stieß.