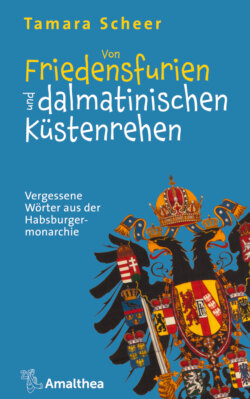Читать книгу Von Friedensfurien und dalmatinischen Küstenrehen - Tamara Scheer - Страница 8
Ärarische Weiber
ОглавлениеWer zarter besaitet war«, so hieß es in einem 1899 in den Wiener Caricaturen abgedruckten Gedicht, nannte jene Personengruppe »Ärarische Damen«. Diese »Damen«, zumeist aber als Weiber bezeichnet, waren omnipräsent in der Habsburgermonarchie. Sobald ihre Gatten nämlich, zumeist Offiziere und Staatsbeamte, irgendwo auftauchten, waren sie nicht weit. Der Begriff »ärarisch« bedeutete eigentlich im staatlichen Eigentum stehend. Unter Ärarischen Weibern verstanden Zeitgenossen nicht nur die Gattinnen der Staatsangestellten und Armeeoffiziere, sondern auch deren im Familienverband lebende unverheiratete Schwestern, Tanten und Töchter. Diese legten nach vielen Zeitgenossen ein bestimmtes Verhalten an den Tag, wie der k. u. k. Offizier Imre Suhay in seinem Tagebuch beschreibt: »Die Bauabteilung muß jetzt vor allem die Villen für die Offiziersfrauen herrichten. Drei Villen für Rhemen, die Habgier der ärarischen Weiber ist grenzenlos. […] Frau Kerchnawe hat in einer Art und Weise sich über Ocskay ausgelassen und geschimpft, daß es nicht mehr schön war. […] So etwas sollte doch nicht sein […] und das ärarische Weib in einer solchen Form herauskehrt.« Der Begriff war somit in den meisten Fällen eher weniger freundlich gemeint, unabhängig davon, ob der Schreiber sie als Damen oder Weiber bezeichnete.
Ärarische Weiber taten sich angeblich stets über Gebühr am Staatsvermögen gütlich und wussten den Rang und Stand ihres Gatten weidlich zu eigenen Gunsten – oder besser zugunsten ihres Familienbudgets – auszunutzen. Gleichzeitig muss bemerkt werden, dass das Einkommen der Beamten und Offiziere der Habsburgermonarchie ganz im Gegensatz zu ihrer hohen Stellung in der Gesellschaft stand. Viele klagten über zu geringe Einkünfte, um das Prestige, welches ihnen eine gewisse Repräsentation in der Öffentlichkeit auferlegte, auch in der persönlichen Lebenshaltung aufrechtzuerhalten. Kein Wunder also, wenn daher die Ehefrauen und Familien versuchten, so viel wie möglich aus der Institution, an der ihr Gatte, Vater oder Onkel beschäftigt war, herauszuholen. Neben der Ausnutzung von ärarischen Gütern zu privaten Zwecken zeugen Tagebücher und Memoiren davon, dass diese Ärarischen Weiber ohne Ankündigung in den Amtsräumen oder Kasernen erschienen und Untergebene ihrer Gatten nicht nur herumkommandierten, sondern auch missbräuchlich einsetzten. Das ging während des Ersten Weltkrieges sogar so weit, dass ein geheimer Befehl an alle Offiziere erlassen werden musste mit Androhung, bei Nicht-Beachtung würden die Beteiligten an die Front geschickt werden. Was war passiert? Der Befehl war betitelt mit »Unmilitärische Verwendung von Offiziersdienern« und besagte, dass wiederholt »Offiziersdiener während der Promenadestunde […] einen Kinderwagen schiebend, angetroffen« worden waren. Im istrischen Marinestützpunkt Pola gab es gar eine »Damenstunde in der Marineschwimmschule«, was bedeutete, dass die Ausbildung der Soldaten regelmäßig unterbrochen wurde, da die Benutzung den Ärarischen Weibern vorbehalten war.
Der Offizier August von Urbański besuchte seinen Vater in der Temeschwarer Garnison (heute Timişoara in Rumänien) und wusste zu erzählen: »Temesvar war der Sitz eines Korpskommandos, und vieler Militär- und Zivilämter. Im Zentrum der Festung stand ein mächtiger Offizierspavillon mit sehr vielen ›Naturalwohnungen‹ (Dienstwohnung der Offiziere). Das enge Zusammenleben in diesem ausschließlich von Offizieren und deren Familien bewohnten Gebäude hatte allerlei unerquickliche Folgen. Familienangelegenheiten führten vielfach zu dienstlichen Konflikten und die Taktlosigkeiten einzelner ›ärarischer‹ Frauen boten wiederholt Veranlassung zu Ehrenaffairen.« Mit »Ehrenaffaire« ist übrigens nicht mehr und nicht weniger gemeint, als dass die betroffenen Offiziersgatten im schlimmsten Fall ihren Dienst quittieren mussten, sich also nach einem neuen Beruf umsehen mussten, oder aber gar in einem Duell zur Wiederherstellung ihrer Ehre getötet wurden. Die ärarischen Damen, deren männlicher Anhang in dieser Garnison diente, drängten sich aber auch angeblich vor allem bei offiziellen Anlässen gerne in den Vordergrund, wie die Abbildung zeigt. Die Damen oder Weiber gemeinsam mit ihren Gatten im Staatsdienst wurden als Ärarische oder als Ärarische Gesellschaft bezeichnet. Zahlenmäßig bildeten sie nicht gerade eine kleine Gruppe. Die Habsburgermonarchie war ein Beamtenstaat, obwohl er im Vergleich zu heute weitaus weniger Personen im öffentlichen Dienst beschäftigte. Dennoch gab es, wie die österreichische Historikerin Waltraud Heindl in ihrer Studie über die Beamten zeigt, bereits damals eine rege Diskussion zu ihrem Abbau, um Kosten zu sparen. Dass diese Personengruppe, die häufig nicht in jener Region Dienst tat, aus der sie einst stammte, sich sogar eines eigenen klar erkennbaren Jargons bediente, der auch für Nicht-Deutschsprachige ein klares Erkennungsmerkmal war, erläutert der Eintrag Armeedeutsch. Laut einer satirischen Bemerkung in Danzers Armeezeitung aus dem Jahr 1901 sammelte sich die Ärarische Gesellschaft bevorzugt in einzelnen Stadtteilen. War es beispielsweise in Pola der Stadtteil Policarpo, den man nach Passieren des Portone dei Gnocchi erreichte, war es in der Reichshauptstadt Wien vor allem ein Bezirk: die Josefstadt, die deshalb als »Aerariopolis« bezeichnet wurde. Ein Großteil der Ärarischen Gesellschaft war übrigens Teil der Schwarz-Gelben Gesellschaft.
Als höchste Ehre für die Ärarischen Weiber galt, einem Mitglied des Hauses Habsburg vorgestellt zu werden.