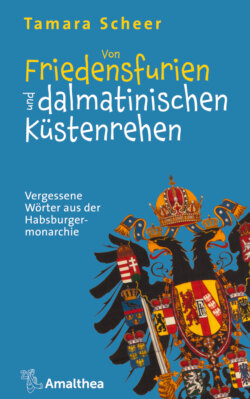Читать книгу Von Friedensfurien und dalmatinischen Küstenrehen - Tamara Scheer - Страница 5
Vorwort
ОглавлениеPieter M. Judson
Dieses zauberhafte Buch der Historikerin Tamara Scheer ruft uns einige der bekanntesten Persönlichkeiten und Eigenschaften der einstigen Habsburgermonarchie in Erinnerung, die als Staatsgebilde zwar vor einem Jahrhundert von der Landkarte verschwunden ist, deren Kulturen jedoch überraschenderweise weiterleben, und dies heute fast machtvoller als vor hundert Jahren. Viele Europäer und Amerikaner haben ihre Lieblingsgeschichten, die ein österreichisch-ungarischer Vorfahre erzählt hat, oder ein geliebtes Familienrezept, das in vielen Teilen der alten Monarchie seinen Ursprung haben könnte. Tamara Scheer ist in mehreren Sprachen versiert und vereint in diesem Buch einige der farbigsten – wenn auch vergessenen – Ausdrücke, eine Art inoffizieller Sprache, die man als »Habsburgerisch« bezeichnen könnte.
Viele Menschen meinen, dass die wahre Einzigartigkeit der habsburgischen Gesellschaft darin bestand, dass sie mehr als elf Sprachen und zahllose Dialekte umfasste. Vor allem wurden diese vielen Sprachen zu Symbolen für die Unterschiede, die die Völker der Monarchie scheinbar voneinander trennten. Dabei vergessen wir jedoch gern, dass jene verschiedenen Völker mit ihren unterschiedlichen Sprachen ja vieles gemeinsam hatten: Institutionen, Alltagsbräuche und Speisen ebenso wie die Erfahrung einer imperialen Kultur. Ungeachtet ihrer Sprachenvielfalt gestalteten die Völker der Monarchie in nahezu jeder Art menschlicher Lebenssituation eine kulturelle Vermischung. Bereits im 19. Jahrhundert lebten die vielen Völker der Habsburgermonarchie in der Regel nicht voneinander getrennt, vor allem in den Städten. Männer verschiedener Nationalitäten innerhalb der Monarchie dienten zusammen in einer Armee, die auf der allgemeinen Wehrpflicht basierte. Als Teil dieser Erfahrung lernten sie verschiedene Teile der Monarchie kennen und schnappten überall etwas von den jeweiligen Sprachen auf. Bewohner der Monarchie lasen ähnliche Zeitungen und Karikaturen aus dem ganzen Reich, sie bestellten Kaffee, Bier oder Sliwowitz in Cafés und Gasthäusern, die ihnen allesamt bekannt waren, sie kauften ihre Straßenbahnfahrscheine in vertraut aussehenden Tabaktrafiken, sie holten sich zahllose behördliche Stempel in ähnlich aussehenden Ämtern und legten oft bis dahin unvorstellbare Strecken innerhalb der Monarchie mit der Bahn zurück. Wo auch immer sie sich befanden, von Bosnien bis in die Bukowina, von Vorarlberg bis nach Siebenbürgen, überall trafen sie auf eine gemeinsame vertraute Kultur.
Doch sogar jenseits dieser gemeinsamen Kulturen und Speisen ist es eine Tatsache, dass die Habsburgermonarchie sich auch durch viele Formen sprachlicher Vermischung und gemeinsamer Sprachschöpfung auszeichnete. Oft waren die Heimatregionen der Menschen durch ihre Mehrsprachigkeit und den lokalen Gebrauch ausgeprägter Dialekte bestimmt. Auch wenn Nationalisten das Gegenteil behaupten: Können wir uns denn wirklich die Steiermark/Štajerska ohne die slowenischen und deutschen Sprachgruppen vorstellen? Können wir uns Tirol ohne Deutsch und Italienisch vorstellen? Können wir uns Siebenbürgen ohne Ungarisch, Sächsisch und Rumänisch vorstellen (von Jiddisch ganz zu schweigen)? Natürlich nicht. Die meisten Menschen in diesen Regionen beherrschten zumindest teilweise zwei oder drei Sprachen. Vielleicht wurden die Bewohner von Österreich-Ungarn gar nicht so sehr durch ihre vielen Sprachen getrennt, wie wir uns das heute vorstellen.
Wir verdanken es der Detektivarbeit von Tamara Scheer, dass wir nun den vielen offiziellen und inoffiziellen Sprachen der Völker der Monarchie eine weitere germanische Sprache hinzufügen können: Habsburgerisch. In diesem wertvollen Lexikon erklärt Tamara Scheer die faszinierenden Ursprünge vieler versunkener habsburgischer Ausdrücke. Wie das Armeedeutsch des Reiches oder wohl auch wie das sogenannte Englisch, das heutzutage in der Europäischen Union verwendet wird, deutete Habsburgerisch nicht nur auf die kulturelle Vielfalt der Gesellschaft Österreich-Ungarns hin, sondern vor allem auf den gemeinsamen regionalen oder imperialen Erfahrungsraum. Habsburgerische Ausdrücke beziehen sich ganz speziell auf Phänomene, die in der Habsburgermonarchie zutage traten, weil deren Völker sie erfunden hatten. Auf diese Weise lehrt uns Tamara Scheer mit ihrem faszinierenden Lexikon viel mehr über die Funktionsweise der Habsburgergesellschaft als die meisten Geschichtsbücher, die ich kenne.
Und wer könnte berufener sein als Tamara Scheer, diese Kleinode zusammenzutragen und zu erklären? In ihren früheren Arbeiten erwies sie sich als eine der führenden Historikerinnen der österreichisch-ungarischen Armee, speziell im Hinblick auf die vielen Sprachen, die in dieser Armee gesprochen wurden. Sie ist eine der wenigen Historikerinnen der Geschichte Habsburgs, die tatsächlich genug Deutsch und Ungarisch sowie Italienisch und mehrere slawische Sprachen beherrscht, um Regierungsdokumente der höchsten Ebene ebenso zu verstehen wie lokale Polizeiberichte aus jeder Region der Monarchie. In ihrer Arbeit beweist sie immer wieder einen scharfen Blick für die wichtigen und faszinierenden Details alltäglicher Lebenssituationen.
Viele der in diesem Buch aufgelisteten Ausdrücke haben sich aus den gemeinsamen Erfahrungen des Ersten Weltkrieges entwickelt. Wie von Tamara Scheer aufgezeigt, war der Krieg eine besonders fruchtbare Zeit für neue Sprachschöpfungen, um die Frustration der Menschen angesichts schwieriger neuer Umstände auszudrücken, aber auch gemeinsame Erfahrungen von Not und Leid zu beschreiben. Wie in ihren anderen Arbeiten stellt sie auch hier fest, dass die Habsburgerarmee ein besonders fruchtbarer Boden für sprachliche Erfindungskraft war. Das trifft aber auch auf die neuen Ersatzlebensmittel und Haushaltsartikel zu, die an die Stelle der vertrauten traten und in Kriegszeiten quasi zu Legenden des Alltagslebens wurden. Tamara Scheer berichtet über eine Art kreativer Ironie der Bevölkerung, die mithilfe eines erfindungsreichen Wortschatzes ihr Leiden und ihren Pessimismus ebenso ausdrückte wie auch ihre zynische Weigerung, die rosigen offiziellen Erklärungen von Ereignissen oder Ersatzlebensmitteln zu akzeptieren.
Auch wenn wir die Lebensbedingungen in einem großen Vielvölkerstaat wie der Habsburgermonarchie wohl kaum nachvollziehen können, so gibt uns Tamara Scheer doch in wunderbarer Weise eine Vorstellung davon, wie sie geklungen haben mag.