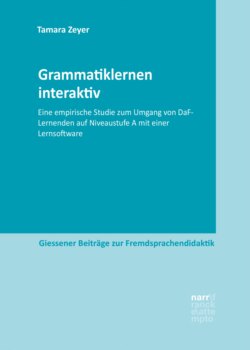Читать книгу Grammatiklernen interaktiv - Tamara Zeyer - Страница 23
3.4. Visuelle Unterstützung beim Grammatiklernen in analogen Medien
ОглавлениеDurch Visualisierungen kann das Erklären grammatischer Inhalte unterstützt werden, da „rein verbale Erklärungen im flüchtigen Medium der gesprochenen Sprache […] zu abstrakt [sind], sie überfordern die Lernenden, erschweren das Verstehen und dürften zudem einen geringen Behaltenseffekt haben“ (Storch 1999: 194). Zur Visualisierung von Grammatik im Bereich Deutsch als Fremdsprache arbeiteten einige Forschende Tipps für die Praxis aus (vgl. Brinitzer und Damm 2012; Kießling 2002; Nordkämper-Schleicher 1998; Scherling und Schuckall 1992). Neben den Praxistipps für die Arbeit mit Visualisierungen (Bilder, abstrakte Symbole, Signale etc.) im Grammatikunterricht wird ein kleiner Zeichenkurs für Lehrende angeboten (vgl. Scherling und Schuckall 1992). Laut Hilger (1999: 8) sind Bilder „ideale Hilfsmittel“ zur Erschließung grammatischer Inhalte, eine kritische Auseinandersetzung mit Visualisierungsmöglichkeiten der Grammatik und Anforderungen an einzelne Darstellungsformen in der Fremdsprachendidaktik ist dringend vonnöten.
Der erste Versuch einer Systematisierung visueller Lernhilfen für die Grammatikvermittlung wurde von Funk (1984: 28-29) unternommen, ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit. Folgende Lernhilfen werden erwähnt: grafisch-technische Symbole (Unterstreichung, Tabellen, farbige Hervorhebung, Umrahmungen, Veränderung der Drucktypen), abstrakte Symbole (sprachsystembezogen oder inhaltsbezogen), konkret-bildliche Verstehenshilfen, Bild-Metaphern und Situierung von Strukturen und Verbalisierungsmustern (Zeichnungen, Fotos) (vgl. ebd.). Auf der Grundlage der Analyse der DaF-Lehrwerke unterscheiden Funk und Koenig (1991a, 1991b) zwischen drucktechnisch-grafischen Lernhilfen, abstrakten Symbolen1, konkreten Symbolen („Bildmetaphern“) und Lernhilfen durch Situationskontexte.
Eine verbale Vermittlung grammatischer Regeln2 kann insbesondere im Anfängerunterricht kompliziert sein, daher könnten visuelle Elemente, wie Situationsbilder, konkrete bildliche Verstehenshilfen, Signale, abstrakte Zeichen und Bildsymbole (vgl. Scherling und Schuckall 1992: 97) verwendet werden. Laut Scherling und Schuckall (1992) findet eine gegenseitige Ergänzung von Bild und Sprache nur dann statt, wenn sie inhaltlich aneinander anknüpfen. Unter Situationsbildern werden nach Scherling und Schuckall (1992: 98) Visualisierungen verstanden, die der „Klärung des sprachlichen Handlungsrahmens“ dienen, welche den Situationsvorgaben von Funk entsprechen. Konkrete bildliche Verstehenshilfen stehen für visuelle Metaphern, die die formale Struktur eines grammatischen Phänomens darstellen, wie beispielsweise eine Schraubzwinge oder eine Schere für Satzklammer (vgl. ebd.: 105). Eine visuelle Metapher ist ein Beispiel analoger Bilder in der Typologie von Macaire und Hosch (1996) (s. Kap. 3.3).
Farbe, Fettdruck, Einrahmungen und Pfeile gehören nach Scherling und Schuckall (1992) zur Signalgrammatik3 und können den Verstehensprozess von grammatischen Inhalten unterstützen, funktionieren aber kaum auf der pragmatischen Ebene des Gebrauchs und der Bedeutung. Mit Elementen der Signalgrammatik könnten grammatische Regeln konkretisiert werden, was bei der Selbstkorrektur und der Wiederholung hilfreich sei. Abstrakte Zeichen und Bildsymbole dienen auch der Regelpräzisierung und können in Übungen, z. B. zum Satzbau, eingesetzt werden (vgl. ebd.: 106). Scherling und Schuckall (1992) betonen, dass einzelne Visualisierungsmöglichkeiten der Grammatik exemplarisch aufgezeigt werden (vgl. ebd.: 97), d. h. dass es sich um keine prägnante Klassifikation handelt. Jedoch sind viele Übereinstimmungen zwischen der Klassifikation von Funk und Koenig (1991b) und einzelnen visuellen Lernhilfen nach Scherling und Schuckall (1992) festzustellen. Im Gegensatz zu Funk und Koenig gehen Scherling und Schuckall von der Funktionalität aus und zählen Farbe, Schrift und Pfeile zu den signalgrammatischen Mitteln. Erwähnenswert ist, dass keine weiteren Systematisierungsvorschläge möglicher Lernhilfen für Grammatik nach den oben erläuterten Publikationen zu finden sind. Die Platzierung der grammatischen Informationen, sowohl verbalen als auch visuellen, auf den Lehrwerkseiten, könnte im Hinblick auf die Rolle der Grammatik für eine genauere Analyse auch interessant sein.
Um eine Doppelung zu vermeiden, wird an dieser Stelle auf Beispiele der ausgeführten Visualisierungen aus den DaF-Lehrwerken verzichtet. In Kapitel 4.4 zur Grammatikvermittlung werden sie anhand der Lehrwerkanalyse systematisch dargelegt. Jedoch ist ein Blick in eine Bildergrammatik bzw. in vier Ausgaben der Bildergrammatik für Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch und Spanisch sehenswert. Da die Analyse aller Visualisierungen der vier Bildergrammatiken den Rahmen sprengen würde und der Fokus dieser Arbeit auf dem Imperativ liegt, werden Lektionen zum Thema Imperativ in allen vier Ausgaben analysiert.
Einen ambitionierten Versuch, grammatische Themen zu visualisieren, unternehmen Autoren der Grammatik in Bildern für Deutsch als Fremdsprache (Gubanova-Müller und Tommaddi 2016). Laut eigener Angabe könne jeder Grammatik mit der neuen visuellen Methode lernen. Bereits nach einem kurzen Blick ins Buch werden Erwartungen einer „neuen“ Methode nicht bestätigt. Bei den Visualisierungen handelt es sich um die bereits bekannten, oben skizzierten Elemente: farbige Markierungen, Pfeile, Abbildungen. Das Buch kündigt an, mit Visualisierungen den Text zu unterstützen, die reine Textmasse aufzubrechen und somit zu helfen, sprachliche Inhalte besser zu verstehen und zu verarbeiten (vgl. ebd.: 4). Einige Abbildungen versuchen grammatische Phänomene auf humorvolle Weise darzustellen, was eher eine verwirrende Wirkung hat. Es ist fraglich, ob Lernende bspw. verstehen würden, dass das Bild einer Schnecke auf einem Skateboard, das von dem Satz „Fahr ein bisschen langsamer!“ begleitet wird, die Funktion „Rat“ verdeutlichen soll (s. Abb. ebd.: 251). Für die visuelle Darstellung der Imperativbildung werden Farben, Durchstreichungen, Pfeile und mathematische Zeichen verwendet (s. Abb. ebd.: 252).
In Grammatik in Bildern für Englisch wird dem Imperativ im Kapitel „Verb“ eine Doppelseite gewidmet (vgl. Melican und Proctor 2014: 116-117). Die Abbildung, auf der eine Person auf einem Felsen steht, sollte den Satz „Be careful.“ verständlicher machen. Die Funktionen des Imperativs werden im kurzen Text rot hervorgehoben. In Beispielsätzen sind die Imperativformen durch Fettdruck hervorgehoben. Darüber hinaus werden pragmatische Aspekte sowie Orthographiezeichen thematisiert und mit Beispielsätzen illustriert. Eine weitere Doppelseite zum Imperativ ist in Kapitel „Satzarten“ zu finden, in dem die Bildung der Imperativsätze im Englischen metasprachlich erklärt wird (vgl. ebd.: 254-255). Die Abbildung einer maskierten Person mit einer Pistole in der Hand und dem Ausspruch „Give me the money!“ veranschaulicht, wie die Absicht des Sprechers in einem Imperativsatz ausgedrückt wird (s. Abb. ebd.: 254). Im Gegensatz zum Foto mit dem Satz „Be careful.“ ist diese Visualisierung eindeutiger, auch wenn sie aggressiv wirken könnte und in dem Falle, dass aus dem Bild, in dem weder Geld noch ein Kassierer zu sehen sind und ein Supermarkt nur zu erahnen ist, der Satz erraten wird.
Die Bildergrammatik für Französisch beinhaltet nur eine Doppelseite zum Thema Imperativ (im Kapitel „Verb“) (vgl. Rist 2014: 164-165). Die Funktionsweise wird in einem Satz formuliert, in dem statt Funktionen (Befehle, Aufforderungen) das Wort Imperativ dunkelrot hervorgehoben ist, ohne eine weitere visuelle Unterstützung. Anschließend folgen mehrere Tabellen zur Bildung unterschiedlicher Imperativformen.
In der Grammatik in Bildern für Spanisch wird dem Thema Imperativ ein separates Kapitel gewidmet (vgl. Reymóndez-Fernández 2014: 228-239). Der Imperativ wird als „der Modus der Befehle“ definiert (ebd.: 230). Neben der Bildung der Imperativformen werden auch alternative Ausdrucksformen der Befehle und Aufforderungen aufgelistet. Visuelle Unterstützung findet durch eine farbige Hervorhebung in Beispielsätzen statt. Die Bildung des Imperativs wird tabellarisch für unterschiedliche Verben mit farbigen Hervorhebungen der Endungen bzw. der Verben dargestellt. Im Kapitel sind auch vier Abbildungen zu finden, zwei dieser Abbildungen sollten humorvolle Situationen zum Thema Imperativ präsentieren. In der Abbildung der zwei Personen in Ganzkörperverbänden werden z. B. die Folgen der Nichtausführung einer Aufforderung, die im Imperativ formuliert wird („Cerrad bien el gas.“/“Dreht das Gas immer gut zu!“), dargestellt (s. Abb. ebd.: 234). Fraglich bleibt, ob die Visualisierung in diesem Fall hilfreich oder eher irritierend (und auch unsensibel) ist.
Die Grammatiken in Bildern sind eine Art Referenzgrammatiken, die heutige visuelle drucktechnische Möglichkeiten nutzen und grammatische Strukturen in Farben und Tabellen zu veranschaulichen. Jedoch die Behauptung, dies sei eine „neue“ Methode, wird nicht bestätigt. Darüber hinaus wird am Beispiel der fotografischen Illustrationen deutlich, dass ihre Potenziale für die Visualisierung von Grammatik nicht ausgeschöpft werden bzw. sie die Anforderungen an didaktische Visualisierungen4 nur teilweise erfüllen.
Visuelle Metapher
Zur weiteren Kategorie der Visualisierungen gehören Metaphern, deren Potenziale für das Fremdsprachenlernen zu nutzen sind, jedoch in wenigen Lehrwerken eine Berücksichtigung finden. Für die Grammatikvermittlung können Metaphorisierungsprozesse5 „eine bedeutende Rolle zur Verarbeitung abstrakter Konzepte“ spielen (Weininger 2013: 31). Ausgehend von den Erkenntnissen der Gedächtnistheorien sieht Bellavia (2007) einen positiven Einfluss der Metapher beim Sprachenlernen in ihrer emotionalen Kraft und lebendigen Bildlichkeit, die das Behalten der Lerninhalte fördern. Darüber hinaus wird durch den Einsatz der Metaphern der Anbau des mentalen Lexikons gefördert sowie die Fantasie der Lernenden angesprochen, was zu affektiven Effekten führt und zum Lernen motiviert (vgl. Bellavia 2007: 212ff.). In einer Reihe von Publikationen werden Potenziale der Metapher für den Spracherwerb diskutiert (s. dazu z. B. Bellavia 2007, 2011, 2017; Suñer Muñoz 20136; Roche und Suñer Muñoz 2016). Bellavia erarbeitet zahlreiche didaktische Vorschläge zum Nutzen der alltäglichen Metaphorik für die Darstellung deutscher Präpositionen und schreibt den Metaphorisierungsprinzipien in computergestützten Grammatikanimationen großes Potenzial zu (vgl. Bellavia 2007: 364), was in späteren Studien zu Animationen bestätigt wird (vgl. Roche und Suñer Muñoz 2014; Kanaplianik 2016). In der Interaktiven Grammatik werden auch visuelle Metaphern in einzelnen Einheiten (z. B. eine Schere zum ‚Schneiden‘ von Komposita, ein Magnet zur Verdeutlichung der Satzklammer) zur Verständniserleichterung verwendet. Diese Metaphern lassen sich bewegen und sollten dadurch nachvollziehbar für Lernende sein. Die visuelle Metapher der Einheit Imperativ wird in Kapitel 5 dargestellt und analysiert. Zuerst werden im folgenden Abschnitt einige Beispiele für Grammatikvermittlung mit bewegten Bildern bzw. Animationen einer näheren Betrachtung unterzogen.