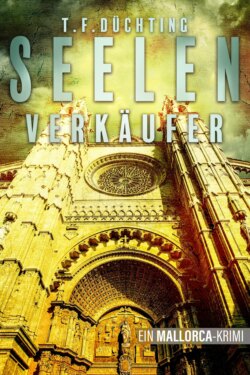Читать книгу Seelenverkäufer - Ein Mallorca-Krimi - T.F. Düchting - Страница 9
Donnerstag, 15. Mai, 18:00 Uhr
ОглавлениеEtwas bewegte sich schnell auf Xavier zu. Im letzten Moment wollte er noch ausweichen und zur Seite springen, aber es war zu spät: Er spürte, wie eine Hand seine Schulter packte. Xavier versuchte sich loszureißen, aber es war ein Griff wie ein Schraubstock, der seine Schulter umklammerte. Mit einer kräftigen, ruckartigen Bewegung wurde er nach hinten gerissen, sodass er herum schleuderte. Der Griff löste sich, als sich seine Beine ineinander verfingen und er stolperte und zu Boden stürzte. Wieder fiel er auf seine bereits verletzten Knie und schlug vornüber mit seinem Oberkörper und seinem Gesicht auf den harten Untergrund auf. Unmittelbar durchzuckte ihn ein stechender Schmerz, der alle anderen Gefühle überlagerte.
Regungslos mit dem Gesicht nach unten blieb Xavier auf dem Boden liegen. Er traute sich nicht, sich zu bewegen oder aufzuschauen. „Was suchst du hier?“, hörte er eine tiefe unfreundliche Stimme fragen. Xavier bewegte sich vor lauter Angst und Schmerz zunächst keinen Zentimeter, drehte sich dann aber langsam ohne aufzuschauen um und setzte sich hin. Mit gesenktem Blick schaute er auf massive braune Lederstiefel, in denen die kräftigsten Beine steckten, die er je gesehen hatte. Langsam wanderten seine Augen nach oben und das, was er sah, erschreckte ihn: Der Mann war ein Hüne – Xavier schätzte ihn auf mindestens zwei Meter, vielleicht auch mehr. Er trug ein blaurot kariertes Hemd, das sich eng an seinen starken Oberkörper schmiegte und große, kräftige Muskeln erkennen ließ. Der Mann wirkt dabei aber nicht wie ein Kraftsportler, sondern mehr wie jemand, der schwere körperliche Arbeit gewohnt war und regelmäßig verrichtete.
Xavier beeindruckten insbesondere die großen Hände, deren Kraft er bereits zu spüren bekommen hatte. Zögerlich, Zentimeter für Zentimeter wanderte sein Blick nach oben, bis er in das Gesicht eines etwa sechzig jährigen Mannes schaute. Dieses war von einem dichten schwarzgrauen Vollbart umschlossen. An den haarlosen Stellen war die Haut tief braun und von Wetter und Sonne ausgetrocknet. In der Mitte des Gesichts stach eine große hakenförmige Nase bedrohlich hervor, die sich zur rechten Seite bog. Offensichtlich war sie in der Vergangenheit mehr als einmal gebrochen gewesen. Aus dem Schatten einer großen Hutkrempe heraus schauten Xavier tiefschwarze kalte Augen an. „Was du hier suchst, habe ich gefragt!“ Während der Mann ihn anherrschte, erwachten die kalten Augen zum Leben und verengten sich zu engen Schlitzen.
Xavier stockte der Atem, seine Stimme versagte ihm. In seinem Leben hatte er noch nie in ein so hartes Gesicht geblickt.
„Bist du stumm, ich will endlich wissen, was du hier machst.“ Der Mann trat einen Schritt auf ihn zu, beugte sich vor und griff den Kragen von Xaviers Hemd. Ohne Mühe zog er den Jungen an diesem hoch und stellte ihn auf die Beine. Es hatte nicht den Anschein, als wenn es den Mann auch nur ein bisschen anstrengen würde. „Das hier ist kein Spielplatz!“ Während der Hüne das hervor bellte, hielt er Xavier weiter fest am Kragen und schaute ihn mit seinen kalten Augen an.
Obwohl es fast dreißig Grad warm war, lief es Xavier kalt den Rücken herunter. Wer war dieser Kraftprotz und was machte er hier, fragte er sich. Und was gedachte dieser jetzt mit ihm zu tun? Mit Entsetzen wurde Xavier bewusst, dass der Mann mit ihm machen konnte, was er wollte. Egal was dieser tun würde, es gab absolut keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Schreien wäre auch sinnlos, da ihn hier in der Einöde niemand hören würde. Xavier wurde sich seiner Hilflosigkeit bewusst. Ein Gefühl von Verzweiflung und Angst kroch langsam in ihm hoch.
Wie lange würde der Mann ihn noch am Kragen halten? Würde er ihn in der Finca einschließen und dort festhalten? Würde er ihn schlagen oder vielleicht noch schlimmeres?
„Jetzt platzt mir aber gleich der Kragen, sag endlich, wer du bist“, schrie ihn der Hüne an.
Xavier konnte immer noch nicht antworten, sein Mund war trocken und er hätte vor lauter Angst keinen zusammenhängenden Satz herausgebracht. Der Hüne ließ von ihm ab, drehte sich um und beugte sich vorn über, um einen dicken Ast vom Boden aufzuheben.
Xavier sah seine Chance: „Jetzt oder nie!“ Geistesgegenwärtig drehte er sich um und stolperte los. Seine Füße blieben an den Kalksteinen hängen, die auf dem Feldweg lagen, aber nach und nach nahm er Geschwindigkeit auf. Die Angst ließ ihn den Schmerz an den Knien nicht spüren und ihn immer, immer schneller laufen. Er rannte den Feldweg entlang und es war ihm egal, ob er dabei gesehen wurde. Offensichtlich hatte man ihn ja bereits entdeckt und nun wollte er nur noch ganz weit weg. Weg von dem unheimlichen Haus und weg von dem furchteinflößenden Hünen, der ihn zu Boden geworfen hatte. Xavier lief und lief.
Nach einiger Zeit – es kam ihm wie eine Ewigkeit vor – hörte er die Geräusche von fahrenden Autos. Xavier bekam kaum noch Luft und hoffte, dass er es bald geschafft hatte. Wenn er die Landstraße erreichte, dann wäre er in Sicherheit. Diese wurde stark befahren und er flehte, dass der Verkehr heute besonders dicht war. An einer stark befahrenen Straße würde sich niemand trauen, ihn anzugreifen.
Xaviers Lungen brannten und er rannte mit letzter Kraft weiter. Er konnte den Lärm der Autos bereits hören, aber sie noch nicht sehen. Der Feldweg machte noch eine leichte Biegung und Xavier wünschte sich, nein hoffte, dass hinter dieser nun endlich die Straße lag. Und tatsächlich, über die Böschung hinweg erblickte er die vorbeirauschenden Fahrzeuge. Mehr, immer mehr, konnte er von der Straße sehen. Dann erblickte er in der Einfahrt zum Grundstück ein schmiedeeisernes Tor und seine gemauerten Einfassungen. Dieses war verschlossen und trennte so den Feldweg von der Straße.
Während er lief sah er durch die Metallstangen des Tores hindurch. Was war das? Es sah aus, als wenn in der Auffahrt ein dunkelblauer Wagen stand. Ein VW Golf, ja es war ein blauer Golf 3 der dort parkte. Saß da nicht jemand drin? Nur schwer konnte er durch das spiegelnde Glas der Frontscheibe etwas erkennen. Xavier war es gleich, er schleppte sich weiter in Richtung Straße.
Als er das Tor erreichte, versuchte er es zu öffnen, aber es war verschlossen. Verzweifelt rüttelte er daran, aber nichts bewegte sich. Langsam zog er sich an den Querverstrebungen hoch, schwang erst ein Bein hinüber, dann das andere. Um Zeit zu gewinnen, drehte er sich nicht um, sondern sprang mit dem Körper nach vorne vom Tor herunter. Als er gelandet war, hatte er noch so viel Schwung, dass er einige Schritte nach vorne stolperte. Plötzlich stand er vor dem Wagen und seine Beine wurden abrupt von der Stoßstange des Fahrzeugs gebremst. Der Schwung schob ihn weiter voran, so dass er vornüber fiel. Im letzten Moment riss er seine Hände nach vorne, sodass sie mit einem lauten Knall auf die Motorhaube schlugen und ihn abbremsten.
Xavier stand still. Er fühlte sein Herz rasen, hörte seinen Puls im Ohr rauschen und spürte, wie sich sein Brustkorb atemlos hob und senkte. Er war völlig fertig und der Schweiß lief in Strömen seinen Körper hinab. Xavier blickte in den Wagen. Dieser war leer. Auf dem Fahrersitz lag eine dunkle Jacke. Jemand hatte sie offensichtlich so in den Wagen gelegt, dass ein Großteil sich auf der Rückenlehne des Sitzes befand. Dadurch hatte es so gewirkt, als wenn jemand im Auto sitzen würde.
Xavier atmete erleichtert aus. So schnell er konnte, humpelte er am Fahrzeug vorbei zur Straße. Gedanken schossen ihm dabei durch den Kopf: Was war das für ein Zeichen, das er über dem Eingang der Finca gesehen hatte? Warum hatte der Mann ihn so brutal umgerissen? Auf der anderen Seite, was hatte Xavier auch dort verloren. Aber war das nicht der Grund und Boden seines Vaters und hatte er daher nicht auch das Recht dort zu sein? Xavier hatte nun noch mehr Fragen, auf die er noch keine Antwort wusste. Noch, dachte er bei sich. Während er langsam ruhiger wurde und die Straße in Richtung seines Elternhauses entlang humpelte, bemerkte er nicht, dass er aufmerksam beobachtet wurde.
*
Lauenburg sah den Schatten nicht, der auf ihn zuraste. Sein Blick war immer noch starr auf seine Füße gerichtet. Gedankenverloren setzte einen Schritt vor den anderen, als er die Fahrbahn betrat.
Plötzlich wurde er an der Schulter gepackt und nach hinten gerissen. Aufgrund der Drehung, die sein Körper vollführte, flog ein Arm mit solcher Wucht in die Höhe, dass ihm seine Reisetasche aus der Hand gerissen und auf den Bürgersteig geschleudert wurde. Der vierrädrige Trolley, dessen Griff er fest umklammert hielt, schoss neben ihm nach vorne und riss ihn mit sich, sodass Lauenburg zurück über die Bordsteinkante stolperte und hart aufs Pflaster des Trottoirs schlug. Just in dem Moment als er zu Boden ging, hörte er hinter sich das Horn eines LKWs. Der gellende Ton fuhr Lauenburg in die Glieder und als er sich umdrehte, sah er das Fahrzeug an der Stelle, wo er noch vor einer Sekunde gestanden hatte. Dann rauschte der LKW vorbei und verschwand im Verkehr.
Erneut spürte er eine Berührung an der Schulter. Lauenburg schaute auf und blickte in das Gesicht des Polizisten, der ihn zuvor gebeten hatte, von der Treppe vor dem Polizeipräsidium aufzustehen. Offensichtlich hatte dieser ihn nach hinten gerissen.
„Señor, ist alles in Ordnung? Geht es Ihnen gut?“, fragte der Polizist besorgt.
„Ja, ja, haben Sie vielen Dank, mir geht es gut!“ Lauenburg spürte, wie das Adrenalin durch seine Adern schoss. Er war plötzlich hellwach und wurde sich der Situation bewusst: Hätte der Polizist nicht eingegriffen – einen Moment später wäre er von dem LKW erfasst worden. Er hätte tot sein können. „Ich werde besser aufpassen.“ Während er das sagte, schenkte er dem Polizisten ein gequältes Lächeln. Dann stand er vom Boden auf.
Nachdem er sich den Schmutz von der Kleidung geklopft hatte, sammelte er seine Gepäckstücke ein und nahm seinen Weg wieder auf. Er ging über die Ampel und querte anschließend die Brücke über den Torrent de Sa Riera, Palmas vierhundert Jahre alten Kanal. Als er die andere Seite erreicht hatte, blickt er sich noch einmal um und sah, dass der Polizist immer noch an derselben Stelle stand und ihm nachschaute. Lauenburg winkte ihm noch einmal kurz zu, bog rechts ab und ging weiter seines Weges.
Er ging am Kanal entlang und sein Blick fiel hinunter in den Graben. Die grob behauenen Steine, aus denen die Kanalwände bestanden, fielen ihm ins Auge. Ihm wurde die üppige Bepflanzung und das saftige Grün bewusst, das hier und da mit einigen rötlichen Blüten gesprenkelt war. Palmen und hochaufgeschossene Zypressen streckten sich der Sonne entgegen. Sein Blick wanderte den Kanal entlang zur nächsten Brücke, welche die beiden Seiten des Passeig de Mallorca, der Hauptstraße, die den Torrent einfasste, miteinander verband.
Lauenburg hatte das Gefühl, dass er jedes Detail wahrnahm und in sich aufsog. Das muss das Adrenalin sein, dachte er, als er auf einer Parkbank Platz nahm. Eine Weile betrachtete er den Verkehr, der sich auf der anderen Seite des Kanals einen Weg durch die Stadt bahnte. Der durch ihn verursachte Lärm variierte je nachdem, wie viele Autos sich die Straße herunter schlängelten. Die eintönigen Motorengeräusche wurden regelmäßig vom lauten Röhren vorbeirasender Motorräder oder vom Hupen eines Autofahrers überlagert.
In Gedanken ging er noch mal das Geschehene durch. Du hättest tot sein können, sagte er bei sich. In einer normalen Verfassung wäre ihm so etwas niemals geschehen, doch derzeit befand er sich nicht in einer normalen Verfassung: Auch wenn er aufgrund des Adrenalins gerade hellwach war, wusste er, dass er dringend Schlaf benötigte.
Wieder schoss ihm der Satz des Polizisten durch den Kopf: „ … Sie sollten sich keine Gedanken machen …“ Lauenburg verzog das Gesicht. Der Mann hatte nicht die geringste Ahnung, aber ganz offensichtlich wollte dieser ihm nicht weiter helfen. Wenn dem so ist, dann musst du die Sache eben selber in die Hand nehmen, sagte er sich und spürte, wie sein alter Kampfgeist zurückkehrte.
Lauenburg hasste es, wenn er keine Kontrolle hatte oder Dinge nicht so liefen, wie er sie sich wünschte. Und hilflos zu sein und von einer Situation getrieben zu werden, das war ihm nahezu unerträglich. Solange er denken konnte, hatte er sein Leben selber gestaltet. Doch in der letzten Zeit war es ihm aus den Händen geglitten und er war von den Umständen getrieben worden. Er schüttelte den Kopf: Das war nicht der Carl Friedrich von Lauenburg, der er sein wollte. Das entsprach nicht seinem Charakter und nicht seinem Anspruch, in jeder Situation Haltung zu wahren. In seinem Beruf hatte er schon viele schwierige Situationen gemeistert – und immer hatte er die Dinge im Griff gehabt.
Die schwerste Krise hatte sein Bankhaus im Frühjahr 2009 gehabt. Es war wie viele andere aufgrund der Finanzkrise und dem Beben, das auf die Insolvenz der amerikanischen Großbank Lehman Brothers folgte, in Schieflage geraten. Damals hatten Anteilseigner – namentlich der andere Teil seiner Familie – die Bank an einen amerikanischen Investor verkaufen wollen. Lauenburg hatte sich mit aller Macht dagegen gestemmt und seinen Familienzweig sowie den dritten Großinvestor für die weitere Unabhängigkeit des Bankhauses C.P.E Loutre & Cie. AG gewinnen können. Der Bank war es zu diesem Zeitpunkt zwar nicht gut gegangen und der Preis, den der Investor hatte zahlen wollen, war in der damaligen Situation absolut in Ordnung. Aber für Lauenburg war es einfach undenkbar, das Unternehmen, das sich seit mehr als 235 Jahren in Familienbesitz befand, zu veräußern. Daher hatte er mit allen Mitteln verhindern wollen, dass unter seiner Ägide die Geschichte von C.P.E. Loutre & Cie. AG zu Ende ging.
In einer fast sechsmonatigen Abwehrschlacht hatte Lauenburg gegen die Übernahme gekämpft. Am Ende hatten sein Konzept und seine Strategie den dritten Großaktionär, der sich seit der Wirtschaftskrise 1980 bei ihnen engagierte, überzeugt. Dieser war bereit gewesen, seine Aktien zu halten, wodurch eine komplette Übernahme unmöglich und der Erwerb von Anteilen für die Amerikaner uninteressant geworden waren.
Lauenburg war die Auseinandersetzung noch sehr präsent. Zwischenzeitlich war er durchaus der Verzweiflung nahe gewesen, aber er hatte weiter gekämpft. In seinem Job hatte er niemals aufgegeben, auch wenn die Situation aussichtslos schien. Immer hatte er nach vorne geschaut und sich weiter durchgebissen. Er musste lächeln, als ihm bewusst wurde, dass er eigentlich immer am besten war, wenn er mit dem Rücken zur Wand stand.
Sein Lächeln erstarb, als er wieder an seine aktuelle Situation dachte. Seit einigen Tagen, war er wie paralysiert. Seine Sorgen schienen ihn aufzufressen und er war verzweifelt. Er hatte wieder und wieder sein Handeln hinterfragt. Die Folge war: Er hatte sich treiben lassen, statt zu kämpfen.
Lauenburg sah plötzlich klarer und fällte in diesem Moment eine Entscheidung: Er würde sich der Situation stellen und die Fäden – und damit sein Leben – wieder in die Hand nehmen. Zunächst musste er aber schlafen, auch wenn er wegen einer Aufsichtsratssitzung am nächsten Abend schon wieder zurück in Frankfurt sein musste. Er musste zur Ruhe kommen, um wieder klar denken zu können. Und er brauchte Hilfe, hier auf der Insel.
Lauenburg stand auf. Er nahm sein Gepäck, dann ging er festen Schrittes los, um sich am Passeig de Mallorca ein Taxi zu suchen, das ihn zu seinem Hotel an der Plaça Llorenç unweit der Kathedrale von Palma bringen sollte. Währenddessen nahm er sein Smartphone aus der Sakkotasche, öffnete das Adressbuch und suchte nach seinen Kontakten auf Mallorca.