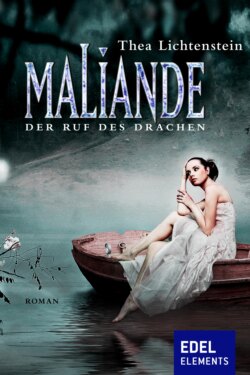Читать книгу Maliande - Der Ruf des Drachen - Thea Lichtenstein - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 1
ОглавлениеDichter Nebel lag im Tal unter Trevorims Pforte. Der Herbst hatte in diesem Jahr früh Einzug gehalten und das Laub dunkel verfärbt. Unter dem steten Regen der letzten Tage bogen sich die langen Arme des Farns, der die Ausläufer des Waldes säumte. An vielen Stellen hatten Hagelkörner Gras und Blattwerk niedergedrückt.
Nahim brachte sein Pferd hinter Vennis’ Tier zum Stehen. Der hagere Mann war bereits abgesessen und streckte sich ausgiebig nach dem langen Ritt.
Rechts von ihnen bot eine Scholle mit schwarz verkohlten Weinreben einen kläglichen Anblick: Obwohl zwischen den Rebenstümpfen das grelle Gelb des Ziegenkrauts wucherte, das sogar neben den Kratern der südlich liegenden Ebene gedieh, lag der Brand wohl erst eine kurze Zeit zurück.
Hoffentlich sind die Reben erst nach der Ernte zerstört worden, dachte Nahim angesichts der guten Lage des Feldes. Seine Familie besaß einige wunderbare Weinberge, weshalb ihn der Anblick besonders schmerzte. Plötzlich jedoch stutzte er. Der Schaden beschränkte sich fast ausschließlich auf dieses Stückchen Erde, während der angrenzende Wald kaum in Mitleidenschaft gezogen war. Brandstiftung, schoss es Nahim durch den Kopf. Aber wer könnte einen Vorteil daraus ziehen, mitten im Nirgendwo Weinreben niederzubrennen?
Ein Zucken ging durch die Zügel in seiner Hand, an denen er ein Pferd hinter dem seinen herführte. Brill, der dritte Mann im Bunde, saß zusammengesunken im Sattel, das Kinn auf die Brust gesenkt. Für einen Moment hob er den Kopf und sah Nahim aus glasigen Augen an. Nahim nickte ihm zu, doch Brill reagierte nicht. Stattdessen fuhr er sich mit dem Mantelärmel über die schweißbedeckte Stirn und ließ den Kopf wieder nach vorn sinken.
»Was denkst du, wie weit ist es noch bis zum nächsten Dorf?«, fragte Nahim und starrte missmutig ins Tal hinab, als Vennis’ Antwort auf sich warten ließ. Doch weiter als einige hundert Meter reichte die Sicht nicht, denn die kalte und dunstige Luft bildete eine Wand, die selbst der starke Nordwestwind, der ihnen unablässig ins Gesicht wehte, nicht aufzulösen vermochte.
Trotzdem schwelgte Nahim im Anblick der herbstlichen Berglandschaft, nachdem sie wochenlang die eintönige und stickige Steppe durchquert hatten. Er genoss es, dass wieder vielfältige Geräusche und Gerüche auf seine Sinne einströmten. Seine Augen folgten Bewegungen im Unterholz und saugten die Spiegelungen in den Pfützen auf, weil sie eine schiere Ewigkeit lang jeglicher Abwechslung beraubt gewesen waren.
Die herbe Luft aus Nordwesten gab Nahim das Gefühl eines Neuanfangs. Zuletzt hatte ihm die Reise durch nicht enden wollendes ockerfarbenes Land zunehmend zu schaffen gemacht. Bilder von der Ebene flammten zum wiederholten Mal auf, und die Erinnerung erzeugte einen staubigen Geschmack in Nahims Mund.
Tag um Tag waren sie durch niedriges Buschwerk und über vor Trockenheit aufgeplatzte Erde geritten. Gelegentlich schob sich der Boden zu einem Krater auf, aus dem übel riechende Dämpfe sickerten. Obwohl man den dringenden Wunsch verspürte, diesen Landstrich so schnell wie möglich hinter sich zu lassen, waren sie nur langsamen Schrittes vorangekommen, damit keins der Pferde versehentlich in eine der von Totenholz bedeckten Bodenspalten trat.
Während der ganzen Zeit sehnte sich Nahim nach klarem Wasser, das in der Ebene jedoch eine Seltenheit war. Stattdessen durften sich die Männer über jedes trübe Wasserloch glücklich schätzen, das sie auf ihrem Weg kreuzten. So manches Mal starrte Nahim ungläubig auf die gelbliche und stinkende Jauche, mit der sie ihre Trinkbeutel auffüllten. Doch Vennis zeigte auf die Spuren von Maderhörnchen und anderen Tieren der Steppe neben der Wasserstelle. »Wenn das Steppenvieh das verträgt, vertragen wir es auch«, sagte er und ignorierte die Leidensmiene des jüngeren Mannes.Aber nicht einmal Vennis wollte sich das Gesicht mit dem schwefelhaltigen Wasser waschen.
Die ferne Gebirgskette, die den gesamten Westen von Rokals Lande überzog, begleitete sie auf ihrem Ritt gen Nordosten wie eine dicke schiefergraue Grenzwand zwischen Ebene und Himmel. Nach einem langen Ritt zeichnete sich endlich ihr nördlichster Ausläufer ab, wobei die Bergwände, die Trevorims Tal umgaben, zunächst durch Dunst verborgen geblieben waren. Doch je näher sie kamen, desto deutlicher traten die schroffen Gebirgskonturen hervor.
Vennis deutete auf eine Einbuchtung am südlichsten Punkt des Bergs, den so genannten Breiten Grat, der verheißungsvoll grünlich schimmerte. Dort würden sie das Gebirge überqueren, die einzige gangbare Stelle in diesem zerklüfteten Meer aus Fels und Schluchten, das sich im Süden einer felsigen Brandung gleich bis zur Küste hin auftürmte.
Während am Horizont die nördlichen Gebirgsumrisse stetig an Form gewannen und die Hufe der Pferde unablässig Staub aufwirbelten, versuchte Nahim, die Zeit mit Tagträumerei totzuschlagen. Aber nicht einmal altbewährte Fantasien konnten ihn fesseln, so dass seine Gedanken ziellos umherschwirrten und eine bislang unbekannte Unzufriedenheit schürten.
Selbst wenn Brill, der ein Stück voranritt, in Plauderstimmung geriet und wilde Abenteuer zum Besten gab, die er als junger Mann gemeistert hatte, verlor Nahim ungewöhnlich schnell das Interesse. Schon nach kurzer Zeit verwandelte sich das unablässige Auf und Ab von Brills markanter Stimme in seinen Ohren in ein monotones Rauschen, übertönt vom gleichbleibenden Hufgetrampel, und Nahim brütete wieder dumpf vor sich hin.
Saßen die drei Männer dann abends um ein Feuer aus knisterndem Totenholz, das mehr Rauch als Wärme verströmte, schnaufte Brill abfällig. Es wollte ihm nicht in den Kopf, dass Nahim sich offensichtlich an keine seiner Geschichten erinnern konnte. Worauf Vennis die beleidigte Miene seines Freundes zum Lachen brachte und sagte: »Ist auch gut so«, so dass Nahim sich mit einem schiefen Lächeln und Schulterzucken aus der Affäre ziehen konnte.
Bei ihrer Reise durch die Ebene entdeckten die Männer Bodenfallen sowie andere Spuren von Orks, bekamen jedoch nie eine der widerwärtigen Kreaturen zu Gesicht. Siskenland nannten die hier heimischen Orks die Ebene. Nahim vermutete, dass sich auch hinter diesem, wie bei jedem anderen ihm bekannten Orkwort, eine hässliche Bedeutung verbarg.
Auf Vennis’ Drängen hin schlugen sie jedes Mal einen Umweg ein, sobald sie Orkbehausungen zu sehen glaubten, auch wenn ihnen jede zusätzliche Wegstunde durch dieses triste Land zuwider war. Und obwohl die Ebene weithin einsehbar war, schienen die Reiter überraschenderweise nicht das Interesse von umherziehenden Orkbanden geweckt zu haben.
Brill erklärte sich die ausbleibenden Schwierigkeiten damit, dass sie bei Tag ritten und Orks nun einmal wie Diebe in der Nacht umherschlichen. Man habe sich wahrscheinlich einfach verfehlt, mutmaßte er. Aber Nahim kam es vielmehr so vor, als würden die Ebenenorks sie regelrecht meiden, worin sie sich sehr von den gewöhnlichen Biestern unterschieden hätten. Was Vennis darüber denken mochte, behielt er, trotz Brills unermüdlichen Fragens, für sich.
Ungeachtet aller Umsicht landeten sie dennoch einmal direkt vor einem Orkstollen, der gleichwohl seit einiger Zeit leer zu stehen schien. Sofort kam es zwischen Brill und Vennis zu einer Auseinandersetzung.
»Es ist doch Blödsinn, sich die Nächte um die Ohren zu schlagen, obwohl weit und breit nicht ein verdammter Ork zu sehen ist!«, dröhnte Brill mit zornesrotem Gesicht. Gleichzeitig versuchte er, einen Stützbalken des niedrigen Stollens mit seinem Stiefel wegzutreten, um den Höhleneingang zum Einsturz zu bringen. »Falls sich tatsächlich ein paar von diesen Dummköpfen hier herumtreiben sollten, dürften wir schon früh genug auf sie aufmerksam werden. Schließlich veranstalten die beim bloßen Versuch, sich unauffällig anzuschleichen, mehr Lärm als eine Horde Betrunkener auf dem Nachhauseweg!«
Vennis lächelte nur beschwichtigend und ließ sich auf keine weiteren Diskussionen ein. Mitten in der Nacht weckte er Brill zur Wache. Dieser schimpfte zwar leise vor sich hin, wickelte sich aber eine Decke um die Schultern und starrte mürrisch in die Dunkelheit. Denn obwohl Brill beinahe im selben Alter wie Vennis war und auch schon so manche gefährliche Reise überstanden hatte, ordnete er sich dessen Entscheidungen unter.
An einem Tag, der sich durch nichts von den vorherigen unterschied, beschloss Nahim, den beiden anderen Männern die Jagd auf Maderhörnchen zu überlassen. Dieses Tier war der ungekrönte König der Ebene, weil ihm vertrocknetes Gras und Gestrüpp schmeckte und es leidenschaftlich gern im festen Erdreich verworrene Stollensysteme anlegte.
Nahim war es leid, stundenlang mit einer ausgerichteten Armbrust auf dem Bauch zu liegen und auf eines der unzähligen Erdlöcher zu zielen, während ihn ein Dutzend Maderhörnchen aus Nebeneingängen beobachtete und wütend anpfiff. Der Jäger hatte nur einen Schuss frei. Denn ganz gleich, ob der Pfeil das Tier niederstreckte oder nicht, so rasch würde sich kein gewitztes Maderhörnchen mehr blicken lassen.
Nach einem missglückten Schuss hatte Brill einmal in einem Wutanfall versucht, einen der Stollen auszuheben. Doch außer Geschnatter in der Tiefe und einer stumpfen Messerklinge hatte es ihm nichts eingebracht.
Nachdem ihr Essen nun schon seit Wochen aus Wurzelstrünken, im gelblichen Wasser aufgekochten Haferflocken und fade schmeckenden Maderhörnchen bestanden hatte, stand Nahim der Sinn eindeutig nach Abwechslung. Vennis’ Rufe ignorierend, schlenderte er zu einem der verkrüppelten Bäume, die gelegentlich die Gleichförmigkeit der Ebene durchbrachen, weil sie sich ein Stück über die kahlen Dornengestrüppe erhoben.
Zu Nahims Erstaunen barg der Baum zwischen fingerlangen Dornen und mit Wachs überzogenen Blättern Trauben von rot glänzenden Beeren. Ohne weiter nachzudenken, streckte Nahim die Hand nach den Beeren aus und steckte sie sich in den Mund. Unter ihrer harten Schale verbarg sich säuerlich-süßes Fruchtfleisch, das in der Nase kitzelte.
Nachdem er den Baum fast vollständig abgeerntet hatte, zog sich Nahims Magen plötzlich schmerzhaft zusammen. Kalter Schweiß brach ihm aus allen Poren, und gerade als er beschloss, möglichst schnell zum Lager zurückzukehren, verkrampfte sich sein Magen erneut, und er musste sich übergegeben. Verunsichert blickte Nahim auf den rotweißen Schaum vor seinen Füßen, dann wurde ihm schummerig, und er ließ sich auf seinen Hintern fallen. Als Vennis und Brill kurze Zeit später zu ihm stießen, hatte sich Nahims Magen nur leidlich beruhigt, und eine Vielzahl scheußlich juckender Pusteln überzog Gesicht, Hände und Körperstellen, die er lieber nicht benennen wollte. Bei seinem Anblick wäre Brill, von einer Lachattacke geschüttelt, fast vom Sattel geglitten. Aber Vennis begann mit finsterer Miene, seinem Pferd das Zaumzeug abzunehmen. Ein deutliches Zeichen dafür, dass sie den Rest des Tages hier lagern würden.
»Ein mit leuchtend roten Früchten beladener Baum in dieser kargen Gegend, und du stopfst dich gedankenlos voll«, schimpfte er in einem ungewohnt scharfen Ton. »Man könnte meinen, dass du in den letzten Jahren nichts dazugelernt hast! Warum, glaubst du wohl, meiden sämtliche Viecher diese Leckerbissen?«
Einige Tage später, als es Nahim wieder besser ging, erreichten die Männer den Ausläufer des Gebirges. Dort begrüßte sie ein schmaler Fluss. Obwohl das Wasser eiskalt war und ein scharfer Wind am Breiten Grat entlangzog, nahmen die Männer begeistert ein Bad. Auf allen vieren hockend, tauchte Brill seinen Kopf unter, um eine Fontaine Wasser in die Höhe zu spucken, während funkelnde Tropfen von seinem roten Haar perlten.
Gegen Nachmittag gewann der Wind an Stärke und jagte Wolkenberge über die hohen Bergketten des Westens. Als dann Regen losbrach, freuten sich die Männer zunächst, aber schon bald waren sie bis auf die Knochen durchnässt, weil der Wind den Regen bis unter die Buche trieb, unter der sie Zuflucht gesucht hatten.
In der darauffolgenden Nacht ließ der Regen zwar nach, aber der eisige Nordwestwind begleitete sie weiterhin bei ihrem Aufstieg zum Kamm des Breiten Grats. Unablässig pfiff er durch ihre klamme Kleidung und ließ die Hände, die das Zaumzeug hielten, schmerzhaft steif werden. Brills Augen liefen rot an, und er legte sich eine Decke um die Schultern, obwohl sie ihn beim Reiten behinderte. Dass es nicht gut um ihn bestellt war, wurde Nahim erst bewusst, nachdem Brill seit einigen Wegstunden schon keine Zote und kein Trinklied mehr von sich gegeben hatte. Als der rothaarige Mann anfing, auf dem Weg zurückzubleiben, zeigte auch Vennis’ Gesicht Sorge. Schließlich verließen sie den schmalen Pfad, der am spärlich begrünten Grat entlangführte, und ritten zwischen Wald und Wiesen in Richtung Tal hinab. Sie kamen an einigen Almen vorbei, die um diese Jahreszeit jedoch bereits verlassen waren. Weit und breit war kein Mensch zu sehen.
Als Vennis nun verdrossen auf die Reste des verbrannten Weinfelds starrte und gelegentlich mit der Stiefelspitze in der Erde herumscharrte, wurde Nahim zunehmend nervöser. Hinter sich hörte er Brills raschelnden Atem. In ihm keimte allmählich der Verdacht, dass ein geheimer Ruf alle Menschen und Orks von ihren Höfen und Stollen weggelockt habe und sie nun die einzigen sprechenden Lebewesen im Umkreis von vielen Meilen waren.
»Ich kann schwer einschätzen, wie weit es noch bis ins Tal hinab ist«, antwortete Vennis schließlich. Nahim zuckte zusammen, weil er seine Frage schon längst vergessen hatte. »Ich kenne das Tal unter Trevorims Pforte auch nur von vagen Landkarten und aus Maherinds Erzählungen, der es vor langer Zeit einmal durchreist hat. Offensichtlich unter besseren Bedingungen, denn seine Erzählungen klangen nach einer vergnüglichen Wanderung und nicht nach Wind, Nebel und Regen.«
In Nahims Gesicht war keine Regung auszumachen. Ohne ein weiteres Wort abzuwarten, trieb der junge Mann sein Pferd an.
Balam Trubur pflügte seit den späten Morgenstunden ein Feld, das viele Jahre lang brachgelegen hatte, und warf dabei gelegentlich einen Blick auf seinen Sohn Tevils. Der Junge würde im Neujahr dreizehn Jahre alt werden und überragte schon jetzt seinen Vater an Größe. Tevils leuchtend braune Haare standen, trotz der dunstigen Luft, wirr zu Berge, und die schmalen Lippen waren fest aufeinandergepresst. Genau wie Bienem beim Bohnenputzen, dachte Balam mürrisch. In den letzten Monaten hatte Balam immer wieder feststellen müssen, dass sich die Gemeinsamkeiten zwischen Mutter und Sohn nicht in solchen Kleinigkeiten erschöpften.
Erst vor einigen Tagen hatte Tevils zum wiederholten Male die Befürchtungen seines Vaters bestätigt: Er hatte einen Handkarren, auf dem zwischen Stroh Weinflaschen gebettet lagen, nicht, wie verabredet, auf dem Hof seines Cousins Lasse abgeliefert. Stattdessen hatte der Junge einige feuchtfröhliche Tage bei einer Gruppe Ziegenhirten verbracht, die ihm im betrunkenen Zustand das Präparieren von Tierfallen beibringen wollten. Dass Tevils noch alle Finger sein Eigen nannte, grenzte an ein Wunder. Tevils Mutter war ebenso eine große Verfechterin jeder Art von Vergnügungen und hatte für Balams Beharren auf Verbindlichkeit lediglich ein Schulterzucken übrig.
Während Balam so seinen trüben Gedanken nachhing, suchte Tevils geschäftig nach den letzten Pilzen des Jahres auf den anliegenden Wiesen. Dass sein Vater das Mittagessen schweigend eingenommen hatte, war Tevils nicht weiter aufgefallen. Noch immer war er hypnotisiert von den Geschichten, die die Ziegenhirten zum Besten gegeben hatten. Ganz deutlich konnte er sich selbst sehen, lediglich in ein Fell gehüllt und mit einem Stock bewaffnet. Im Dämmerlicht trat der König der Wölfe aus seiner Höhle heraus und forderte ihn mit einem überheblichen Knurren zum Kampf heraus. Dass der Wolfskönig offensichtlich nicht zwischen Beute und Jäger unterscheiden konnte, sollte ihm nun zum Verhängnis werden ...
Als Balam die drei Reiter bemerkte, die über den dunstigen Hang kamen, konnte er bereits deutlich ihre Umrisse erkennen. Und etwas stach ihm sofort ins Auge: Zumindest einer der Reiter trug ein Schwert an seiner Seite. Ohne lange zu überlegen, rammte Balam den Pflug in die Erde, so dass dem alten Ochsen ein überraschtes Schnaufen entfuhr. Er rief laut nach Tevils, während er zu dem Rastplatz lief, wo er seinen grob gehauenen Wanderstock zurückgelassen hatte.
In dem Moment, als Balam den Pflug niederlegte, setzte der Bewaffnete zu einem leichten Galopp an und kam auf ihn zugeritten. Aus den Augenwinkeln nahm Balam wahr, dass sein Sohn über die Wiese auf ihn zulief. »Tevils, geh zu den Bäumen und bleib da«, schrie Balam den Jungen an. »Na los, tu endlich, was ich dir sage!«
Doch Tevils blieb einfach stehen und starrte in einer Mischung aus Furcht und Neugier die Fremden an. Einer von ihnen war von seinem großen Reittier abgestiegen und ging das letzte Stück zu Fuß auf seinen Vater zu. Dabei spreizte der Fremde die Arme vom Körper ab, um seine friedlichen Absichten zu betonen. Trotzdem stieß Balam den Wanderstab in die aufgeschwemmte Erde und baute sich mit gespreizten Beinen dahinter auf.
»Nun«, sagte Balam. »Mein Name ist Trubur, und dies hier ist mein Land. Wer seid Ihr? Und warum reitet Ihr auf ihm entlang?«
»Wir kommen über die Südlichen Höhen und wollen ins Tal«, antwortete der Fremde mit einer gepressten Stimme.
Balam biss die Zähne fest aufeinander, als der Fremde drei Schritte vor ihm stehen blieb. Der Mann war fast zwei Köpfe größer als er, und an seiner Seite schwang bei jedem Schritt die Scheide eines langen Schwertes mit. Das dunkle Haar und die olivfarbene Haut waren für das Tal genauso ungewöhnlich wie die markanten Gesichtszüge. Etwas im Gesicht des Fremden zuckte auf, und er warf einen flüchtigen Blick zu seinen beiden Begleitern, die sich bislang nicht weiter gerührt hatten.
»Warum seid Ihr dann nicht dem Weg gefolgt, der vom Pass hinunter ins Tal führt? Ihr müsst doch an der Quelle vorbeigekommen sein, wo er beginnt. Ist schließlich nicht zu übersehen«, hakte Balam nach.
»Das stimmt«, gab der Fremde zu. »Aber einer meiner Freunde ist auf der Reise erkrankt, und wir haben stattdessen den Weg zu Frau Witt eingeschlagen, der vom Pass wegführt. Allerdings haben wir ihre Hütte niedergebrannt vorgefunden.«
Balam atmete aus, dann trat er neben seinen Stab. »Ihr kennt Frau Witt?«
Der Mann nickte bekräftigend.
»Nun, Frau Witt ist ins Tal zu ihrer Enkelin gezogen. Die Südlichen Höhen sind nicht mehr sicher für eine alte Frau. Außerdem hatte man von ihrer Hütte aus einen guten Blick über den gesamten Hang. In unserer heutigen Zeit ist es nicht unbedingt von Vorteil, immer zu wissen, wer alles unterwegs ist.« Als Balam Ungeduld in den Augen des Fremden aufflackern sah, setzte er hastig hinzu: »Was hat Euer Freund denn?«
»Der Regen hat uns vor einigen Tagen am Fuß des Breiten Grats überrascht, und seitdem steigt das Fieber unaufhörlich. Ist es weit bis zum nächsten Dorf?«
Nachdenklich zupfte sich Balam am Ohrläppchen. Erneut musterte er den Mann vor sich: Das lange Haar und der Bart, die sonderliche Kleidung, aber vor allem die Anwesenheit von Schwert und Pferden trafen bei Balam auf den Argwohn eines Hangbauern, der die Einsamkeit gewohnt war. Letztendlich jedoch gewann seine Gutmütigkeit die Oberhand, für die er sich schon so manches Mal selbst gescholten hatte.
»Böses Fieber, sagt Ihr? Nun, ins Westend sind es über drei Stunden von hier, wenn man gut zu Fuß ist und den Kletterpfad kennt. Allerdings werdet Ihr mit den Pferden wohl einen Umweg nehmen müssen, so dass es mindestens doppelt so lange dauern wird.«
Wie auf ein geheimes Zeichen hin setzten sich die beiden anderen Reiter in ihre Richtung in Trab. Balam konnte sehen, dass der eine Mann tief vornübergebeugt im Sattel saß, während der andere sein Pferd führte. Plötzlich erklang hinter Balams Rücken ein leiser Schrei, und er musste verärgert feststellen, dass Tevils noch immer in der Mitte der Wiese stand.
Der Fremde nickte Balam flüchtig zum Dank zu und wollte gerade zu seinem Pferd zurückkehren, als der Bauer ihn am Ärmel fasste. »Mein Hof liegt gleich dort unten hinter dem Eibenwald. Eine meiner Töchter hat Heilkunde bei Frau Witt gelernt. Viele Leute aus dem Tal hier tun das, weil die meisten Höfe sehr einsam liegen. Vielleicht kann sie Eurem Freund helfen?«
Die Gesichtszüge des Mannes entspannten sich ein wenig, und er fragte: »Könnt Ihr reiten?«
»Nein«, antwortete Balam. »Aber Ihr könnt meinen Sohn Tevils mit aufsitzen lassen. Er wird Euch den Weg zu unserem Haus zeigen und meiner Tochter Lehen alles erklären. Schließlich hat er die ganze Zeit über bei uns gestanden, anstatt zu den Bäumen zu gehen, wie es sein Vater ihm gesagt hat.«
Balam warf dem immer noch versteinerten Tevils einen Blick zu, woraufhin dieser herbeieilte und sich von dem Anführer auf das große Pferd helfen ließ. Der Mann saß hinter dem Jungen auf, und sofort sprengten sie über die Heuwiese hinweg auf die Bäume zu.
Überrascht stellte Lehen fest, dass Borif draußen auf dem Hof bellte. Aber es war kein kurzes Bellen, mit dem er für gewöhnlich Tevils und den Vater begrüßte. Das Bellen klang dumpf, als ob der Nebel, der sich den ganzen Tag über zwischen den Bäumen gehalten hatte, es nicht tragen wollte. Nachdem es noch einige weitere Male erschallt war, stellte Lehen die Teigschüssel beiseite und lief mit mehlbestäubten Händen hinaus.
Der Hof lag verlassen da. Der milchige Dunst hatte sich wie ein Schleier über alle Farben und Geräusche gelegt. Nur von den Ställen drangen dumpfes Scharren und Gackern herüber. Lehen pfiff nach ihrem Hund, doch Borif war nirgends zu sehen. Sie pfiff noch einmal einen hellen melodiösen Ton, doch es ließ sich kein Hund mit wild wedelndem Schwanz blicken.
Wind fegte über den Hof. Er brachte Nässe und den ungewöhnlichen Geruch von Salz mit sich. Lehen zog die Stola fest um ihre Schultern, als Lärm vom nebeligen Weg her erklang, der in den Wald hineinführte. Plötzlich erschien eine Gruppe Reiter zwischen den Bäumen, und Lehen sah, wie der massige Borif neben einem der Pferde herlief und es vollkommen fasziniert ankläffte.
Ohne ein Wort des Grußes saß der vorderste Reiter ab und half ihrem jüngeren Bruder Tevils beim Abstieg, der ihr, übers ganze Gesicht strahlend, zuwinkte. Während Lehen auf die merkwürdige Gruppe zuschritt und überlegte, wo wohl ihr Vater war, glitt einer der Reiter von seinem Tier. Die beiden anderen Männer griffen ihm unter die Arme und schleifen ihn ins Haus. Dort legten sie ihn auf das Bett ihrer Eltern in der Nähe des Ofens. Lehen brauchte nur kurz in das Gesicht des halb bewusstlosen Mannes zu blicken, und sie wusste, dass dieser innerlich brannte.
Nachdem die beiden Fremden geholfen hatten, den Kranken in das Haus zu tragen, brachten sie ihre Pferde notdürftig im Stall unter und blieben dann auf Lehens Wunsch draußen auf dem Hof. Während der Ältere sich ganz und gar seiner Pfeife widmete, strich der jüngere Mann über Borifs dichtes, kurzes Fell. Der Hund quittierte die Streicheleinheiten mit einem tiefen Seufzen.
Lauthals schimpfend, setzte Lehen auch ihren Bruder vor die Tür: »Stellst du dich absichtlich so dumm an? Egal, was man dir sagt, du machst es verkehrt. Du bist ein elender Tollpatsch, Tevils Trubur! Du kannst von Glück sagen, dass ich zu beschäftigt bin, um dich mir richtig vorzunehmen.«
Tevils schüttelte die Schimpftiraden wie eine Gans das Wasser ab und gesellte sich zu den beiden Männern. Da er sich nicht traute, eine der unzähligen Fragen zu stellen, die ihm durch den Kopf schossen, versuchte er, das Schweigen mit einer Kostprobe seiner Jonglierkünste zu brechen. Als Tevils anstelle von Applaus nur schräges Grinsen und Kopfnicken erntete, verzog er sich enttäuscht zu den Pferden in den Stall.
Da es im ganzen Tal bis auf einige wenige Kaltblüter nur Esel und Ochsen als Lasttiere gab, erschien Tevils die Gegenwart der schönen Tiere fast genauso reizvoll wie die der abenteuerlich aussehenden Fremden. Zudem konnte er sich bei den Pferden rasch beliebt machen, indem er sie mit Maiskolben fütterte, die eigentlich zum Trocknen unters Dach gehängt worden waren.
Borif hatte bald genug von den Streicheleinheiten und schleppte ein Wurfholz an, das er seinem neuen Freund mit einem unüberhörbaren Grunzen auf den Schoß spuckte. Derart charmant aufgefordert, warf der Mann das Stück Holz quer über den Hof und rannte dem grobschlächtigen Rüden hinterher, um es ihm wieder abzunehmen. Als beide von ihrer wilden Jagd ganz außer Atem waren, hockte sich der junge Mann neben Borif, der das Holzstück genüsslich in seine Einzelteile zerlegte, auf den Boden und schaute sich in Ruhe um.
Dem Trubur Hof ging es sichtlich gut. Die Wände des Hauses bestanden aus einem Geflecht aus Holzbalken und Lehm, das sorgfältig mit heller Farbe getüncht worden war. Das große Fenster auf der Frontseite setzte sich aus verschiedenfarbigen Glastücken zusammen, die ein von Weinreben umranktes Fass zeigten. Jemand hatte das Bild einem Mosaik gleich zusammengesetzt und mit Blei eingefasst. Auch die Eingangstür aus harter Schiefereibe wies handwerkliches Geschick auf: Kunstvoll war eine stilisierte Eibe hineingeschnitzt, und die Rillen waren mit rötlichem Ocker nachgezogen worden. Vor dem Haus stand eine ebenfalls verzierte Holzbank neben den bereits winterfest gemachten Blumenbeeten. Die Sträucher und Stauden waren sorgfältig zurückgeschnitten und die Rosenstöcke mit Stroh ummantelt worden.
Im Westen wurde der Hof durch lang gezogene Stallungen, Schuppen und den Waldsaum umrandet. Auf der anderen Seite bildete ein reißender Gebirgsfluss die Grenze. In den Fluss ragte ein schmaler Steg hinein, der im Sommer wahrscheinlich malerisch von den ausladenden Ästen einer Kastanie überschattet wurde. Weiter aufwärts säumten nun teils kahle, teils mit Wintergemüse bepflanzte Beete sowie mehrere Obstbäume das Ufer. Außerdem folgte dem Fluss ein breiter Weg, der ins Tal hinabführte.
Dem Hof der Truburs wohnte eine alte Ordnung inne, alles war wohlgestaltet und liebevoll gepflegt. Doch in die friedvollen Gedanken des jungen Mannes mischte sich das Bild eines verbrannten Weinfelds und der alten Frau Witt, die jemand gewaltsam aus ihrer Hütte verjagt hatte. Das dürfte nicht allzu leicht gewesen sein, mutmaßte er. Den verkohlten Resten und dem mittlerweile verwilderten Garten nach hatte dort Jahrzehnte lang jemand gelebt, der mit seiner Umgebung verschmolzen war und sie entsprechend geprägt hatte. Sicherlich hat diese Frau Witt ihr Zuhause nicht kampflos aufgegeben, schloss er seine Überlegungen mit einem mulmigen Gefühl.
Kurz nachdem Balam mit dem alten Ochsen am Strick über den Waldweg auf dem Hof eingekehrt war, rief Lehen die Männer ins Haus. Während Tevils Geschirr, Tee und schließlich eine Schüssel mit Kohlsuppe auf den Tisch stellte, erzählte Lehen von dem Zustand des Mannes, dessen Namen sie noch immer nicht kannte.
»Sein Hals ist fast ganz zugeschwollen und schlimm vereitert. Es ist kaum möglich gewesen, ihm etwas einzuflößen. Das linke Ohr ist ebenfalls böse entzündet, und das Fieber steigt stetig. Er ist sehr erschöpft und scheint seit einigen Tagen viel zu wenig getrunken zu haben.« Mitten in ihrer Rede hielt sie inne und warf ihrem Vater einen verunsicherten Blick zu, bevor sie weitersprach. »Außerdem habe ich mehrere Narben unterschiedlichen Alters gefunden. Eine besonders tiefe Schnittwunde am rechten Oberschenkel würde ich auf ungefähr sechs bis acht Wochen schätzen. Wer immer sie behandelt hat, wusste genau, was er tat.«
Keiner der Männer sagte etwas, und Lehen ließ ihren Blick über die beiden Fremden wandern, die ihr direkt gegenübersaßen. Groß und hager waren sie, dunkle Augen, dichte Bärte und dunkles Haar, das der Jüngere von ihnen nachlässig im Nacken zusammengebunden hatte. Der kranke Mann hingegen war von bulliger Statur und trug das kupferfarbene Haar kurz geschnitten, so wie es auch bei den Männern im Tal üblich war.
Lehen überlegte, ob die beiden Männer vor ihr am Tisch wohl miteinander verwandt waren. Vielleicht Vater und Sohn? Obwohl sie in ihrem Äußeren und in der zurückhaltenden Art einander ähnelten, so war sie sich letztendlich doch nicht sicher. Etwas unterschied diese beiden Männer voneinander, etwas, das Lehen nicht in Worte fassen konnte. Während der Ältere lediglich ihre Neugierde weckte, brachte der Jüngere etwas in ihr zum Klingen, als sei sie ein Musikinstrument, das von ihm berührt worden war. Der Gedanke hatte so etwas Irritierendes an sich, dass Lehen das Blut in die Wangen schoss. Plötzlich schaute der Jüngere ihr direkt in die Augen. Dunkle Augen wie zwei Kohlestücke – so etwas hatte sie noch nie zuvor gesehen. Verwirrt wandte Lehen den Blick ab.
Er hatte ein Schwert über den Rücken gegürtet getragen, dessen Griff mit einem breiten Lederband umwickelt war. Die Schwerter der Männer sowie zwei Wurfbeile und eine kurze Lanze lagen nun, in eine alte Decke gewickelt, unter der Bank vorm Haus. In einem Gespräch unter vier Augen hatte Balam Tevils eindringlich verboten, auch nur einen Zipfel der Decke zu lüften. Lehen war ebenfalls nicht wohl beim Gedanken an die Waffen. Sie schienen ihr wie unheimliche Boten aus einem fremden Reich.
»Wann denkst du, wird er wieder reiten können?«, wurde Lehen von dem älteren der beiden Männer gefragt.
»Das kann ich nicht genau sagen.« Lehen rührte in ihrer mittlerweile kalten Suppe herum. »Außerdem stellt sich zunächst einmal die Frage, ob er die Krankheit überleben wird. Aber auch das kann ich nicht beantworten. So gut kenne ich mich mit solchen Dingen nicht aus.«
Der Ältere blickte verdrossen zum Krankenlager hinüber, auf dem sich der rothaarige Mann, unter einem Berg von Decken und Ziegenfellen begraben, seit langem nicht mehr gerührt hatte. Schließlich sagte er: »Wir müssen Trevorims Pforte durchqueren, bevor der Winter sie schließt.«
»Nun, Herr Wie-auch-immer«, entgegnete Balam gereizt. »Es mag sein, dass der Winter es dieses Jahr besonders eilig hat, aber Euer Freund wird wohl seine Zeit brauchen. Anders zu denken, wäre dumm. Und wenn Ihr nicht ohne ihn reiten wollt, dann werdet Ihr wahrscheinlich bis zum Frühjahr hierbleiben müssen. So sieht das aus, Herr Sonstwie!«
Balam Truburs Reaktion hatte dem jungen Mann ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Auch der Ältere schmunzelte, griff in den Beutel zu seinen Füßen und holte einen Weinschlauch hervor. Während er mit dessen Resten die Gläser füllte, rutschte dem jungen Mann beim Anblick des Weins eine leise Verwünschung heraus. Dieser Beutel hätte die Ewigkeit in der Ebene gewiss verkürzt.
»Nun, so oder so, Herr Trubur. Mein Name ist Vennis, das hier neben mir ist Nahim, und unser kranker Freund heißt Brill. Wir können nicht ohne ihn reiten, da Nahim und ich lediglich sein Begleitschutz sind. Es wird uns also nichts anderes übrig bleiben, als auf Eure Gastfreundschaft zu hoffen und Frau Witt als Leumund anzugeben. Wenn sie hört, dass wir im Auftrag Maherinds reiten, wird sie das sicherlich gerne tun.«
Balam nahm ein wenig unsicher das Glas entgegen, sah auf die tiefrote und samtene Flüssigkeit und dachte wehmütig an sein verbranntes Weinfeld am oberen Hang. Dieses Jahr würden nur wenige neue Fässer verheißungsvoll im Kellerschacht unter seinem Haus darauf warten, dass ihr Herr sie zu Festen im Westend und auf den Brennburger Markt bringen würde. Er hob das Glas und sah seine Tochter an. Die anderen taten es ihm gleich, und Lehen stand auf und sagte ein wenig verhalten: »Auf den Wein und auf das Leben.«