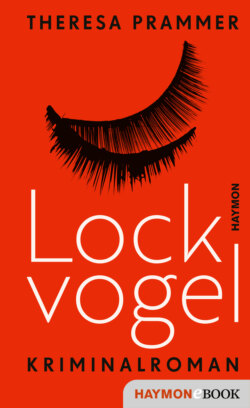Читать книгу Lockvogel - Theresa Prammer - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
Оглавление„Augen schließen. Mit dem nächsten Ausatmen stellt euch vor: Ihr fließt in die Matte, auf der ihr liegt. Jede Zelle eures Körpers löst sich auf. Haltet nichts zurück. Wenn Gefühle hochkommen, lasst sie raus. Seid laut. Gebt euch hin.“
Als hätten alle nur auf ein Kommando gewartet, ging das Stöhnen los. Jammern, Klagen, Seufzen. Es hörte sich nach einer Mischung aus Gruppensex und Begräbnis an.
Toni stieß ein halbherziges „Ohhh“ aus, während sie zur Uhr über der Tür blinzelte. Der Termin bei dem Privatdetektiv war erst in zwei Stunden, trotzdem hatte sie dieses drängende Gefühl, sie könnte ihn verpassen. Und das durfte sie auf keinen Fall.
„Die Uhrzeit ist egal, Antonia. Loslassen“, bellte die Schmitz. Sie war die Leiterin der Schauspielschule und eine gute Lehrerin, aber wehe, jemand hielt sich nicht an ihre Anweisungen. Und Toni stand durch ihre vielen Fehlstunden der letzten vier Wochen sowieso schon auf der schwarzen Liste.
Lena auf der Matte rechts neben ihr stieß ein leises Grunzen aus – ihr Geheimcode. Lena sagte immer, wenn die Schmitz wütend wurde, hatte sie was von einem wildgewordenen Eber.
Toni unterdrückte ein Lachen und schloss rasch die Augen. Sie nahm einen tiefen Atemzug und versuchte, sich in Erinnerung zu rufen, was sie dem Detektiv alles sagen wollte. Und da passierte es.
Obwohl Felix bereits einen Monat fort war, konnte sie ihn vor sich lächeln sehen. Als hätte er ein Trugbild in ihrem Gedächtnis hinterlassen.
Wie dieses Jesus-Sehtestbild aus dem Internet, von dem Lena so begeistert war. Das man nur lange genug ansehen muss, damit es wieder auftaucht, wenn man auf einen hellen Untergrund sieht. Felix strahlte sie über das ganze Gesicht an. Dieses erste Lächeln, das sie buchstäblich und entsetzlich kitschig ins Herz getroffen hatte, obwohl sie von sich selber wirklich niemals als Romantikerin sprechen würde. Mit den kleinen Fältchen, die sich wie Astgabeln um seine Augen kräuselten, den rosigen Lippen im dunklen Dreitagebart. Wie Himbeeren und Schokolade.
Vor neun Monaten, als er im Café gesessen hatte, über den Laptop gebeugt, hatte sie es zum ersten Mal gesehen. Er war vertieft in seine Arbeit und zusammengezuckt, als sie ihn gefragt hatte, was er trinken wollte.
„Hast du mich erschreckt“, hatte er gesagt, sie angesehen und im nächsten Moment gestrahlt. Als wäre sie jemand, auf den er schon sehr lange wartete.
„Sorry. Soll ich wieder gehen und noch mal kommen?“
Sein leuchtendes Gesicht mit den zu einer stummen Frage hochgezogenen Augenbrauen wirkte auf sie wie ein Schaufenster zu Weihnachten für ein Kind. „Dann wärst du vorbereitet.“ Sie trat einen Schritt Richtung Theke.
„Nein, danke.“ Sein noch breiteres Lächeln, während er eine Hand auf sein Herz legte. „Jetzt ist der Schaden schon angerichtet.“ Gespieltes Keuchen. „Darf ich den Namen meiner Beinahe-Killerin erfahren?“
„Toni.“
Wieder sein fragender Blick.
„Von Antonia.“
Normalerweise sagte sie das nicht dazu. Ihr Herz flatterte, während er sie länger ansah, als die Gäste es normalerweise taten. Und sie fing an zu grinsen, sie konnte gar nichts dagegen tun.
„Danke. Ich bin Felix. Von Felix.“
„Und was möchte Felix von Felix auf diesen Schreck trinken?“
„Was empfiehlt Toni von Antonia mir denn?“
Noch am selben Abend hatten sie sich verabredet. Danach war alles sehr schnell gegangen, als hätte es schon einen vorgefertigten Felix-und-Toni-Plan gegeben, den sie nur noch erfüllen mussten.
Das letzte Mal, als sie ihn gesehen hatte, war er am Morgen vor vier Wochen in der Tür gestanden, in seinen grünen Boxershorts und dem ausgeleierten weißen T-Shirt. Die dunklen Haare ganz zerzaust. Sie war zu spät zum Dramatikunterricht, konnte wie üblich weder Handy noch Schlüssel finden. Er hatte ihr beides in die Hand gedrückt und nachgerufen, dass sie nicht zu viel lernen sollte. Sie hatte sich umgedreht und gegrinst. Weil seine Verführungskünste an diesem Morgen der Grund waren, warum sie es jetzt so eilig hatte.
Natürlich hatte sie keine Ahnung gehabt, dass es das letzte Mal sein sollte. Das letzte Mal Sex, das letzte Mal Felix, das letzte Mal, dass sie ausreichend Geld hatte und sich keine finanziellen Sorgen machen musste.
Ihr Gedankenkarussell fing an, sich zu drehen.
Hatte sie etwas übersehen? Nein, es war unmöglich, dass alles von Anfang an sein Plan gewesen war. Und seine ganze Zuneigung nur vorgespielt. Es musste etwas anderes sein. War er in ernsthaften Schwierigkeiten? War er irgendwo und brauchte ihre Hilfe?
Vielleicht war das der Grund, warum sie sich seit einiger Zeit verfolgt fühlte. Und kein „Hirngespinst“, wie Lena das immer nannte, weil sie nie jemanden entdecken konnte, wenn Toni sie darauf aufmerksam machte.
Ein Schluchzen neben sich riss Toni aus den Gedanken, auf die sie sowieso keine Antwort hatte. Es war Lena. Und es klang nicht nach einem Stöhnen, sondern als würde sie weinen.
Toni drehte sich zur Seite, Lenas rote Locken lagen quer über ihrem Gesicht, ihr Oberkörper bebte. So vorsichtig, dass es die Schmitz nicht sehen konnte, tippte Toni ihre Freundin an. Lena drehte den Kopf zu ihr, die Tränen hatten ihre Wimperntusche verschmiert. Sie formte Worte mit ihren Lippen, doch Toni konnte nicht erkennen, was sie sagen wollte.
„Was ist –“, begann Toni leise, da donnerte die Schmitz bereits: „RUHE! KEINE INTERAKTION. SONST FLIEGST DU RAUS, ANTONIA. UND DU WEISST, WAS DAS FÜR DICH BEDEUTET!“
Lena presste die Lippen zusammen, schüttelte leicht den Kopf und schloss die Augen wieder.
War irgendwas passiert? Etwas, das Toni nicht mitbekommen hatte, weil sie so mit sich, Felix, ihrer Großmutter und den Geldsorgen beschäftigt gewesen war?
„DU AUCH, LENA!“
Das war beunruhigend. Lena war immer gut drauf, nichts schien sie wirklich zu erschüttern. Und sie weinte noch immer, Toni konnte es ganz deutlich hören.
Sie wartete, bis sich die Schritte der Schmitz entfernten, und schob ihren Arm in Lenas Richtung, bis sie ihre Hand spürte. Tonis Finger glitten zwischen die ihrer Freundin und hielten sie fest.
„SO, DAS WAR’S, ANTONIA. DU VERLÄSST DEN UNTERRICHT!“, schrie die Schmitz. „RAUS!“
Eine dreiviertel Stunde später stieg Toni aus der U4 und lief Richtung Auhofstraße. Sie war ein wenig zu früh dran, was fast schon eine Ironie war, denn Toni litt an „Zuspätkommeritis“, wie sie selbst diagnostiziert hatte. Eine Kindergartengruppe in Zweierreihe kam ihr aufgeregt entgegen. Sie schnappte die Worte „Zoo“ und „riesiges Löwenkacka“ auf und musste grinsen, als die Kinder die Ausmaße des Haufens in großen Gesten darstellten, während ihre Betreuer die Augen verdrehten. In der Schauspielschule hätte es für so eine Szene Applaus gegeben.
Toni zwinkerte den Kindern zu, die an ihr vorbeigingen. Die Sonne brannte, sie hatte sich eindeutig zu warm angezogen und schlüpfte aus der Jeansjacke.
Es war nur ein winzig kleiner Moment, in dem sie sich umgedreht hatte. Aus den Augenwinkeln sah sie jemanden in einem schwarzen Sweatshirt. Eine große Gestalt mit einer Sonnenbrille und einer in die Stirn gezogenen schwarzen Kappe, unter der blonde Haare hervorlugten. Der Mann hatte irgendwas in der Hand – vielleicht ein Handy oder einen Fotoapparat –, das in Tonis Richtung zeigte. Eines der Kinder vor ihr quietschte, deutete in Richtung Kanaldeckel, in dem gerade der Schwanz einer Ratte verschwand. Toni war kurz abgelenkt. Sofort sah sie wieder zurück. Der Mann war verschwunden.
Ihr wurde heiß. War er ihr gefolgt? Hatte sie beobachtet? Wieso sollte ein fremder Mann Fotos von ihr machen?
„Schau mal, es ist kein Wunder, nach dem, was dir passiert ist“, hatte Lena erst letztens gesagt, als sich ein Verdacht wieder als unbegründet herausgestellt hatte. „Vielleicht sucht dein Unterbewusstsein einen Ausweg, um die Wahrheit nicht akzeptieren zu müssen. Hast du überhaupt irgendwann mal durchgeschlafen, seit –?“
Weiter hatte Lena nicht sprechen müssen, denn Toni hatte bereits den Kopf geschüttelt. Wegen „seit“ war sie nun hier, weil sich seit „seit“ alles geändert hatte. Die Müdigkeit der vergangenen Wochen steckte ihr in den Knochen. Letzte Nacht hatte sie noch weniger geschlafen als sonst. Blendete sie all ihre Sorgen aus, dann musste das eben ein Tourist gewesen sein, Schönbrunn war schließlich ganz in der Nähe. Trotzdem drehte Toni sich auf dem Weg noch ein paar Mal um, ganz plötzlich, als wäre ihr etwas eingefallen, das sie vergessen hatte. Doch außer einer alten Frau, die erschrocken zusammenzuckte, war niemand hinter ihr.
Und dann war sie am Ziel.
Das Gebäude sah herrschaftlich aus. Roter Backstein, hohe Fenster, zwei Treppen, die zum Rundbogen-Eingang führten. Toni war so nervös, dass sie beim Überqueren erst in der Mitte der Straße überprüfte, ob ein Auto kam.
Auf dem Schild der Detektei war das „3. Stock“ durchgestrichen, stattdessen war mit Edding ein Pfeil gemalt und darunter stand „Innenhof, 1. Stock“.
Dort befand sich ein weiteres Haus, baufällig und schäbig. Als hätte man es hier hinten versteckt, weil es so erbärmlich aussah. Es schien nachträglich errichtet worden zu sein, wahrscheinlich in den Fünfzigerjahren. Abgebröckeltes, graues Mauerwerk. Alte Fenster mit abgesplitterten Holzrahmen. Im Erdgeschoss ein paar eingeschlagene Scheiben, die notdürftig mit Karton zugeklebt waren. Eine dreifarbige Katze schlich an der Mauer entlang und verschwand um die Ecke.
Als Toni das Haus betrat, stach ihr eine Mischung aus Urin und Verwesung in die Nase. Neben der Tür im schmalen Korridor des ersten Stocks stapelten sich Akten wie schiefe Türme an den Wänden entlang.
„Hallo?“
„Hinter der braunen Tür. Kommen Sie rein“, antwortete eine knarrende Stimme.
Wahrscheinlich war das Fernsehen daran schuld, dass sich Tonis Vorstellungen eines Privatdetektivs in mit Klischees gespickten Superlativen bewegten. Athletisch, damit er jede Verfolgungsjagd zu Fuß aufnehmen konnte. Durchtrainiert, damit ihm nie die Kondition ausging. Und attraktiv, damit alle Frauen, die wegen ihres untreuen Ehemanns seine Dienste in Anspruch nahmen, in seinen starken Armen Trost fanden. Mit Abweichungen nach unten und oben hatte sie gerechnet. Aber nicht mit diesem mürrisch dreinblickenden Mann, der hinter dem mit Akten und Papieren vollbepackten Schreibtisch saß.
Dem auffallend hübschen antiken Schreibtisch. Mit Marmorplatte, goldenen Löwenköpfen an den Ecken und kunstvoll geschwungenen Tischbeinen mit Goldmuster. Hinter ihm an der Wand stand eine längliche schwarzlackierte Kommode mit eingelassenen goldenen, blauen und roten Vögeln. Toni sah sich um.
Das kleine Büro war vollgestopft mit diesen goldverzierten Schränken, einem Sekretär aus rötlich scheinendem Holz mit unzähligen kleinen Perlmuttladen, etwas, das aussah wie ein mit Blättern aus Porzellan dekorierter Schminktisch.
Da waren Beistelltische mit weißen Marmorplatten, eine hellblaue Chaiselongue mit goldenen Fransen. Alle Möbel wahrscheinlich aus der Kaiserzeit. Sogar ein riesiger Stuhl mit rotem Samtbezug und Goldrahmen stand im Büro, wie ein Thron. Als hätte er Schönbrunn geplündert. Jedes Möbelstück musste ein Vermögen wert sein – wenn es denn echt war. Und auch hier waren jede Menge Aktenordner, sie türmten sich neben den Möbeln. Der Detektiv musste sein gesamtes Hab und Gut aus einem wohl größeren Büro im dritten Stock in diese viel zu kleine Kammer hier übersiedelt haben.
„Was kann ich für Sie tun?“, fragte er. Obwohl Toni sonst ziemlich gut darin war, das Alter von jemandem zu schätzen, konnte sie bei ihm nicht sagen, wie alt er war.
„Sind Sie der Privatdetektiv?“
Er zog die Mundwinkel hoch zu einem Grinsen. Seine erstaunlich blauen Augen lachten nicht.
„Auf jeden Fall bin ich nicht die Vorzimmerdame. Treten Sie bitte ein.“
Ein elegant geschwungener Scheitel teilte sein silbergraues Haar. Dazu hatte er eine dieser halben Lesebrillen, über deren oberen Rand er sie prüfend ansah. Sofort fühlte sie sich ins Gymnasium zurückversetzt. Als wäre sie erneut in die Direktion gerufen worden: Toni war schon wieder frech.
Der Aschenbecher mit einer nicht angezündeten Zigarette am Tisch passte allerdings nicht ins Bild – in der Schule hatte striktes Rauchverbot geherrscht.
Der Detektiv kratzte sich am Kinn, schob ein paar Zettel vor sich herum, schien jedoch nicht zu finden, was er suchte. Obwohl er saß, konnte sie erkennen, dass er groß sein musste. In der Armbeuge seines weißen Hemds war ein rötlicher Fleck zu sehen.
„Wir haben einen Termin, ich bin Toni Lorenz.“
Sie trat zum Schreibtisch, schüttelte ihm die Hand. Ein warmer, fester Händedruck.
„Brehm. Sie können stehen oder sitzen, wie Sie möchten. Was kann ich für Sie tun?“
Die Chaiselongue war voll mit Akten, darum nahm sie auf dem Thron Platz. Sonnenlicht beleuchtete das Fenster hinter ihm, es war dreckverschmiert.
Wie sollte sie anfangen? Auf der Suche nach den richtigen Worten fiel ihr Blick auf ein Foto, das auf seinem Schreibtisch unter einem kleinen Stapel hervorlugte. Zwei junge Männer, Polizisten in Uniform, die Daumen in den Gürtelschnallen.
„Sind Sie das auf dem Foto?“
Er folgte ihrem Blick.
„Nein.“
Er schob es in den Stapel zurück.
„Die ersten fünfzehn Minuten Beratung sind kostenlos, danach rechne ich im Dreißig-Minuten-Takt ab. Worum geht es?“
Toni verstand den Hinweis: Brehm war nicht an Small Talk interessiert.
„Es ist kompliziert …“
Er lehnte sich in seinen Stuhl zurück, nahm die Brille ab und kaute an einem Bügel herum.
„Komplizierte Fälle sind mein Spezialgebiet.“
Sie musste lächeln.
„Das klingt wie Detektivjargon.“
„Worum es auch immer geht – unabhängig, ob der Auftrag zustande kommt oder nicht –, es bleibt alles unter uns.“
Sie nickte, ihre Hände fingen leicht an zu zittern.
Er sah sie erwartungsvoll an. Irgendwie hatte sie sich das einfacher vorgestellt. War es wirklich die richtige Idee, einen Privatdetektiv miteinzubeziehen? Aber was sollte sie sonst tun? Sich selbst belügen, alles wäre nur ein Missverständnis und Felix würde in Kürze wieder zu Hause auf sie warten, mit seinen Gnocchi mit Thunfischsauce, das Einzige, was er richtig gut kochen konnte? Und in der Zwischenzeit, wie wollte sie da für ihre Großmutter die Seniorenresidenz in Baden bezahlen? Geschweige denn ihre eigenen Kosten decken?
Der Detektiv räusperte sich. Ein dezenter Hinweis, dass die Uhr tickte. Fünf, vier, drei, zwei, eins – los.
Toni wollte gerade ansetzen, da war ein lautes Miauen zu hören. Es kam aus dem Gang vor der Tür. Gefolgt von einem Kratzen. Brehm sah sie unbeirrt an. Das Miauen wurde ein Jammern. Schmerzvoll und durchdringend.
„Da war eine Katze, ich hab sie beim Reingehen gesehen“, sagte Toni und deutete zur Tür. Brehm seufzte, er hob die Hand, als wollte er abwinken, doch ein neues Wehklagen drang von draußen herein.
„Entschuldigen Sie mich bitte kurz.“
Er stand angestrengt auf, so wie jemand, der sehr, sehr müde ist und ebenfalls nächtelang nicht geschlafen hatte. Schwerfällig schlurfte er zur Tür. Als hätte er Gewichte an den Beinen. Toni konnte sich nicht vorstellen, dass Brehm eine Verfolgung auch nur fünf Meter schaffen würde. Aber wahrscheinlich arbeiteten Detektive nicht alleine, und er war nur für die Büroangelegenheiten zuständig. Das hoffte sie zumindest.
Vor der Tür saß die Katze von vorhin und sah mit erwartungsvollem Blick zu Brehm hoch.
„Es tut mir leid, ich hab nichts für dich“, flüsterte er mit einer Mischung aus Freundlichkeit und Genervtheit. „Morgen. Versprochen.“
Die Katze miaute. Es klang wie ein Protest.
„Ich weiß. Vielleicht findest du eine Maus.“
Sie miaute noch lauter. Toni holte die halb volle Packung Chips aus der Tasche, stand auf und ging zu den beiden.
„Hier. Vielleicht mag sie was davon? Ist zwar nicht gesund, aber ich hatte mal eine Katze, die war ganz wild drauf.“
Brehms Blick auf die Chips wirkte so sehnsüchtig wie der von Lena, wenn sie diesen neuen Superman-Darsteller sah. Jetzt wo sie neben ihm stand, wirkte er wie ein Riese.
Er nickte, griff in die Packung, beugte sich runter und wollte ein Stück vom Kartoffelchip abbrechen. Doch die Katze stürzte sich sofort darauf, als hätte sie tagelang gehungert.
„Ist das Ihre?“, fragte Toni.
„Nein, ich geb ihm nur manchmal was.“
„Ihm? Hat er einen Namen?“
Brehm sah sie überrascht an.
„Kater.“
„Kater?“ Toni lächelte. „Wie in ‚Frühstück bei Tiffany‘?“ Das war der Lieblingsfilm ihrer Großmutter. Dutzende Male hatten sie ihn gemeinsam gesehen, Toni konnte ganze Szenen auswendig. Vielleicht war sie hier doch an der richtigen Adresse.
Brehm aber verzog nur den Mund, ohne zu antworten, gab ihr die Packung zurück und schloss die Tür. Genauso müde schlurfte er zurück zum Schreibtisch, und auch Toni nahm wieder Platz. Wusste er gar nicht, was „Frühstück bei Tiffany“ war? Oder war das nur wieder ein Hinweis, dass sie sich beeilen sollte?
„Wo waren wir gerade?“, fragte er.
„Mein Freund ist verschwunden, Felix Meier.“
Sie hatte es schnell hinter sich gebracht, wie ein Pflaster, das man herunterreißt. Brehm schien nicht sonderlich überrascht. Wahrscheinlich hörte er solche Geschichten öfter.
„Wann?“
„Vor einem Monat. Wir wohnen seit fast einem Jahr zusammen. Am Morgen hab ich mich von ihm verabschiedet, und als ich wieder nach Hause gekommen bin, war er weg.“
„Was genau meinen Sie mit verschwunden?“
„Er ist weggegangen und nicht mehr wiedergekommen.“
„Ein Unfall oder dergleichen ist ausgeschlossen?“
Sie nickte, versuchte, nicht an die Nachricht auf dem Küchentisch zu denken, die sie nicht verstanden hatte. Es tut mir leid, hatte er geschrieben, nichts weiter. Als hätte er nur vergessen, Milch zu kaufen oder den Müll runterzubringen. Sie hatte zwei Tiefkühlpizzen in den Ofen geschoben, eine Flasche Weißwein eingekühlt, war duschen gegangen. Erst als sie in ihrem Bademantel auf der Couch saß und er noch immer nicht da war, rief sie ihn an. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ihr wurde mulmig, wenn sie daran dachte, ihr Puls beschleunigte sich.
„Er hat seine Sachen mitgenommen und …“ – Ihr Kinn zitterte. Sie würde nicht wieder weinen, auf keinen Fall. – „… und er hat meine Bankomatkarte mitgenommen. Alles abgehoben. Auch alle Schmuckstücke meiner Großmutter, die ich für sie aufbewahre, sind weg. Und er hat den Safe leergeräumt.“
Es hörte sich noch immer an wie ein Fehler. Als würden diese Worte und Felix gar nicht zusammenpassen.
„Wo befindet sich der Safe?“
„Zu Hause. Er ist in der Wohnung meiner Großmutter, sie hat ihn wegen der Wirtschaftskrise vor ein paar Jahren in die Wand einbauen lassen. Sie dachte, das Geld wäre sicherer in den eigenen vier Wänden.“
Brehm machte sich Notizen.
„Welche Summe?“
„Alles zusammen etwa dreihundertachtzigtausend Euro.“ Sie sah das deutliche Zucken in Brehms Gesicht. Gleich würde er sie fragen, ob sie allen Ernstes diese Summe bei sich zu Hause aufbewahrt hatte.
„Wie viel der Schmuck wert ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, es muss viel sein“, sagte sie rasch. Der ist eine Wertanlage, hatte Oma immer gesagt. Und darauf bestanden, den Schmuck bei Toni zu lassen, statt ihn in die noble Seniorenresidenz in Baden bei Wien mitzunehmen. Die Toni bald nicht mehr zahlen konnte. Aber davon wusste Oma natürlich nichts. Toni spürte, wie ihre Augen sich mit Tränen füllen wollten, und kniff sich in die Zeigefingerkuppe, um nicht zu heulen.
„Haben Sie und Ihre Großmutter Anzeige erstattet?“
„Nein. Wir wohnen nicht mehr zusammen. Sie ist vor zwei Jahren ausgezogen.“
„Wegen Ihrem Freund?“
„Was? Nein, nein, den gab es damals noch gar nicht. Die Wohnung ist im vierten Stock ohne Lift, und es wurde ihr zu beschwerlich.“
Das war nur die halbe Wahrheit. Sie hätten genauso gut gemeinsam umziehen können. Doch Oma brauchte nach einem Sturz immer mehr Hilfe und wollte weder Toni ein Klotz am Bein sein noch eine Pflegerin anstellen, die sie herumkutschierte. „Wie sieht das denn aus, wenn mich dann so eine Matrone zu meinen Rendezvous geleitet?“, hatte sie gesagt, sich ihre weißen hochgesteckten Haare zurechtgezupft, den perlmuttfarbenen Lippenstift nachgezogen und ihr kehliges Lachen ausgestoßen. „Nein, da suche ich mir lieber gleich ein hübsches Plätzchen mit ein paar anständigen Witwern.“
Es war alles geplant: Toni sollte ihr aus den Ersparnissen monatlich eine Art Taschengeld überweisen, für Friseur, Kosmetikerin, Bücher – Oma verschlang Krimis geradezu – und Konditorei- und Casinobesuche. Außerdem zahlte sie die Miete der Wohneinheit in der Residenz. Auf keinen Fall wollte Oma dem Heim die Finanzen offenlegen. – „Das kennt man doch, dann krallen die sich alles, und wir sehen keinen Cent mehr.“
Es gab nur noch sie beide, und so war es ihr wichtig, ihre Enkelin gut versorgt zu wissen. „Meine liebe Toni, du bist ein junges Vogerl und sollst fliegen und dich nicht um mich alten Adler kümmern“, hatte sie bei ihrem Auszug gesagt. Sie hatten beide geheult.
Zu Beginn war es Toni schwergefallen. Sie liebte ihre Großmutter, und obwohl sie in den ersten zwei Tagen das Gefühl der Freiheit genoss, folgte eine dunkle, einsame Phase. Doch ihrer Großmutter schien es in der Seniorenresidenz wirklich zu gefallen. Sie blühte auf. Und das half Toni loszulassen. Nach den Startschwierigkeiten war sie geflogen. Freunde, Partys, Schauspielschule, die große Liebe. Und dann diese Bruchlandung. Ja, es war die richtige Entscheidung gewesen hierherzukommen.
„Was macht er beruflich?“, fragte Brehm.
„Homepages. Layouts, die man dann kaufen kann.“
Felix war mit seinem MacBook verwachsen gewesen, als wäre es seine dritte Hand.
„Und haben Sie das alles bei der Polizei gemeldet?“
Sie schüttelte den Kopf.
„Ich wollte nur eine Vermisstenanzeige aufgeben, aber der Beamte meinte, es hat in diesem …“, sie machte Gänsefüßchen in die Luft, „… Ich-hole-nur-mal-Zigaretten-Fall wenig Sinn.“
„Warum haben Sie nichts von dem Diebstahl gesagt?“
Toni zuckte mit den Achseln. Nicht, weil sie es dem Detektiv nicht sagen wollte. Sondern sie zweifelte daran, dass er es verstehen würde.
Brehm hob eine Augenbraue, schürzte die Lippen, als würde er auf eine Erklärung warten. Er lehnte sich in seinen Stuhl zurück und verschränkte die Finger.
„Sie hoffen, dass sich alles als Missverständnis rausstellt? Oder Ihr Freund sich in Schwierigkeiten befindet, und deshalb wollen Sie ihm nicht noch mehr Ärger bereiten?“
Sie senkte den Blick – überrascht, wie sehr er ins Schwarze getroffen hatte.
„Auch wenn ich ihn anzeige, was sollte das bringen? Die Polizei hat sicher Wichtigeres zu tun, als ihn zu suchen.“ Sie merkte selbst, wie wenig überzeugend es klang.
Natürlich war das eine Ausrede. Aber es ging nicht nur um Felix. Erstattete sie Anzeige, würde ihre Großmutter davon erfahren. Und die Residenz. Toni wollte sich nicht ausmalen, wie die Leitung auf finanzielle Nöte reagieren würde. Und ihre Großmutter spielte dort mit Freundinnen Canasta und Schnapsen, sie war die „Grande Dame“ mit mehreren Verehrern, die sie zum Tanzen und in den Park zum Flanieren ausführten.
Toni war zu ihrer Oma gekommen, da war sie gerade mal vier Jahre alt gewesen. Sie war nicht nur bei ihr aufgewachsen, sondern ihre Oma hatte sich um Toni gekümmert, als wäre sie ihre eigene Tochter.
„Und Sie wollen nun, dass ich Herrn …“
„Felix Meier.“
„Dass ich ihn finde und dabei das übliche amtliche Prozedere übergangen wird, damit Sie ohne viel Aufhebens Geld und Schmuck wiederbekommen.“
Sie zuckte zurück, verknotete ihre Finger ineinander. Das klang so einfach.
„Und ich will wissen, warum“, sagte Toni.
Brehm setzte an, um etwas zu erwidern, doch ein lautes Grummeln erfüllte plötzlich den Raum. Wie ein kleiner Bär, der sich aus einer der Schreibtischschubladen meldete und befreit werden wollte. War das der Kater? Hatte er sich hereingeschlichen? Brehm sah sie etwas verspannt an.
„Eine Ahnung, wo Herr Meier sich aufhalten könnte?“, fragte er rasch.
„Nein, aber ich glaube nicht, dass er sehr weit weg ist.“
„Weil …?“
Sie wusste nicht, was sie darauf sagen sollte. „Sei nicht so naiv“, hatte Lena gesagt, „nur weil du es dir nicht vorstellen kannst, dass er einfach so abgehauen ist.“
Der kleine Bär meldete sich erneut.
„War das wieder der Kater?“
„Pardon.“ Brehm hielt sich den Bauch, es sah aus, als wollte er ihn einziehen. „Das … ich bin auf Diät.“
Darum also sein Blick auf die Chips. Sie nahm die Packung wieder aus der Tasche, dazu noch einen Marsriegel und ein Päckchen Erdnüsse und hielt dem Detektiv die Snacks entgehen.
„Ich hab immer was dabei, suchen Sie sich was aus.“
Sein Bauch grummelte wieder, er schien zu zögern.
„Oder wollen Sie lieber die?“ Toni holte Schokorosinen hervor. Brehm hob die Augenbrauen. „Ich müsste auch noch irgendwo Pistazien haben“, sagte sie.
Er sah sie fragend an. Oder war das ein Lächeln, das er unterdrückte? Sie würde sich nicht dafür rechtfertigen, dass sie immer einen beachtlichen Vorrat mit sich herumschleppte. „Wo isst du das alles hin?“, war eine Frage, die sie seit ihrer Kindheit kannte und schon nicht mehr hören konnte.
Fast glaubte sie, er würde etwas annehmen, doch dann schüttelte er den Kopf.
„Danke, nein. Ich benötige noch einige Informationen, aber wenn Sie möchten, nehme ich Ihren Auftrag an. Und, ach ja, es gibt nur Fixpreise, kein Erfolgshonorar.“
Er sagte es so, als hätte sie etwas gewonnen, kramte in einer Schublade und reichte ihr eine mehrseitige Vertragsvereinbarung.
„Wie lange dauert das normalerweise?“, fragte sie.
„Kann ich noch nicht sagen.“ Brehm senkte seine Stimme, ein leiser Seufzer folgte. „Ich muss Sie vorwarnen, das kann emotional sehr belastend werden …“
Sie hörte ihm gar nicht mehr zu, als sie die Honorarauflistung sah. Das war zu viel Geld. Viel zu viel. Er schien es an ihrem Blick zu bemerken.
„Ich verstehe, dass Sie im Moment in einer finanziellen Notlage sind. Wenn Sie möchten, legen wir eine Pauschale fest“, sagte er etwas sanfter. „Was halten Sie von zweitausendfünfhundert Euro, Steuer extra? Sollte ich unter der Stundenanzahl bleiben, die diese Summe rechtfertigen würde, rechnen wir stundenweise ab. Ist es darüber, gilt die Pauschale.“
Sie schob ihm den Vertrag zurück. Lena hatte gesagt, er sei günstiger als die anderen. Was auch stimmte. Aber sie hätte sich seine Preisliste vorher selbst ansehen sollen.
„Ich habe im Moment nicht so viel Geld zur Verfügung. Aber wenn Sie Felix gefunden haben, dann …“
Er schüttelte den Kopf, noch ehe sie den Satz beendet hatte, und verschränkte die Finger über seinem Bauch, der wie auf Kommando wieder grummelte.
„Es tut mir leid, Ihnen das zu sagen, aber Sie müssen davon ausgehen, dass er Ihr Geld nicht mehr hat. Wieso kommen Sie eigentlich erst jetzt?“
„Wie bitte?“
„Ihr Freund ist vor einem Monat verschwunden, haben Sie gesagt. Warum erst jetzt?“
„Ich habe selbst versucht, ihn zu finden, aber –“, begann sie, doch in diesem Moment klopfte es an der Tür.