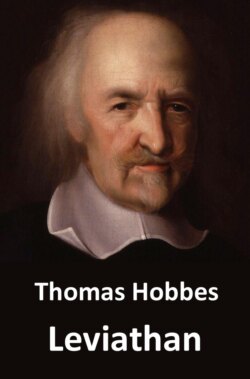Читать книгу Leviathan | Deutsche Übersetzung der Original-Ausgabe von 1651 - Thomas Hobbes - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Kapitel: Von der Rede
ОглавлениеDie Erfindung der Buchdruckerkunst macht dem menschlichen Verstande zwar Ehre, doch verliert sie sehr, wenn man sie mit der Erfindung der Buchstaben vergleicht. Wer letztere erfunden hat, ist unbekannt. Kadmos, der Sohn des phönizischen Königs Agenor, soll sie zuerst nach Griechenland gebracht haben. Diese Erfindung pflanzt das Andenken vergangener Zeiten fort und verbindet das Menschengeschlecht, so sehr es auch durch so viele und weit entlegene Erdgegenden getrennt wird; diese Erfindung war aber nicht leicht, denn sie setzte eine sorgfältige Beobachtung der Bewegungen der Zunge, des Gaumens, der Lippen und anderer Sprachwerkzeuge voraus, deren Mannigfaltigkeit auch ebensoviele mannigfaltige Zeichen nötig machte. Von einem ungleich größeren Wert und Nutzen ist aber die Rede , welche aus Namen oder Benennungen und deren Verbindung besteht, wodurch unsere Gedanken schriftlich verfaßt, ins Gedächtnis zurückgerufen und anderen mitgeteilt werden können, so daß man sich damit gesellschaftlich unterhält und wechselseitig nützlich wird. Ohne sie fänden unter den Menschen, Gemeinwesen, Gesellschaft, Vertrag, Frieden eben so wenig statt wie unter Löwen, Bären und Wölfen. Adam bediente sich zuerst der Rede, da er den Geschöpfen, welche Gott zu ihm brachte, ihre Namen gab. Mehr sagt die Schrift uns hiervon nicht; doch war es auch für jene Zeiten hinreichend, denn er konnte auf eben die Art anderen Dingen andere Namen geben, je nachdem es die Erfahrung und die Benutzung der Geschöpfe notwendig machten. Um sich verständlich zu machen, konnte er nach und nach diese Namen zusammensetzen, und so wurde mit der Zeit der Reichtum der Sprache nach Maßgabe des Bedürfnisses groß genug; freilich bedarf der Redner oder der Philosoph mehr. Aus dem, was die Schrift davon sagt, kann man auf keine Weise, weder geradezu, noch durch eine Folgerung schließen, daß Adam den fast unzähligen Figuren, Zahlen, Maßen, Farben, Tönen, Begriffen, Verhältnissen auch Namen gegeben habe; noch weniger solchen Sachen und Gegenständen der Rede, wie z.B. allgemein, besonders, bejahend, verneinend, wünschend, unbestimmt, welches übrigens doch einigen Nutzen gewährt; zuverlässig aber hat er nicht solche Worte, wie z.B. Dinglichkeit (Entitatem), Bedeutung (Intentionalitatem), Wesenheit (Quidditatem) erfunden, deren sich die Scholastiker bedienen, ohne sich jedoch etwas dabei zu denken.
Dieser ganze Reichtum aber, er sei nun von Adam oder seinen Nachkommen erfunden oder erweitert worden, ging bei dem Babylonischen Turmbau, wo Gott die Menschen ihrer Empörung halber sämtlich mit Vergessenheit strafte, völlig verloren. Da sie nun gezwungen waren, sich in verschiedene Gegenden zu zerstreuen, so mußten die nachherigen vielen Sprachen unter ihnen allmählich entstehen, wie das Bedürfnis, die Mutter aller Erfindungen, sie darauf hinführte. Und auf die Art ist mit der Zeit eine jede Sprache ansehnlich bereichert worden.
Durch die Sprache übertragen wir — und das ist ihr eigentlicher Gebrauch —, was wir denken, oder unsere Gedankenfolge, in Worte oder in eine Reihe von Worten. Hierbei kann ein doppelter Zweck stattfinden: der eine ist, was wir denken, niederzuschreiben, damit wir uns dessen, wenn es uns entfallen sollte, durch Hilfe der niedergeschriebenen Worte wieder erinnern können. Hierdurch sollen sie also ein Hilfsmittel des Gedächtnisses werden.
Der andere Zweck aber tritt dann ein, wenn mehrere derselben Sprache kundig sind, und besteht darin, daß, vermöge der Ordnung und des Zusammenhangs einer dem anderen seine Begriffe und Gedanken, Wünsche, Besorgnisse usw. darstellen kann. In dieser Hinsicht werden Worte Zeichen genannt. Eingeschränkter sind folgende Arten des Gebrauchs: erstens, daß die Ursachen der vergangenen oder gegenwärtigen Dinge, die wir durch Nachdenken ausfindig gemacht haben, oder die möglichen Folgen der gegenwärtigen und vergangenen Dinge niedergeschrieben werden, und hieraus entspringen die Künste. Zweitens, daß wir unsere erworbenen Kenntnisse anderen durch Rat und Unterricht darlegen; drittens, daß wir zur gegenseitigen Unterstützung unsere Anschläge und Absichten einander bekannt machen; viertens können wir auch zuweilen auf eine erlaubte Weise Vergnügungen erwecken und gefallen wollen.
Ebenso vielfach kann man auch die Sprache mißbrauchen; nämlich erstens, wenn man wegen der schwankenden Bedeutung seiner Worte, seine Gedanken widersinnig aufsetzt. Wenn man z.B. statt desjenigen, was man gedacht hat, etwas setzt, was man nicht gedacht hatte, und so sich selbst hintergeht. Zweitens, wenn man die Worte figürlich, d.h. in einem anderen als gewöhnlichen Sinne gebraucht und so andere betrügt. Drittens, wenn man durch Worte eine Absicht zu haben vorgibt, die man nicht hat. Viertens, wenn man dadurch seinem Mitmenschen schadet. Den Tieren hat die Natur Waffen gegeben, einigen Zähne, anderen Hörner; dem Menschen aber seine Hände, damit jedes derselben seinem Feind wehe tun könne. Aber mit der Zunge wehtun, ist ein Mißbrauch der Sprache, es wäre denn, wir müßten jemanden zurechtweisen. Das ist aber kein Wehtun, sondern Ändern und Bessern.
Die Art, wie die Sprache dem Gedächtnis in Ansehung der Folgerungen zu Hilfe kommt, besteht darin, daß man Namen macht und dieselben verbindet.
Einige Namen sind eigentümlich und bezeichnen eine einzelne Sache, z.B. Peter, Johann, dieser Mensch, dieser Baum; andere aber sind mehreren gemein, z.B. Mensch, Pferd, Baum; denn wenn auch ein jedes von diesen allemal ein einzelnes ist, so kommt doch die Benennung mehreren dieser Art zu. In Rücksicht auf alle diese Einzelnen heißt sie eine allgemeine Benennung. Außer den Benennungen gibt es in der Welt nichts, das allgemein wäre. Die mit Namen belegten Dinge sind alle Individuen und einzelne Dinge.
Mehrere Dinge werden mit einer einzigen allgemeinen Benennung belegt, weil sie sich in dieser oder jener Eigenschaft oder Beschaffenheit ähneln.
So wie also eine eigentümliche Benennung nur an eine gewisse Sache erinnert, so erinnert eine allgemeine an eine jede unter vielen.
Die allgemeinen Benennungen haben zum Teil eine weitumfassendere, z.T. eine engere Bedeutung, so daß die weitumfassendere die engere in sich schließt. andere hingegen haben einen gleichen Umfang und sind wechselweise ineinander enthalten. Das Wort Mensch z.B. begreift das Wort Körper in sich, und noch etwas mehr; aber die Worte Mensch und vernünftig sagen gleich viel und sind ineinander enthalten. Ich merke hier an: unter Benennung versteht man nicht immer wie die Grammatiker ein einziges Wort, sondern oftmals eine weitläufigere Umschreibung, z.B. folgende Umschreibung: wer seiner Oberen Beschlüsse, wer Gesetze und Rechte beachtet, sagt nicht mehr, als das einzige, gleichviel bedeutende Wort: ein Gerechter.
Durch den Gebrauch dieser Benennungen von weiterer und engerer Bedeutung drücken wir das, was wir uns bei den Folgerungen denken, durch Worte aus. Wenn z.B. ein Taub- und Stummgeborener, der folglich ganz sprachlos ist, ein Dreieck sieht und neben diesem zwei rechte Winkel, wie immer sie in einem Viereck sind, so kann er leicht durch Nachdenken, Betrachten und Vergleichen finden, daß die Summe der drei Winkel des Dreiecks der Summe der beiden daneben liegenden rechten Winkel gleich ist. Wenn aber ein anderer, der sprechen kann, bemerkt, daß diese Gleichheit sich gründe, nicht auf die Länge der Seiten, noch auf sonst etwas im Dreieck, sondern auf den Umstand, daß die Seiten gerade und der Winkel nur drei sind, weshalb auch die Figur ein Dreieck heißt, so behauptet er kühn den allgemeinen Satz: die drei Winkel eines Dreiecks zusammen sind so groß wie zwei rechte Winkel. Und so wird eine bei einem einzelnen Fall herausgebrachte Folgerung als eine allgemeine Regel niedergeschrieben und aufbewahrt, und die Rückerinnerung an dieselbe macht ein abermaliges Nachdenken auf immer unnötig, überhebt uns aller ferneren Anstrengung und läßt das, was wir zu einer Zeit und in einem Fall wahr fanden, als eine ausgemachte Wahrheit für immer und überall anerkennen.
Wie nützlich die Worte beim Niederschreiben der Gedanken sind, wird bei den Zahlen am deutlichsten. Ein Mensch von äußerst schwachen Verstandeskräften ist nicht fähig, die Zahlwörter eins, zwei, drei nach ihrer Ordnung auswendig herzusagen; doch kann er die verschiedenen Schläge der Uhr bemerken und mit Kopfnicken sagen: eins, eins, eins; wie viel es aber geschlagen, weiß er nicht. Wahrscheinlich hat es aber einmal eine Zeit gegeben, wo man noch wenige Zahlwörter hatte und man beim Zählen die Finger der einen Hand zuerst und hernach die von beiden Händen zu Hilfe nahm. Dies ist wohl auch die Ursache davon, daß die Zahlwörter bei fast allen Völkern nicht über zehn hinausgehen, ja bei einigen es nur deren fünf gibt, wo sie dann wieder anfangen. Wer auch wirklich zehn Zahlwörter hat, muß sie dennoch nach der Ordnung folgen lassen, wenn er bis zehn zählen, um so mehr aber, wenn er zusammenzählen oder abziehen und andere arithmetische Operationen vornehmen will. Bei den Zahlen können wir folglich der Wörter nicht entbehren, noch weniger bei den Größen, den Graden der Geschwindigkeit, den Kräften und bei mehreren Dingen, die dem Menschengeschlecht nötig oder doch nützlich sind.
Wenn zwei Wörter nebeneinander gesetzt werden, so daß es eine Bejahung oder Folgerung sein soll, wie wenn wir sagen: der Mensch ist ein Tier , oder was ein Mensch ist, ist auch ein Tier , und das letztere Wort Tier alles das in sich faßt, was das erstere Wort Mensch hier sagen will, so ist diese Bejahung oder Folgerung wahr , sonst aber falsch . Denn wahr und falsch sind nicht Eigenschaften der Dinge, sondern der Rede. Außer der Rede gibt es weder Wahres noch Falsches, wohl aber einen Irrtum, wenn wir z.B. etwas erwarten, was nicht kommen wird, oder etwas vermuten, was nicht dagewesen ist; der Begriff des Falschen kann hierbei indes nicht stattfinden.
Weil nur die Wahrheit in der richtigen Zusammensetzung der Worte, womit wir etwas bejahen wollen, besteht, so muß der Wahrheitsfreund sich der Bedeutung seiner jedesmaligen Worte bewußt sein und sie regelmäßig ordnen; sonst wird er sich ebenso verwickeln wie ein Vogel, der sich auf der Leimrute desto fester anklebt, je emsiger er sich davon losmachen will. Deshalb macht man in der Geometrie, die vielleicht die einzige gründliche Wissenschaft ist, den Anfang des Unterrichts damit, daß man die Bedeutung der dabei zu gebrauchenden Wörter genau bestimmt, das heißt mit anderen Worten: man schickt die Definition derselben voran.
Hierin liegt auch der Grund, warum die, welche nach wahrer Wissenschaft streben, die Erklärungen älterer Lehrer untersuchen, auch wohl oft sich ganz neue schaffen müssen. Denn mit einem jeden Fortschritt in einer Wissenschaft mehren sich auch die durch die Erklärungen veranlaßten Irrtümer; man stößt unvermerkt auf widersinnige Folgerungen, aus denen man sich doch nicht herauswickeln kann, gesetzt man sehe sie auch, es sei denn man müßte bis zur ersten Quelle des Irrtums zurückgehen. Wer daher dem Lehrer zu sehr auf sein Wort traut, gleicht dem, der viele kleine Summen, ohne sich von der Richtigkeit derselben hinlänglich überzeugt zu haben, in eine große Summe zusammenzieht. Sieht man, ohne an der Richtigkeit der erlernten Grundsätze zu zweifeln, seinen Irrtum endlich ein, so weiß man sich auf keine Weise zu helfen und verschwendet mit vergeblichem Durchblättern großer Werke die Zeit. So geht's auch dem Vogel, der durch den Kamin in ein Zimmer geraten ist, sich eingesperrt sieht, den vorigen Weg nicht wieder finden kann und fruchtlos gegen das täuschende helle Fenster flattert. Bei Erlernung wissenschaftlicher Kenntnisse zeigt sich also einer der vorzüglichsten Vorteile der Rede darin, daß man die Worte richtig definiert, sowie hingegen einer der wichtigsten Nachteile darin besteht, daß man entweder falsche, oder gar keine Definitionen festsetzt. Dies ist die Quelle der falschen und vernunftwidrigen philosophischen Sätze, durch welche diejenigen, die nicht durch eigenes Nachdenken, sondern sich durch bloßes Bücherlesen unterrichten wollen, bei ihrer Unwissenheit gewöhnlich um so schlechter wegkommen, als im Gegenteil andere allemal bei gründlicher Einsicht besser fahren. Unwissenheit liegt zwischen gründlicher Wissenschaft und irriger Lehre mittendrin. Die Sinne und die Vorstellungen erzeugen durch sich selbst keine Irrtümer: die Natur ist des Irrtums unfähig. Je ausgebreiteter aber der Gebrauch ist, den jemand von der Rede machen kann, desto mehr wird er sich vom Pöbel unterscheiden und entweder weiser oder törichter sein. Ohne Beihilfe der Wissenschaften wird schwerlich jemand ausgesprochen weise oder auch töricht werden; es müßte denn sein, daß im letzteren Fall ein ursprünglich fehlerhafter oder durch Kränklichkeit geschwächter Verstand bei ihm zugrunde liegt. Kluge gebrauchen die Worte wie Rechenpfennige, wobei sie lernen wollen. Toren aber sehen sie als wirkliche Münze an, die sie nach dem Wert desjenigen Mannes schätzen, dessen Bild und Überschrift sie führt, er sei nun Aristoteles, oder Cicero, oder Thomas von Aquin, oder jeder andere große Gelehrte.
Mit Worten wird alles das bezeichnet, was gedacht oder vernünftig erwogen, oder auch, um ein Ganzes zu bilden, zu anderem addiert oder subtrahiert werden kann. Im Lateinischen beißen Rechnungen »rationes«, und die Ausrechnung selbst »ratiocinatio«; was wir aber gewöhnlich in Rechnungen unter „ ferner “ (Item) verstehen, nennen sie »nomen«. Und so ist das Wort „ratio“ auf alle und jede Arbeit des Verstandes ausgedehnt worden. Das griechische Wort „Logos“ bedeutet beides, sowohl Rede als Vernunft; womit man gewiß nicht sagen wollte, daß jede Rede mit Vernunft, sondern vielmehr daß allemal Vernunft mit Rede verbunden sei. Das Werk des vernünftigen Denkers aber führte den Namen Schluß (syllogismos) d. i. die Verbindung der Folge eines Satzes mit einem anderen.
Weil indes einerlei Dinge oft verschiedener Nebenumstände wegen in Betrachtung gezogen werden, so pflegt man, um diese Verschiedenheit auszudrücken, die Worte dazu auch verschiedentlich abzuändern und umzuschaffen. Die Verschiedenheit der Worte kann unter vier Hauptgattungen gebracht werden.
Zuerst kann etwas in Betracht gezogen werden als Materie oder Körper, z.B. lebendig, empfindbar, vernünftig, warm, kalt, bewegt, ruhig, welches alles Materie oder Körper andeutet.
Zweitens kann etwas in Betracht gezogen werden wegen einer zufälligen Eigenschaft, die wir uns darin denken, weil es bewegt wird, eine gewisse Größe hat, oder weil es warm ist, usw. Dann ändern wir aber etwas an der Benennung der Sache selbst; statt lebendig setzen wir Leben; statt bewegt, Bewegung; statt warm, Wärme; statt lang, Länge usw. Diese geänderten Benennungen bezeichnen aber nun nicht mehr Materie und Körper, sondern zufällige und eigentümliche Eigenschaften, durch welche ein Körper von dem anderen unterschieden wird. Dergleichen Benennungen werden abgesonderte oder abstrakte genannt, weil sie nicht von der Materie selbst, sondern aus der darüber angestellten Betrachtung hergenommen werden.
Drittens sehen wir auch wohl dabei auf das Eigentümliche, wodurch etwas insbesondere zu unserer Erkenntnis kommt. Wenn wir z.B. etwas sehen , so denken wir nicht immer ausschließlich an die gesehene Sache, sondern an deren Aussehen, Farbe, Bild oder Vorstellung . Ferner, wenn wir etwas hören, so sind wir aufmerksam auf den Schall und auf das, was wir dabei vernehmen, mit Beiseitesetzung dessen, was den Schall angibt; und so bei den übrigen Vorstellungen.
Viertens halten wir uns auch zuweilen bei den Namen auf, die wir den Benennungen selbst beilegen; wir sagen: normal, allgemein, besonders, gleichbedeutend, vielbedeutend; dies alles sind Namen, die von anderen Namen gebraucht werden. Dahin gehört auch Bejahung, Frage, Satz, Erzählung, Schluß, Vortrag und dergleichen mehr, welches alles hierher gehört. So viel ihrer auch sein mögen, so haben sie doch das gemeinsam, daß sie etwas setzen oder bejahen von dem, was teils in der Wirklichkeit, teils in der Einbildung da ist; wie Körper, die es entweder wirklich oder dem Schein nach sind, so wie auch Worte oder Reden.
Es gibt auch verneinende Namen, welche anzeigen, daß eine Benennung einer gewissen Sache nicht zukomme, wie nichts, niemand, unendlich, ungelehrig, vier weniger drei, und andere mehr, die bei den Rechnungen gebraucht werden, um zu ändern oder zu widerrufen und den unrichtig gebrauchten Ausdruck zurückzunehmen.
Alle übrigen Namen sind ein bloßer Schall und bedeuten nichts. Sie sind von zwiefacher Art; zu der ersten gehören die neuerdachten, denen aber die Erklärung fehlt, und woran die Philosophen und Scholastiker, sobald sie in Verlegenheit geraten, sehr fruchtbar sind. Zur zweiten Art rechnet man, wenn eine Benennung aus zwei anderen zusammengesetzt wird, deren Bedeutungen nicht miteinander bestehen können; wie ein unkörperlicher Körper, oder auch eine unkörperliche Substanz und dergleichen. Ist ein Satz an sich falsch, so wird man sich bei dem aus den beiden Begriffen zusammengesetzten Worte auch nichts denken können. Der Satz z.B., ein Viereck ist rund, ist falsch, und folglich auch ein rundes Viereck ein Unding. Ebenso, wie man von der Tugend nicht sagen kann, daß sie dem Menschen eingegossen oder eingeblasen werde, so sind auch die Ausdrücke: eine eingegossene, eingeblasene Tugend nicht denkbar. Man stößt daher nicht leicht auf ein Wort dieser Art, welches nicht aus Begriffen besteht, welche die Kräfte des gemeinen Menschenverstandes übersteigen. Wird jemand, der eine richtig geordnete Rede hört, zu irgendeinem beabsichtigten Gedanken veranlaßt, so sagt man von ihm: er versteht die Worte; denn das Verstehen ist nichts anderes, als ein durch die Rede hervorgebrachter Begriff. Ist also die Sprache dem Menschen, wie es scheint, eigentümlich, so ist ausschließlich auch er nur fähig, etwas zu verstehen. Deshalb sind alle falschen Sätze, auch die allgemeinen, unverständlich, wiewohl mancher meint, er verstehe die Worte schon dann, wenn er sie im Geist nachspricht.
Von den verschiedenen Arten der Sätze, die ein Begehren, Verabscheuen oder sonst eine menschliche Leidenschaft ausdrücken, sowie von ihrem Gebrauch und Mißbrauch werde ich bei der Abhandlung von den Leidenschaften des Menschen reden.
Die Benennungen derjenigen Dinge, woran der Mensch ein Wohlgefallen oder Mißfallen findet, sind in ihren Bedeutungen immer schwankend, weil ein und dasselbe nicht bei allen, ja nicht einmal bei einzelnen Menschen beständig einerlei Bedeutung hat.
Da alle Benennungen zur Darlegung unserer Begriffe gebraucht werden sollen, und wir von all und jedem Dinge nicht einerlei Vorstellungen haben, so ist es auch unvermeidlich, ein und dieselbe Sache mit verschiedenen Benennungen zu bezeichnen. Es wird zwar dadurch in dem Gegenstand selbst nichts geändert; aber unsere Empfänglichkeit dafür, die wegen der besonderen Lage und der vorgefaßten Meinungen eines jeden notwendig voneinander sehr verschieden sein muß, macht, daß jedweder sie mit solchen Namen belegt, welche von seinem besonderen Zustand etwas angenommen haben. Deswegen muß man bei allen Untersuchungen der Art die Vorsicht gebrauchen, der eigentümlichen Bedeutung der Sache nichts von dem beizumischen, was der Verstand und die Stimmung desjenigen, der zu uns redet, vermöge seiner jedesmaligen Lage, Besonderes und Eigenes hat.
Hierher gehören größtenteils die Benennungen der Tugenden und Laster. Was für den einen Vorsicht ist, nennt der andere Furcht; was bei dem einen Grausamkeit heißt, heißt bei dem anderen Gerechtigkeit; was diesem Verschwendung ist, ist jenem Pracht; was uns Würde dünkt, dünkt jenem Stolz usw. Deswegen läßt sich aus solchen Benennungen nicht immer ein sicherer Schluß ziehen, so wenig wie aus Metaphern und anderen bildlichen Worten. Jedoch ist hierbei nicht so viel zu besorgen, weil ihre schwankende Bedeutung zu offenbar ist.