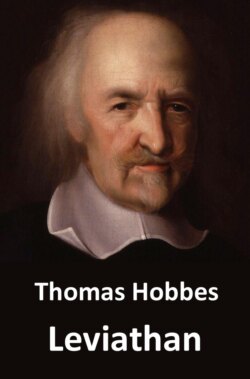Читать книгу Leviathan | Deutsche Übersetzung der Original-Ausgabe von 1651 - Thomas Hobbes - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6. Kapitel: Von den inneren Quellen
ОглавлениеVon den inneren Quellen der willkürlichen Bewegung, gewöhnlich Leidenschaften genannt, und von den sprachlichen Formen, sie auszudrücken.
Bei den Tieren gibt es zwei Hauptarten der Bewegungen, die sie ausschließend besitzen. Die eine erhält das Leben, fängt mit dem ersten Entstehen an und dauert ununterbrochen während des ganzen Lebens fort. Dahin gehört die Bewegung des Blutes, des Pulses, des Atemholens, der Verdauung, der Verteilung des Nahrungssaftes und der Ausleerung, welche sämtlich der Beihilfe der Vorstellungskraft nicht bedürftig sind. Die andere Art der Bewegung heißt die tierische und willkürliche, wohin gerechnet wird das Gehen, Sprechen und Bewegen der Glieder, so wie wir uns das alles vorher vorgenommen hatten. Daß die Empfindung eine Bewegung sei, welche in den Sinneswerkzeugen und in den inneren Teilen des Leibes durch die gesehenen und gehörten Gegenstände hervorgebracht wurde, die Vorstellung hingegen der Eindruck sei, welcher von dieser Bewegung nach der gehabten Empfindung übrig bleibt, ist bereits in dem ersten und zweiten Kapitel bemerkt worden. Weil aber das Gehen , das Sprechen und andere willkürliche Bewegungen immer von einem vorhergegangenen Gedanken, nämlich über die Fragen: wohin, wodurch und was ? abhängen, so ist offenbar, daß das Vorstellungsvermögen (Phantasium) der erste innere Grund aller willkürlichen Bewegungen sei. Wenn auch manche gar keine Bewegung einräumen wollen, wo entweder die bewegte Sache unsichtbar, oder der Raum, durch welchen sie bewegt wird, sehr klein und also unmerklich ist, so hebt dies doch keineswegs das Dasein solcher Bewegungen auf. Der Raum sei noch so klein, was sich durch den größeren Raum bewegt, von welchem der kleinere Raum ein Teil ist, wird sich dennoch auch durch diesen notwendig bewegen müssen. Dieser unmerkliche Anfang der Bewegung in uns, bevor dieselbe durch wirkliches Gehen, Reden, Stoßen und durch andere äußere Handlungen sichtbar wird, heißt das Streben (Conatus).
Wenn dies Streben die Ursache, wodurch es erregt wurde, zu seinem Ziel hat, so wird es Neigung oder Verlangen genannt. Ersteres ist eine allgemeine Benennung, letzteres aber wird oft in engerer Bedeutung von einer gewissen besonderen Neigung, wie von Hunger oder Durst, gebraucht. Sucht aber das Streben einen Gegenstand von sich zu entfernen, dann heißt es Abneigung . Die Griechen drücken diese beiden Wörter, Neigung und Abneigung, durch όρμη und αψορμη aus. Und gewiß, die Natur drängt uns manche Wahrheit auf, wogegen diejenigen oft verstoßen, welche klüger sein wollen als die Natur . Die Scholastiker z.B. geben bei der Neigung gar keine Bewegung zu, und weil doch eine Art von Bewegung dabei notwendig angenommen werden muß, so sagen sie: die Neigung ist eine metaphorische Bewegung und das ist widersprechend! Es gibt zwar metaphorische Worte, aber keine metaphorischen Körper und Bewegungen.
Verlangen wir nach etwas, so lieben wir es auch; was wir hingegen fliehen, das hassen wir. Folglich ist Verlangen und Lieben ein und dasselbe, nur beim Verlangen denkt man sich immer einen abwesenden, beim Lieben aber gewöhnlich einen anwesenden Gegenstand, so wie auch Abneigung auf etwas Abwesendes, Haß aber auf etwas Gegenwärtiges geht.
Einige natürliche Neigungen und Abneigungen scheinen uns angeboren zu sein, wie die Neigung zu essen, abzusondern und auszuleeren, welche beiden letzteren gewissermaßen auch Abneigungen genannt werden könnten, weil sie ein Bestreben gegen irgend ein übel bei einem vollen und überladenen Körper in sich fassen. Zu den übrigen Gegenständen bekommen wir eine Neigung, je nachdem wir erfahren haben, welche Wirkungen sie bei uns oder anderen hervorbrachten. Nach Dingen, von welchen wir entweder gar keine Kenntnis haben, oder deren Dasein wir nicht glauben, können wir kein anderes Verlangen als das tragen, sie durch die Erfahrung kennen zu lernen. Abneigung findet aber nicht bloß bei solchen Dingen statt, deren Schädlichkeit wir an uns selbst erfuhren, sondern auch bei solchen, von welchen wir noch nicht wissen, ob sie uns schaden werden oder nicht.
Wonach wir kein Verlangen und wogegen wir keinen Haß haben, das verachten wir; und Verachtung besteht darin: wenn das Herz, aller Reizungen ungeachtet, deshalb unbeweglich und fest bleibt, weil es entweder von stärker wirkenden Gegenständen eingenommen ist, oder weil es das, was es verachtet, nicht genau kennt.
Bei der beständigen Veränderung des menschlichen Körpers, die in der Einrichtung desselben gegründet ist, können durchaus nicht ein und dieselben Gegenstände zu allen Zeiten in uns Neigung und Abneigung erzeugen; noch viel weniger kann aber nach einem und demselben Ding bei allen Menschen ein Verlangen stattfinden.
Gut nennt der Mensch jedweden Gegenstand seiner Neigung, böse aber alles, was er verabscheut und haßt, schlecht das, was er verachtet. Es müssen also die Ausdrücke gut, böse und schlecht nur mit Bezug auf den, der sie gebraucht, verstanden werden; denn nichts ist durch sich selbst gut, böse oder schlecht, und der Bestimmungsgrund dazu liegt nicht in der Natur der Dinge selbst, sondern er muß von dem, der dieselben gebraucht (wenn anders keine Verbindung mit dem Staat obwaltet), oder (falls diese bestehen würde) von dem Stellvertreter des Staats, oder von einem selbstgewählten Schiedsrichter abhängen.
Schön und häßlich sind mit gut und böse beinahe, jedoch nicht ganz gleichbedeutend. Das Schöne läßt durch seinen Anschein etwas Gutes erwarten, so wie das Häßliche etwas Böses. Von beiden gibt es aber mehrere Arten; so sind z.B. wohlgebildet, anständig, zierlich, angenehm, Arten des Schönen; hingegen ungestalt, unanständig, lästig, Arten des Häßlichen. Alle diese Ausdrücke lassen immer entweder etwas Gutes oder etwas Böses erwarten. Bei dem Guten läßt sich daher dreierlei unterscheiden: nämlich was uns dasselbe erwarten läßt, ist Schönheit; der wirkliche Genuß des Erwarteten ist eigentliche Güte; der beabsichtigte Erfolg ist Vergnügen. Hierbei ist noch zu bemerken: das Gute, welches am Ende Vergnügen genannt wird, muß zuvor nützlich gewesen sein; so wie das Böse, insofern es noch zu besorgen steht, häßlich ist, zuletzt aber lästig wird.
Wie bei der Empfindung in einem empfindenden Körper nur eine Bewegung stattfindet, die durch die jedesmaligen Gegenstände bewirkt wurde, und, in Ansehung des Gesichts, Licht und Farbe , in Ansehung des Gehörs Schall , in Ansehung des Riechens Geruch usw. gibt; ebenso ist auch die bis zu den Augen, Ohren und anderen Sinneswerkzeugen fortgesetzte Wirkung allemal ein Bewegen oder Bestreben, welches in Hinsicht des Gegenstandes Neigung oder Abneigung sein wird. In der wirklichen Empfindung aber liegt das, was man Wohlbehagen [besser vielleicht: Lust (voluptas)] oder Mißbehagen nennt.
Weil nun wegen des Wohlbehagens diese Bewegung zur Erhaltung des Lebens dienlich zu sein scheint, so nennen wir alles, was dieselbe hervorbringt, angenehm, und das Gegenteil davon lästig.
Der Anschein des Guten ist folglich angenehm, der Anschein des Bösen aber lästig, und jede Neigung und Liebe mit Wohlbehagen, jede Abneigung aber und jeder Haß mit Mißbehagen verbunden.
Einiges Wohlbehagen entsteht gerade aus der Empfindung des Gegenstandes, welches man sinnliches Behagen nennen kann, und das, solange es durch kein Gesetz untersagt ist, keine Verschuldung in sich faßt. Dahin gehört: Anfüllung und Ausleerung des Körpers, und alles, was schon beim Sehen, Hören, Riechen, Schmecken oder Fühlen angenehm ist. Manches Wohlbehagen aber hegt in der Erwartung oder Erwägung des Zwecks oder der Folgen, sie mögen nun in dem Augenblick des Empfindens angenehm sein oder nicht; und dieses Wohlbehagens, welches Freude genannt wird, ist nur der fähig, welcher die Folge voraussieht. Ebenso ist auch manches Mißbehagen in der Empfindung gegründet und heißt dann: körperlicher Schmerz , so wie hingegen das, welches durch Besorgnis hervorgebracht wird, Traurigkeit heißt.
Die Leidenschaften aber, welche wir bisher einzeln betrachteten, nämlich: Neigung, Verlangen, Liebe, Abneigung, Haß, Freude, Schmerz und Traurigkeit, bekommen unter verschiedenen Umständen auch verschiedene Namen; denn es kommt darauf an, teils ob eine auf die andere folgen wird, teils ob wir Neigung oder Abneigung für den Gegenstand hegen, teils ob wir mehrere von ihnen zugleich vor Augen haben und endlich, auf welche Art sie aufeinander folgen.
Ist die Neigung mit der Vorstellung von dem zu erhaltenden Besitz verbunden, so nennen wir sie Hoffnung ; fehlt hingegen diese Vorstellung, so nennen wir sie Verzweiflung .
Die mit der Vorstellung des zu befürchtenden Schadens verbundene Abneigung ist Furcht ; findet sich aber dabei noch Hoffnung, durch Widerstand dem Schaden zu wehren, so nennt man es Mut . Ein sich schnell erzeugender Mut ist Zorn .
Fortdauernde Hoffnung auf seine eigenen Kräfte gibt Zutrauen ; fortgesetztes Mißtrauen aber Niedergeschlagenheit .
Zorn über eine erlittene ungerechte Beleidigung bewirkt Unwillen .
Dem anderen etwas Gutes wünschen, nennt man Wohlwollen oder Güte .
Verlangen nach Reichtum ist Geiz . Weil aber über Geld und Gut die meisten Streitigkeiten unter den Menschen obwalten, so wird dieses Wort fast immer nur in schlechter Bedeutung genommen; obgleich das Verlangen selbst getadelt oder gebilligt werden muß, je nachdem die dazu angewendeten Mittel gut oder schlecht waren. Aus eben dem Grund wird auch das Streben nach hohen Ehrenstellen im Staat mit dem Namen Ehrgeiz belegt und fast immer als schlecht gedeutet.
Wenn man nach Dingen, die unsere Absichten sehr wenig fördern, sorgsam strebt, oder solche, die jene sehr wenig hindern, ängstlich fürchtet, so nennt man dies Schwach - und Kleinmütigkeit . Auf unbedeutende Hilfsmittel oder Hindernisse nicht achten, ist Großmut . Wer der Gefahr, verwundet zu werden, oder eines gewaltsamen Todes zu sterben, mit Großmut entgegengeht, beweist Tapferkeit .
Großmut bei Verwendung des Reichtums ist Freigiebigkeit ; Schwach- und Kleinmütigkeit hierbei aber ist Kargheit (Tenaeitas).
Jemanden durch Schadenzufügung dahin bringen, daß derselbe etwas ehedem Verübtes bereue, heißt Rache .
Das Was? und Wie? zu wissen, ist Neugier , welche bloß dem Menschen eigen ist, und der Mensch unterscheidet sich von den übrigen Tieren nicht bloß durch die Vernunft, sondern auch durch diese Leidenschaft, die Neugier genannt wird. Bei den Tieren herrschen hauptsächlich Trieb nach Nahrung und andere sinnliche Triebe; nach den Ursachen der Dinge zu forschen, ist ihnen unmöglich, denn dies ist nur eine Beschäftigung des Geistes, welche mit dem beständigen und unermüdlichen Trieb (voluptate perpetua et infatigabili) nach immer neuer Wissenschaft verbunden ist, aber jenen zwar heftigen, aber kurzen Trieb der Sinnlichkeit unendlich übertrifft.
Die Furcht vor mächtigen unsichtbaren Wesen, sie mögen nun ersonnen oder durch zuverlässige historische Nachrichten bestätigt und öffentlich angenommen worden sein, ist Religion ; sind sie nicht öffentlich angenommen, so ist's Aberglaube . Sind aber die unsichtbaren Wesen wirklich so, wie man sich dieselben vorstellt, so nennen wir es wahre Religion.
Furcht vor einer Gefahr, deren Ursache und Beschaffenheit uns unbekannt ist, heißt panischer Schrecken und hat diesen Namen vom Gott Pan, der, wie man vorgibt, diese Schreckensart verursachen soll. Indes sieht doch gewiß der, welcher sich zuerst fürchtet, einen Grund zur Furcht; nach seinem Beispiel begeben sich auch die anderen auf die Flucht, und stehen in der Meinung, daß die übrigen wohl eine hinreichende Ursache zur Flucht haben müßten; denn diese Leidenschaft findet nur bei einer versammelten großen Menge statt.
Freude über eine neu gemachte Entdeckung ist Bewunderung . Sie ist dem Menschen auch eigentümlich, weil sie das Verlangen, die Ursache davon kennenzulernen, rege macht.
Freude, welche aus der Vorstellung von einer Macht oder einem Vorzug, den wir besitzen, in uns entsteht, ist ein froher Gemütszustand, den man Ehre nennt; und gründet sie sich auf Tatsachen, so ist sie eben das, was Zutrauen ist. Beruht sie aber nur auf Schmeicheleien, die wir von anderen hören oder darum uns selbst erdacht haben, weil das Bewußtsein großer Taten so süß ist, dann wird sie eitle Ehre. Wahres Zutrauen bringt Tätigkeit hervor, eitle Ehre aber nie!
Das aus dem Gefühl unserer Schwäche entstehende Unbehagen ist Niedergeschlagenheit .
Die eitle Ehre, welche in einer irrigen Voraussetzung gewisser Vorzüge besteht, von denen man sich bewußt ist, daß man sie nicht besitzt, ist sonderlich Jünglingen eigen, und wird entweder durch erdichtete oder wahre Erzählungen großer Taten genährt; bei reiferem Alter und durch ernste Geschäfte wird aber derselben größtenteils abgeholfen.
Wird man gewahr, daß jemand plötzlich sich selbst rühmt, wegen einer eignen raschen Tat, die seinen ganzen Beifall hat, oder wegen einer Vergleichung, die er zwischen dieser und eines anderen schlechten und unanständigen Handlung zu seinem Vorteil anstellt, so erregt dies Lachen . Sonderlich ist dies der Fall bei denen, welche sich sehr geringer Vorzüge bewußt sind, und dadurch, daß sie die schwachen Seiten anderer sichtbar machen, sich einen Wert verschaffen wollen. Vieles Lachen aber verrät einen schwachen Geist; und großen Geistern ist das eigen, daß sie andere gern vor Verachtung sichern, sich selbst aber nur mit den Größten unter den Menschen vergleichen.
Eine schleunige Niedergeschlagenheit bewirkt hingegen Weinen , und hat seinen Grund in solchen Ereignissen, welche irgend eine große Hoffnung oder eine Stütze unserer Macht plötzlich vernichten. Das Weinen ist aber besonders bei denen gewöhnlich, die fremder Hilfe bedürfen, wie z.B. bei Weibern und Kindern. Oft geschieht es über den Verlust eines Freundes, oft über Undankbarkeit, auch wohl bei Aussöhnungen, weil alsdann alle Hoffnung, sich zu rächen, aufgegeben werden muß. Übrigens entstehen Lachen und Weinen immer schnell, und werden bei öfterer Wiederholung derselben Veranlassung schwächer. Ein oft gehörter Scherz wird keinen zum Lachen, und ein längst verschmerztes Unglück keinen zum Weinen bringen.
Schmerz über eine begangene Unschicklichkeit heißt Scham , und ist mit einem Erröten begleitet. Bei jungen Leuten findet man dies sehr lobenswürdig, weil es ein Verlangen verrät, edel zu handeln; bei bejahrten Personen aber, gegen die man nicht die Nachsicht hat, wird es nicht gebilligt.
Die Geringschätzung eines guten Rufs heißt Schamlosigkeit .
Betrübnis über anderer Not ist Teilnahme , die ihren Ursprung darin hat, daß man sich vorstellt, es könne uns leicht ebenso ergehen, weshalb sie auch Mitleid genannt wird. Je mehr die Not des andern eine selbstverschuldete ist, desto weniger erregt sie Mitleid. Weniger Mitleid werden übrigens diejenigen bei fremder Not empfinden, die sich davor auf immer gesichert halten.
Anderer Not gering achten ist Grausamkeit , und findet sich bei denen, welche dergleichen nicht selbst fürchten zu müssen glauben; daß sich aber jemand über die Not anderer ohne alle Ursache freuen sollte, scheint mir fast unmöglich.
Die Betrübnis über das größere Glück desjenigen, der sich mit uns um gleiche Ehrenstellen, Glücks- und andere Güter bewirbt, wird, wenn sie uns zu einer größeren Tätigkeit erweckt, Nacheiferung genannt; bewirkt sie aber den Vorsatz, diesen als unseren Gegner zu betrachten, und ihm entweder heimlich oder offenbar Hindernisse in den Weg zu legen, so ist sie Neid .
Wenn eine und dieselbe Sache in uns Neigung, Abneigung, Hoffnung und Furcht wechselweise erregt, und ein guter oder schlechter Erfolg, wenn wir etwas tun oder unterlassen, sich nach und nach im menschlichen Geist vorstellt, so daß wir bald wollen, bald nicht wollen, bald hoffen, bald fürchten, dann heißt dieses Gemisch von Leidenschaften, welches bis zur endlichen Festsetzung eines Entschlusses fortdauert, Überlegung . In Ansehung des Vergangenen läßt sich keine Überlegung anstellen, weil geschehene Dinge nicht mehr zu ändern sind; und ein Gleiches gilt von solchen Dingen, die entweder in der Tat, oder doch unserer Meinung nach unmöglich sind, wobei jede Überlegung völlig überflüssig ist. Jedoch findet sie bei dem statt, was wir zwar, ob es gleich in der Tat unmöglich ist, für möglich halten, und nicht einsehen, daß sie dabei vergeblich sei. Übrigens hat der Mensch dieselbe mit den Tieren gemein, bei welchen wir ebenfalls Spuren von Überlegung finden. Ist das, was man überlegte, ausgeführt, oder als unausführbar aufgegeben, dann ist die Überlegung zu Ende, weil nur bis dahin unsere Freiheit, etwas nach Willkür zu tun oder zu unterlassen, reicht.
Das, was nach der angestellten Überlegung unmittelbar folgt, es sei Neigung oder Abneigung, heißt Wille . Man sieht aber von selbst, daß hier nicht das Vermögen, sondern lediglich die Handlung des Wollens gemeint ist. Können daher unvernünftige Tiere Überlegungen anstellen, so müssen sie auch einen Willen haben. Die Beschreibung, welche die Scholastiker von dem Willen geben, daß er nämlich eine vernünftige Neigung sei, ist nicht richtig, weil es sonst keine freie Handlung geben könnte, die vernunftwidrig wäre. Nur eine solche Handlung, die vom Willen bewirkt wird, kann eine freie Handlung genannt werden; sagt man nun anstatt: vernünftige Neigung, eine aus einer vorhergegangenen Überlegung entstandene Neigung, so ist es die vorhin gegebene Erklärung, nämlich die bei der Überlegung zuletzt erfolgte Neigung. Man pflegt zwar oft zu sagen: es habe jemand den Willen gehabt, das zu tun, was er am Ende doch nicht wollte; so ist das doch nicht eigentlicher Wille, sondern nur ein gewisser Hang dazu, welcher eine Handlung noch nicht zu einer freien Handlung macht, die immer nur bloß von der letzten Neigung abhängen muß. Jede dazwischen kommende stärkere oder schwächere Neigung kann nicht Wille genannt werden, weil sonst jede Handlung zugleich frei und nicht frei sein würde.
Hieraus ergibt sich: daß nicht nur diejenigen Handlungen freie Handlungen genannt werden müssen, die aus der Neigung zu etwas entstehen, sondern auch die, welche durch Abneigung oder aus Furcht vor dem, was die Unterlassung derselben nach sich ziehen könnte, bewirkt werden.
Die Ausdrücke, womit wir unsere Leidenschaften bezeichnen, sind größtenteils eben die, welche wir sonst von unseren Vorstellungen gebrauchen. Und zwar können zuvörderst gemeinhin alle Leidenschaften in der anzeigenden Art (indicative) ausgedrückt werden, wie: ich liebe, fürchte, freue mich, überlege, will, usw.
Einige aber haben ihre besonderen Arten des Ausdrucks, die indes keine eigentlichen Bejahungen sind; sie müßten denn bei Schlüssen gebraucht werden. Die Überlegung wird in der verbindenden Art (subjunctive) angezeigt; dies gilt vorzüglich von den Voraussetzungen, aus welchen die Schlüsse hergeleitet werden, z.B. wenn dieses geschieht, so wird alsdann jenes folgen. Auch ist die Rede, deren man sich bei Schlüssen bedient, hiervon gar nicht unterschieden, außer daß bei Schlüssen allgemeine Vorstellungen, bei Überlegungen aber gewöhnlich Benennungen einzelner Dinge gebraucht werden. Der Ausdruck der Neigung und Abneigung steht in der befehlenden Art (imperativus), z.B. tue dies, unterlasse jenes ; und wird dies zu jemandem gesagt, der gehorchen muß, so heißt es ein Befehl , sonst Bitte oder Rat . Eitle Ehre, Unwille, Teilnahme und andere Neigungen verlangen die wünschende Art (optativus). Die Neugier bedient sich beinahe allein der fragenden Art (interrogativus), z.B.: was ist das? wann wird das geschehen? wie ging das zu? was folgt daraus? andere Arten, die Leidenschaften auszudrücken, sind mir nicht bekannt. Denn was Flüche, Verwünschungen und Scheltworte betrifft, so sind diese nicht als Ausdrücke der Leidenschaften, sondern als Handlungen einer ungesitteten Zunge anzusehen.
Mit Ausdrücken dieser Art bezeichnet man gewöhnlich die Leidenschaften, doch sind sie keine untrüglichen Zeichen, weil sie willkürlich sind. Die sichersten Zeichen einer obwaltenden Leidenschaft werden in den Mienen, Gebärden, Handlungen, Absichten und Unternehmungen allemal gefunden.
Weil bei der Überlegung Neigungen und Abneigungen miteinander abwechseln, je nachdem die Handlung, welche in Überlegung gezogen wird, eine Aussicht zu guten oder bösen Folgen gewährt, und hieraus eine lange, ja oft unabsehbare Kette von Folgen entstehen kann, so muß, wenn in dieser Kette mehr gute als böse Folgen erblickt werden, das ganze ein scheinbares Gut , alsdann aber ein scheinbares Übel genannt werden, wenn darin die bösen Folgen an Zahl die guten übertreffen. Wer daher durch vernünftige Überlegungen oder auch durch Erfahrung sich eine ausgebreitete Kenntnis der möglichen Folgen verschafft hat, der ist imstande, die reiflichsten Überlegungen anzustellen und anderen den besten Rat zu erteilen.
Ein ununterbrochener glücklicher Fortgang in dem, was man sich wünscht, ist das, was Glückseligkeit genannt wird: fürs Erdenleben nämlich; obgleich darin eigentlich keine ununterbrochene Gemütsruhe stattfindet, weil das Leben selbst eine Bewegung in sich schließt und der Mensch, ohne etwas zu wünschen, zu fürchten, usw. ebenso wenig wie ohne Empfindung leben kann.
Wenn von irgendetwas gesagt wird: es sei gut, so ist dies Lob ; sagt man: es ist mächtig und groß, so ist dies Erhebung . Urteilt man aber von jemandem: er sei glücklich, so heißt dies in der griechischen Sprache μακαρισμος Seligpreisung . Das über die Leidenschaften bisher Gesagte sei zur gegenwärtigen Absicht genug.