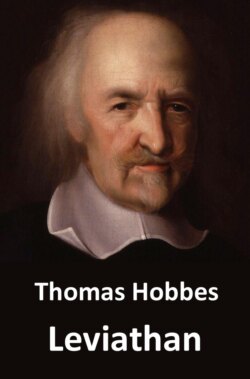Читать книгу Leviathan | Deutsche Übersetzung der Original-Ausgabe von 1651 - Thomas Hobbes - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7. Kapitel: Auflösung der Gedankenfolgen
ОглавлениеJede Gedankenfolge, bei der Wißbegierde zugrunde liegt, endet damit: daß man etwas entweder annimmt oder verwirft Wird die Gedankenreihe nur auf einige Zeit unterbrochen, so kann sie deshalb noch nicht als beendet angesehen werden.
Denken wir uns bloß dieselbe, so erwägen wir bei uns selbst wechselweise die Fragen: was wird geschehen? und was nicht? oder was ist gewesen ? und was nicht ? Zuletzt wird sich dann immer die Vermutung ergeben: es wird geschehen , oder nicht ; es ist geschehen , oder nicht ; und jede Beendigung dieser Art heißt Meinung . Was nun bei der Überlegung, ob etwas gut oder böse sei, die abwechselnde Neigung ist, eben das ist bei der Frage: ob eine schon vergangene oder noch zukünftige Tatsache wahr oder falsch sei, die abwechselnde Meinung. Wie aber bei der Überlegung die letzte Neigung der Wille wird, so wird bei der Untersuchung über das Vergangene und Zukünftige die letzte Meinung das Urteil oder die Entscheidung sein; und wie die ganze Reihe der abwechselnden Neigungen bei der Frage: ob etwas gut oder böse sei, Überlegung heißt, so wird bei der Frage, ob etwas wahr oder falsch sei, die ganze Reihe abwechselnder Meinungen Zweifel (dubitatio) genannt werden müssen.
Keine Gedankenfolge kann zu einer ganz vollkommenen Kenntnis des Vergangenen und Zukünftigen führen; denn die Kenntnis einer Tatsache beruht ursprünglich auf Empfindung, dann folgt Vorstellung, aber die Kenntnis der Folgen, wenn sie gleich, wie schon erwähnt, Wissenschaft heißt, ist doch keine ganz zuverlässige, sondern nur eine bedingte Wissenschaft. Keiner kann durch Schlüsse herausbringen, daß dieses oder jenes da sei, da gewesen oder künftig sein werde; — und das gehörte doch zu einer vollkommenen Wissenschaft —, sondern man kann nur schließen: i st dies, so folgt jenes; war dies, so war auch jenes; wird dies sein, so wird auch jenes sein ; dies heißt bedingte Wissenschaft, wobei man nicht weiß, wie eine Sache aus der anderen, sondern nur ein Begriff aus dem andern folgt.
Wird diese Gedankenfolge nun in Worten ausgedrückt, so fängt sie mit der Definition derselben an, verbindet sie, und macht daraus Sätze, aus deren Zusammensetzung sie wieder Schlüsse macht, und endlich auf eine gewisse Folgerung kommt, die sich aus allen vorangegangenen Sätzen ergibt, und diese Kenntnis, wie ein Begriff aus dem andern folgt, ist die für uns Menschen erreichbare Wissenschaft. Beginnt aber die Gedankenfolge nicht mit Definitionen, oder schließt man aus deren Verbindung nicht regelmäßig, so kann zuletzt nichts weiter herauskommen, als die Meinung : daß der Schlußsatz, so widersinnig und nichtssagend er übrigens auch ist, eine Wahrheit sei.
Wenn zwei oder mehrere um einerlei Sache wissen, so heißen sie Mitwisser ; und weil sie gegenseitig die sichersten Zeugen ihrer Taten sind, so ist es immer als die größte Gottlosigkeit angesehen worden und wird auch beständig dafür gehalten werden, wenn jemand wider besseres Wissen und Gewissen ein Zeugnis entweder selbst ablegt, oder einen anderen dahin zu vermögen sucht. Es wird aber der Ausdruck Gewissen insgemein gebraucht von dem geheimen Bewußtsein dessen, was man selbst getan oder nur gedacht hat. Es fehlt auch nicht an solchen Menschen, welche ihre besonderen und selbsterdachten Meinungen, so widersinnig diese auch sein mögen, aus zu großer Eigenliebe hartnäckig verteidigen, und zwar aus dem scheinbaren Grund ihres Gewissens, gerade als wenn es das größte Verbrechen wäre, darin etwas zu ändern. Sie wollen also den Schein haben, als wären sie von der Wahrheit ihrer Sätze überzeugt, obwohl sie doch keine eigentliche Wissenschaft, sondern nur eine Meinung haben.
Geht daher eine Gedankenfolge nicht von der Definition aus, so wird sich zuletzt bloße Meinung ergeben. Fängt sie bei dem an, was ein anderer gesagt hat, dessen Kenntnis und Wahrheitsliebe außer Zweifel ist, so schließt sich dieselbe, weil es nun nicht mehr auf die Wahrheit der Sache , sondern auf die Tüchtigkeit des Zeugen ankommt, mit Fürwahrhalten und Glauben , wovon ersteres Bezug auf die Sache, letzteres aber auf die Zeugen hat. An jemand glauben, und jemandem glauben wird oft als gleichbedeutend gebraucht, wenn nämlich die Rede von der Wahrheitsliebe desselben ist; glaubt man aber eine Aussage , so wird dadurch angedeutet, daß man die Aussage für Wahrheit halte. Indes kommt die Redensart: ich glaube an und das griechische πισ͏ τεύω εις höchst selten anders als in theologischen Schriften vor, denn andere Schriftsteller sagen gewöhnlich: ich glaube ihm, ich traue ihm, ich halte ihn für glaubwürdig.
Das Glauben an , welches in dem christlichen Glaubensbekenntnis vorkommt, will nicht eigentlich sagen: daß man jemanden für glaubwürdig halte, sondern daß man die in den Artikeln vorgetragene Lehre als wahr anerkenne und bekenne. Denn nicht allein die Christen, sondern auch alle Menschen glauben so an Gott, daß sie alles für wahr annehmen, was er gesagt hat, oder noch sagen wird; sie mögen es mit ihrem Verstand begreifen oder nicht. Einen höheren Grad des Glaubens gibt es nicht. Die in unserem Glaubensbekenntnis enthaltene Lehre aber glauben nur ausschließlich die Christen.
Hieraus folgt: hält jemand etwas für wahr, nicht aus Gründen, die aus der Sache selbst oder aus der allgemeinen Vernunft, sondern von dem Ansehen und der Achtung, in welchem die redende Person steht, hergenommen sind, so hat es der Glaube desselben hauptsächlich und eigentlich mit der redenden Person zu tun. Wenn wir also glauben, daß die Heilige Schrift Gottes Wort sei und wir darüber keine eigene Offenbarung haben, so stützt sich dabei unser Glaube auf die Kirche und deren Ansehen. Ebenso muß man auch von denjenigen, welche das für wahr halten, was von einem Propheten im Namen Gottes vorgetragen wird, sagen, daß sie dem Propheten Glauben beimessen, ihn ehren, ihm glauben und trauen, er mag übrigens ein wahrer Prophet sein oder nicht. Dies gilt auch von allen übrigen in der Geschichte erzählten Tatsachen; denn wenn ich z.B. den Erzählungen der Heldentaten des Alexander oder Cäsar keinen Glauben beimessen wollte, so würde unstreitig außer dem Geschichtsschreiber selbst weder einer von diesen Helden oder sonst jemand es mir verargen können. Glaubt man es dem Livius nicht, daß eine Kuh geredet habe, so trifft dieses Mißtrauen nicht Gott, sondern den Livius.
Hat folglich unser Glaube keinen andern Grund als nur menschliches Ansehen, so hat es unser Glaube nicht mit Gott, sondern mit Menschen zu tun.