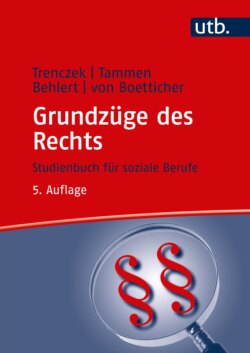Читать книгу Grundzüge des Rechts - Thomas Trenczek - Страница 8
ОглавлениеVorwort und Arbeitshinweise
Warum sollten Fachkräfte der Sozialen Arbeit sich mit dem Recht beschäftigen und über differenzierte Rechtskenntnisse verfügen? Ein wesentlicher Grund liegt in dem, was man „Verrechtlichung“ nennt. Das Recht „mischt“ sich in alle Lebensbereiche „ein“, es gibt nahezu kaum einen rechtsfreien Raum. Das gilt auch für die Soziale Arbeit und Sozialpädagogik, selbst das Töpfern in der Toskana ist rechtlich geregelt, z. B. durch Teilnehmer- und Beherbergungsverträge, durch Kauf- und Lieferverträge (irgendwo muss der Ton ja herkommen). Vielfach bildet das Recht das gesellschaftliche Leben nur in rechtliche Kategorien ab und stabilisiert damit die Verhaltenserwartungen der Menschen. Teilweise ist mit dem Recht ein Orientierungsrahmen gezeichnet, von dem man abweichen kann, teilweise handelt es sich um zwingende Verhaltensanforderungen (vgl. hierzu I-1, II-1).
Bei vielen Studierenden scheint am Anfang ihres Studiums der Eindruck vorzuherrschen, dass eine stetig wachsende Zahl der Gesetze und Rechtsverordnungen, Verfügungen, Erlasse und Richtlinien einerseits und die bürokratischen Strukturen und Interessen andererseits dem sozialpädagogischen Handeln im Dienste der Klienten nur noch wenig Spielraum lassen. Freilich greift ein solcher künstlicher Gegensatz gerade angesichts der sozialrechtlichen Bestimmungen zu kurz. Vielmehr äußert sich die öffentliche Hilfegewährung überhaupt erst in Form einer rechtlich gebundenen Verwaltungsentscheidung. Insoweit gilt es gerade, die durch den normativen Handlungsauftrag eingeräumten Chancen für die praktische Tätigkeit in der Sozialen Arbeit zu erkennen und dann auch zu nutzen, z. B.:
■ Frau S., alleinerziehende Mutter von drei Kindern (3, 4 und 14 Jahre), kommt in die Beratung des Allgemeinen Sozialdienstes und erkundigt sich nach personeller und finanzieller Unterstützung.
■ Nach dem erfolgreichen Examen will die Sozialarbeiterin B. gemeinsam mit anderen Kolleginnen einen Verein gründen, um für arbeitslose Jugendliche ein Angebot außerschulischer Ausbildung und Freizeitbetätigung zu schaffen. Was müssen sie hierbei beachten? Wie und von wem erhält man öffentliche Zuschüsse?
■ Die 15-jährige Lisa wird von der Polizei um 1.00 Uhr nachts in einer Disco aufgegriffen und dem Jugendamt zugeführt. Was ist zu tun? Ist es für die Entscheidung relevant, ob Lisa von zu Hause ausgerissen ist oder sich mit Zustimmung ihrer Eltern in der Diskothek aufgehalten hat?
In vielen dieser Fälle geht es nicht nur um die Klärung einer Rechtsfrage.Vielmehr kommen hilfesuchende BürgerInnen oft mit einem ganzen Bündel von Fragen und Problemen, die ganz unterschiedliche Lebens- und damit Rechtsbereiche betreffen. So berichtet im oben zuerst genannten Beispiel Frau S. über Konflikte mit dem von ihr getrennt bei seiner Freundin lebenden Ehemann. Diese seien aktuell ausgelöst worden, weil ihr ältester Sohn Willy (14) seit einiger Zeit häufiger die Schule schwänze und in diesem Zusammenhang von der Polizei bei einem mit anderen Jugendlichen begangenen Einbruchsdiebstahl festgenommen worden sei. Ihr Mann habe seine Unterhaltszahlung gekürzt, weil er arbeitslos geworden sei und sich ohnehin scheiden lassen wolle. Mittlerweile sei sie mit Mietzahlungen im Rückstand, weil sie einen MP3-Player bezahlen müsse, den ihr Sohn trotz ihres Verbotes erworben habe. Im Moment werde ihr alles zu viel, weil bei ihr demnächst ein stationärer Krankenhausaufenthalt und eine Operation anstehen und sie nicht wisse, wie sie ihre Kinder in dieser Zeit versorgen solle. Die Krankenkasse weigere sich, während dieser Zeit eine Haushaltshilfe zu bezahlen, da die Kinder ja bei ihrem Mann wohnen könnten.In diesem Fall stellen sich z. B. folgende Fragen:
■ Welche Unterhaltsansprüche stehen Frau S. für sich und ihre Kinder gegen ihren Mann zu? Welche Vereinbarungen können die Eheleute im Hinblick auf eine Scheidung einvernehmlich treffen? (➝ Familienrecht, s. II-2)
■ Muss Frau S. den von ihrem Sohn erworbenen MP3-Player bezahlen? (➝ Allgemeines Privatrecht, s. II-1)
■ Kann der Mietvertrag wegen der Mietrückstände gekündigt werden? (➝ Schuldrecht, s. II-1.4)
■ Hat sich Willy strafbar gemacht, welche strafrechtlichen Rechtsfolgen (➝ Strafrecht, s. IV) und welche jugendhilferechtlichen Interventionen (➝ Jugendhilferecht, s. III-3) kommen in Betracht?
■ Spielt es eine Rolle, ob Willy bzw. seine Eltern nichtdeutsche Staatsangehörige sind? (➝ Migrations- und Flüchtlingsrecht, s. III-8)
■ Welche Sozialleistungen kann Frau S. beanspruchen? (➝ Recht der Grundsicherung für Arbeitsuchende, s. III-4) Hat sie einen Anspruch darauf, dass die Kosten für eine Haushaltshilfe während des Krankenhausaufenthaltes von der Krankenkasse übernommen werden? (➝ Sozialversicherungsrecht, s. III-2)
Natürlich hat die Antwort auf viele dieser Fragen zumeist auch einen sozialpädagogischen Bezug; sie wird deshalb auch von fachlichen Grundsätzen und Methoden der Sozialen Arbeit bestimmt werden. Insoweit sind aber auch politisch-rechtliche Handlungsanweisungen, insb. einige verfassungsrechtliche Grundentscheidungen für das Handeln der Sozialarbeit bindend. Soziale Hilfe äußert sich in diesen Fällen zudem vor allem auch als Rechtsberatung (hierzu I-4.2), wobei die Fachkräfte der Sozialen Arbeit ganz unterschiedliche Rechtsmaterien beherrschen müssen. Wer als SozialarbeiterIn rechtliche Hilfemöglichkeiten ungenutzt lässt und für die betroffenen KlientInnen nicht erschließen kann, weil diese nicht bekannt sind oder ohne ernsthaftes Bemühen falsch auslegt werden, wird der beruflichen Verantwortung nicht gerecht. Zwar basieren das Recht und die Soziale Arbeit auf unterschiedlichen Handlungslogiken – grob verkürzt: einerseits mit Blick auf die gesellschaftliche Ordnung (s. I-1.3) sowie andererseits auf den Menschen als soziales Individuum – doch ungeachtet unterschiedlicher Interessensrichtungen gilt es, das Ineinanderspiel von rechtlichen und sozialpädagogischen Aktivitäten so zu gestalten, dass die soziale Integration des Einzelnen in den normalen Alltag gelingen kann. Schließlich sollte bei allem nicht die emanzipatorische Kraft des Rechts vergessen werden: Recht als Medium zur Eröffnung von Teilhaberechten und -chancen (vgl. hierzu insb. I-1.2: Recht und Gerechtigkeit).
Die Darstellung der Grundzüge des Rechts umfasst ab der 4. Auflage fünf Hauptteile. Im Teil I geht es um wesentliche Grundfragen des Rechts und die sog. allgemeine Rechtslehre, mit der wir den grundlegenden Rahmen der Rechtsordnung beschreiben, die Methoden der Rechtsanwendung, die Wege zur Rechtsverwirklichung sowie die Rechtskontrolle und insb. die für die Sozialen Berufe besonders wichtigen alternativen, außergerichtlichen Streiterledigungsformen. Der zweite Teil stellt die Grundzüge des Privatrechts dar, der dritte Teil die Grundzüge des Öffentlichen Rechts mit Schwerpunkt Sozialrecht, der vierte Teil beinhaltet das Strafrecht und der fünfte Teil umfasst verschiedene Querschnittsgebiete. Im Anhang finden Sie u. a. das für einen ersten Zugang zu den Rechtsbegriffen hilfreiche Glossar und Aufbauschemata für die Bearbeitung von Rechtsfällen.
Im Hinblick auf die aus didaktischen sowie Platzgründen notwendige Schwerpunktsetzung bei der Darstellung der Grundzüge des Rechts werden die Rechtsgebiete im Umfang nach der Relevanz für die Sozialen Berufe in der von uns verantworteten Ausbildung und Praxis dargestellt. Wir verzichten deshalb im Privatrecht auf eine eingehende Darstellung des Schuld- sowie Sachen- und Erbrechts und beschränken uns weitgehend auf die Klärung der wichtigsten Strukturen und Rechtsbegriffe (hierzu vgl. auch das Glossar im Anhang VI-1). Demgegenüber wird hier das Familienrecht einschließlich des Betreuungsrechts aufgrund seiner besonderen Relevanz für die Soziale Arbeit ausführlich dargestellt (II-2). Das Gleiche gilt für das sowohl zivil- als auch öffentlich-rechtliche Elemente enthaltende Arbeitsrecht (s. u.V-3) wie den Exkurs zu Fragen der Aufsicht und Haftung (V-1). Im Öffentlichen Recht liegt der Schwerpunkt auf den sozialrechtlichen Regelungen insb. des Kinder- und Jugendhilferechts (III-3) und den Regelungen der Grundsicherung nach SGB II und der Sozialhilfe nach SGB XII (III-4). Demgegenüber spielt das Sozialversicherungsrecht (III-2) in der Ausbildung der Sozialen Arbeit eine geringe Rolle und erfordert in der Praxis häufig den fachlichen Rat von rechtskundigen Spezialisten. Wir haben stattdessen mit Blick auf spezifische Arbeitsbereiche das Jugendschutz- (III-7) sowie das Migrations- und Flüchtlingsrecht (III-8) näher beleuchtet. In dem für zahlreiche Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit relevanten Strafrecht (IV) werden neben den allgemeinen Grundlagen und der Strafzumessung unter Verzicht auf die Feinheiten der Rechtsdogmatik im Hinblick auf die Straftatbestände vor allem die Besonderheiten des Strafverfahrensrechts einschließlich der Besonderheiten des Jugendstrafrechts dargestellt.
Arbeitshinweise
Das Lehrbuch über die Grundzüge des Rechts richtet sich zunächst – wie im Titel angegeben – an den weiten Kreis der Sozialen Berufe, insb. die Studierenden und Fachkräfte der Sozialen Arbeit, aber auch an alle Studierenden und Fachkräfte aus anderen Berufsgruppen, die in den von uns behandelten interdisziplinären Arbeitsfeldern tätig sind bzw. werden, z. B. die Berufsbetreuer und Vormünder, Verfahrenspfleger/-beistände und Mediatoren. Für Studierende hat es den Charakter eines Lehrbuches, für Praktizierende in den genannten Bereichen den eines Arbeitsbuches. Anfänger werden sich mit ihm einen ersten Zugang zur Rechtsmaterie und eine Orientierung in ihr verschaffen können, der Fortgeschrittene oder der Praktiker vermögen sich vermittels des Buches in die Komplexität, die innere Logik und die Folgerichtigkeit rechtlicher Fragestellungen einzuarbeiten.
Wir kennen aus Lehre und Praxis die Schwierigkeit vieler Studierender und Fachkräfte Sozialer Arbeit, einen Zugang zum Recht zu finden und mit dem Recht umgehen zu können. Dies liegt an ganz unterschiedlichen Gründen, sei es an der als „trocken“ empfundenen Materie, an der spezifischen Arbeitsmethodik oder an der spezifischen Fachsprache. Diese kommt zwar weitgehend ohne Fremdwörter aus, das Recht misst manchen Begriffen im Vergleich zum Alltagsgebrauch in der Umgangssprache jedoch eine unterschiedliche Bedeutung zu und klingt zuweilen auch etwas antiquiert. Wir haben uns als Autoren bemüht, den nichtjuristisch „vorbelasteten“ LeserInnen einen Zugang zum Recht zu verschaffen. Die Grundzüge des Rechts werden unter Berücksichtigung der interdisziplinären Perspektive beschrieben, ohne dass damit ein Verlust an rechtswissenschaftlicher Genauigkeit einhergehen soll. Deshalb lassen sich juristische Termini und Konstruktionen nicht vermeiden. Der berüchtigte Fachjargon der Juristen, das „Juristenchinesisch“, wird aber übersetzt – ebenso wie die in der Rechtssprache immer noch gebräuchlichen lateinischen Ursprünge mancher Rechtsgrundsätze – und verständlich gemacht. Hierzu sollen auch die nachfolgenden Arbeitshinweise dienen:
■ Besonders der Einstieg in die Rechtsmaterie ist schwer, da „alles mit allem“ zusammenhängt. Erklärungen setzen mitunter das Verständnis anderer Begrifflichkeiten voraus. Für eine erste Begriffsklärung dient das im Anhang befindliche Glossar. Auch wenn Sie im ersten Durchgang nicht alles sofort verstehen, haben Sie doch einen Überblick gewonnen und können dann bei Bedarf das Glossar immer wieder zurate ziehen.
■ Lesen Sie alle von uns angegebenen Rechtsnormen unmittelbar während des Arbeitens mit dem Lehrbuch durch. Die in den Normen enthaltenen Informationen sind unabdingbar für das Verständnis. Nahezu alle Rechtsnormen sind über das Internet kostenfrei verfügbar. Die Bundesgesetze finden Sie unter http://www.gesetze-im-internet.de.
■ Wir haben die Quellenangaben und Literaturhinweise auf das Notwendige reduziert. Auf wichtige Vertiefungs- und Nachschlagewerke wird am Ende entsprechender Abschnitte durch ein Icon besonders hingewiesen. Hierbei handelt es sich um Beiträge zu spezifischen Themen in Fachzeitschriften, Monografien sowie Kommentare. In diesen zuletzt genannten Werken finden Sie zu jeder Rechtsnorm eines Gesetzes (i. d. R. nach Paragrafen geordnet) ggf. notwendige Erläuterungen von Rechtsbegriffen und insb. Hinweise auf die einschlägige Rechtsprechung.
■ Lesen Sie die von uns zitierten Entscheidungen der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Dies ermöglicht Ihnen ein vertieftes Verständnis der Rechtsordnung und der juristischen Argumentation. Das Auffinden der Rechtsprechung ist relativ einfach; entweder haben wir die Fundstelle in den gängigen Fachzeitschriften angegeben oder bei Entscheidungen ab dem Jahr 2000 das Aktenzeichen und Datum, mit dem Sie die Entscheidung über das Internet einsehen können. Die Entscheidungen des BVerfG findet man z. B. unter www.bundesverfassungsgericht.de, die des BGH unter www.bundesgerichtshof.de und die der Sozialgerichte unter www.sozialgerichtsbarkeit.de. Die Entscheidungen des EGMR sind unter http://hudoc.echr.coe.int veröffentlicht. Im Übrigen findet man die Entscheidungen auch über Eingabe des Gerichts und der Aktenzeichen in eine gute Suchmaschine.
■ Die mit einem B gekennzeichneten Stellen weisen auf Praxis- oder Übungsbeispiele im Text hin.
■ In den mit einem D gekennzeichneten Textpassagen sind Anregungen zur Diskussion enthalten. Die Autoren weisen hier auf mitunter strittige Aspekte, Zusammenhänge und weiterführende Überlegungen hin, die in besonderer Weise reflektiert und diskutiert werden sollten.
■ Die mit einem Stift gekennzeichneten Kontrollfragen am Ende eines jeden Abschnitts verweisen jeweils auf die entsprechenden Unterabschnitte, in denen Sie die notwendigen Erläuterungen finden. Sollten Sie sich bei Ihrer Antwort nicht ganz sicher sein, empfehlen wir Ihnen, den (Unter-)Abschnitt nochmals durchzuarbeiten. …
Aus dem Vorwort zur 4. Auflage
Die gesetzlichen Änderungen, insb. im Privat- (II-1), Familien- (II-2), Sozialversicherungs- (III-2) und Existenzsicherungsrecht (III-4), aber auch im Zuwanderungs- und Asylrecht (III-8), machten eine Neubearbeitung großer Teile der „Grundzüge des Rechts“ notwendig. Gleichzeitig waren wir in der glücklichen Lage, unser Autorenteam um unseren Kollegen Arne von Boetticher und damit unsere Expertise insb. im Rehabilitationsrecht zu erweitern, welches nun in einem eigenständigen Kapitel 5 in Teil III erläutert ist. Zudem wurden die Grundlagen des Privatrechts mit Schwerpunkt auf das für die Soziale Arbeit relevante Kernwissen zur Rechtsgeschäftslehre und zu den besonders praxisrelevanten Vertragstypen sowie die verbraucherrechtlichen Regelungen und die Privatinsolvenz überarbeitet.
Aktualität und Wandel
Die Rechtsordnung ist durch fortwährende Aktivitäten des nationalen Gesetzgebers sowie der EU, aber auch durch die Auslegung der Gesetze durch die Gerichte einem laufenden Wandel unterworfen, weshalb gerade bei einer Darstellung so vieler Regelungsbereiche immer nur eine Momentaufnahme gelingen kann. Die Darstellung der „Grundzüge des Rechts“ befindet sich auf dem Stand Mai 2014. Die gesellschaftlichen Wandlungsprozesse betreffen nicht nur die hier neu bearbeiteten Rechtsgebiete, sondern auch andere, teilweise sogar in noch stärkerem Maße betroffene Bereiche – vom Öffentlichen Recht (Sozialdaten- und Umweltschutz, Gentechnikentwicklung und Embryonenschutz, Lebensmittelsicherheit etc. sind hier nur einige der aktuell diskutierten Stichworte) über das Privatrecht (z. B. rechtliche Folgen des Einsatzes elektronischer Medien, vom elektronischen Abschluss eines Kaufvertrages bis zum Urheberrechtsschutz für digitalisierbare Werke, aber auch Verbraucherschutz, Diskriminierungsschutz sowie die gravierenden Bewegungen im Arbeits-, Wirtschafts- und Finanzrecht) bis hin zum Strafrecht, wo neuartige (kommunikations-)technische Möglichkeiten, insb. in den Bereichen der organisierten Kriminalität, sowie ein hiermit in Zusammenhang stehendes Sicherheitsbedürfnis des Staates immer neue Straftatbestände und prozessuale Ermittlungsmaßnahmen hervorbringen. Für die Soziale Arbeit scheinen nur auf den ersten Blick nicht alle diese Regelungsbereiche relevant zu sein, doch haben wir uns bemüht, einige für die Praxis wichtige Aspekte zu behandeln und die Gewichte zum Teil zu verschieben. So wird das Europarecht (I-1.1.5.1) deutlich ausführlicher behandelt. Auch der Abschnitt zum Internationalen Privatrecht (I-1.1.6) sowie die Erläuterungen zu den sozialrechtlichen Datenschutzbestimmungen (III-1.2.3) wurden erweitert. Im Strafrechtskapitel (IV) finden sich einige kurze, für die Soziale Arbeit grundsätzliche Anmerkungen zum Polizeirecht. Aber auch hier müssen wir uns aus Platzgründen beschränken und auf die Ausführungen zu den landesrechtlichen Regelungen verzichten, weshalb das Polizei- und das Strafvollzugsrecht nur am Rande Erwähnung finden können.
Wir hatten in der Vorauflage bereits darauf hingewiesen, dass sich manche Lebens- und Arbeitsfelder nicht immer streng den großen Bereichen des Öffentlichen Rechts und des Privatrechts zuordnen lassen. Das betrifft insb. das Arbeitsrecht (V-3) und das Unterbringungsrecht (V-4) ebenso wie die nur „ganzheitlich“ zu erfassenden Regelungen über die Aufsicht und Haftung (V-1) sowie die Fragen der ärztlichen Behandlung und des Schwangerschaftsabbruchs bei minderjährigen oder unter Betreuung stehenden Personen (V-2).
Vorwort zur 5. Auflage
Die „Grundzüge des Rechts“ erscheinen nun bereits in der 5. Auflage. Wir verweisen gleichwohl zunächst im Hinblick auf die grundsätzliche Struktur des Lehrbuches sowie auf die wichtigen Arbeitshinweise zunächst auf die entsprechenden Ausführungen im Vorwort zur 1. Auflage.
Die Neuauflage wurde notwendig, weil die 4. Auflage trotz Nachdrucks schneller als erwartet vergriffen war. Wir haben dies genutzt, um die seit der letzten Herausgabe 2014 eingetretenen Änderungen in den einzelnen Rechtsgebieten zu berücksichtigen. Das betrifft insb. das Rehabilitations- und Teilhaberecht (III-5), welches durch das Bundesteilhabegesetz in mehreren Reformschritten verteilt über die Jahre bis 2023 weiterentwickelt werden soll. Wesentliche Änderungen gibt es auch im Kapitel zum Sozialversicherungsrecht insb. aufgrund der Reformen im Recht der Sozialen Pflegeversicherung (III-2.2). Im Vorgriff auf künftige Änderungen im Kinder- und Jugendhilferecht haben wir auch die voraussichtlichen Änderungen im SGB VIII durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) berücksichtigt (III-3). Änderungen im Familienrecht (II-2) sowohl auf der Ebene der Gesetzgebung als auch der höchstrichterlichen Rechtsprechung setzen die Tendenz einer weiteren Ausgestaltung des Eltern-Kind-Verhältnisses und des Schutzes von Rechtspositionen des Kindes fort. Das Migrations- und Asylrecht (III-8) bildet in der zeitlichen Dichte neuer gesetzgeberischer Entscheidungen zunächst zweifellos die Dynamik der Fluchtereignisse der letzten Jahre ab. Große Teile dieser Novellierungen und Neuregelungen auf diesem Gebiet werden aber darüber hinaus auch als symbolische (nicht zum eigentlichen Kern der sozialen Konflikte, die zu regulieren sie vorgibt, vordringende) Gesetzgebung zu dechiffrieren sein, was wohl auch als Konzession an durch populistische Rhetorik verunsicherte Bevölkerungsteile begriffen werden muss. Gesetzesänderungen im Arbeitsrecht (V-3) zielen insb. auf einen verbesserten sozialen Arbeitsschutz.
Um die notwendigen Aktualisierungen in den einzelnen Rechtsgebieten vornehmen zu können und gleichwohl den Gesamtumfang des Lehrbuches nicht überzustrapazieren, haben wir im Allgemeinen Teil (insb. I-6) sowie im Strafrecht (IV) deutlich kürzen und das Querschnittsthema „Unterbringung und Freiheitsentzug“ (vgl. 4. Aufl., Kap. V-4) streichen müssen.
Rechtsprechung und Literatur konnten bis 31.03.2017 berücksichtigt werden.
Trotz der Unmöglichkeit einer vollständig gender-gerechten Schreibweise bemühen wir uns um eine gender-sensible Sprache. Wir bitten um Verständnis, wenn uns das mit Rücksicht auf den Lesefluss nicht immer gelungen ist.
Wir danken den LeserInnen, den Studierenden und den KollegInnen, insb. aus der BAG HochschullehrerInnen Recht (BAGHR e. V.), für das positive Feedback sowie die nützlichen Hinweise und Anregungen. Fehler gehen allein zu unseren Lasten. Kritik und sonstige Rückmeldungen nehmen wir gerne entgegen.
Hannover / Berlin / Jena im April 2017
Thomas Trenczek
Britta Tammen
Wolfgang Behlert
Arne von Boetticher
P.S.: Das Recht ist laufend in der (Weiter-)Entwicklung. Insoweit überrascht es nicht, dass diese nicht vor dem Abschluss eines Manuskripts halt macht, weshalb wir hier zumindest in einem Nachsatz auf einige relevante (mögliche) Gesetzesänderungen aufmerksam machen wollen (soweit dies im Rahmen der Druckfahnenkorrektur möglich war, haben wir auf aktuelle Änderungen in den entsprechenden Kapiteln hingewiesen). Zur Zeit der Manuskriptabgabe lag der Entwurf des KJSG vor, welches wir in unserer Bearbeitung vorsorglich berücksichtigt hatten. Der Bundestag hat das Gesetz am 29.06.2017 verabschiedet. Aufgrund der Veränderung des ursprünglichen Gesetzesentwurfs hat der BRat dem Gesetz aber bislang nicht zugestimmt. Ob er das auf seiner letzten Sitzung in dieser Legislaturperiode am 22.09.2017 tun wird und das Gesetz in Kraft treten wird, ist nicht ausgemacht. Die Kritik an den vom Bundestag beschlossenen Änderungen bzgl. unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge und beim Pflegekinderwesen ist erheblich.