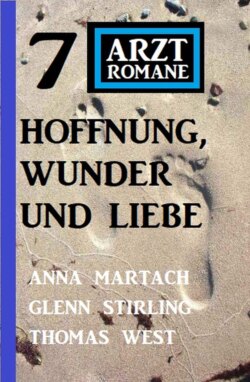Читать книгу Hoffnung, Wunder und Liebe: 7 Arztromane - Thomas West - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление8
„Das Marien-Krankenhaus braucht Sie“, diese Worte Alexandra Heinzes klangen Schwester Marianne noch im Ohr. Sie wählte die Nummer des Labors. Ilse Taubert meldete sich.
„Marianne, Intensivstation, wir brauchen noch drei Blutkonserven für Herrn Simons.“
Nachdem sie den Hörer aufgelegt hatte, machte sie sich auf den Weg ins Beatmungszimmer zu dem Frischoperierten.
Nein, sie würde nicht nach Hause gehen. Irgendwie würde sie diesen Tag schon überstehen. Marianne seufzte, das Gespräch mit der Ärztin hatte ihr gutgetan. Sie spürte jetzt neue Kraft.
„Das Marien-Krankenhaus braucht Sie“, die Ärztin hatte recht. „Und ich brauche das Marien-Krankenhaus“, seufzte Marianne, als sie vor Herrn Simons Bett stand.
Sie kontrollierte den Blutdruck des Patienten und trug den Wert in die Verlaufskurve ein. Dabei fiel ihr Blick auf die linke obere Ecke des Bogens: 11. November!
Ein jäher Schmerz durchzuckte sie. Michael! Sie hielt die Tränen zurück und wandte sich dem Frischoperierten zu. Reiß dich zusammen, Marianne, der Kranke hier braucht eine Schwester, die einen klaren Kopf hat!
Beherrscht nahm sie die stündlichen Routineaufgaben auf: Temperatur messen, Venendruck kontrollieren, Beatmungsgerät überprüfen, intravenöse Medikamente spritzen, Infusionen wechseln. Doch so konzentriert sie auch zu arbeiten versuchte, ihre Gedanken gingen andere Wege.
Michael! Sie sah sein Gesicht, seine wasserblauen Augen mit liebevollem Blick auf sich gerichtet. Jane hatte er sie immer genannt. Was würde er wohl zu ihr sagen, in dieser schwierigen Situation? Wie würde er sie jetzt wohl trösten?
„Jane“, würde er sagen, „ich liebe dich.“ Seine Stimme klang in ihrer Erinnerung, als würde er jetzt mit ihr sprechen. So nah, so vertraut.
„Aber weil ich dich liebe, möchte ich, dass du glücklich bist. Du musst neu anfangen, das Leben geht weiter, auch ohne mich.“
„Nein!“, schrie es in ihr auf. „Ich kann ohne dich nicht glücklich sein. Und ich will es auch nicht!“
Ein lauter Knall schreckte sie aus ihren Gedanken. Erschrocken hielt sie den Atem an. Zu ihren Füßen lagen die Scherben der Infusionsflasche, die sie gerade auswechseln wollte.
„Auf jede Schwesternschülerin im ersten Lehrjahr kann man sich mehr verlassen!“ Das gehässige Schimpfen des Oberarztes dröhnte in ihrem Kopf.
Hatte er nicht recht? Jetzt konnte sie noch nicht einmal mehr eine Infusionsflasche wechseln!
Während sie die Scherben zusammenlas und die klebrige Flüssigkeit vom Boden aufwischte, schluchzte sie verzweifelt. Ja, es mochte sein, dass das Marien-Krankenhaus sie brauchte. Aber nicht hier!
„Ich gebe auf“, seufzte sie.
Sie richtete sich auf und sah zum Fenster der Klinik in den Regen hinaus.
Ihr Entschluss stand fest. Gleich nach Dienstschluss würde sie zur Oberschwester gehen und ihre Versetzung beantragen. Auf die HNO-Station oder in die Computer-Tomographie, ganz egal. Hauptsache irgendwohin, wo ein Fehler nicht so weitreichende Folgen hatte wie hier. Und irgendwohin, wo sie nicht ständig Angst haben musste, mit Unfallopfern konfrontiert zu werden.
Eine halbe Stunde später brachte Schwester Marianne die Urinproben der Intensiv-Patienten ins Labor. Die Blutkonserven für Herrn Simons waren noch nicht fertig. Auf dem Rückweg zu ihrer Station schaute sie im Notarzt-Zimmer vorbei.
Alexandra Heinze saß an ihrem Schreibtisch, das Telefon in Reichweite, direkt neben ihr.
Erstaunt blickte sie auf: „Schwester Marianne, was machen Sie denn hier?“
„Ich habe es nicht fertig gebracht, nach Hause zu gehen. Ich werde den Tag schon überstehen.“ Sie schwieg einen Augenblick.
Der fragende Blick der Notärztin entging ihr nicht. „Und Sie haben recht, Frau Dr. Heinze, ich darf nicht aufgeben. Aber die Intensivstation verkrafte ich im Augenblick nicht. Nach Dienstschluss gehe ich zu Frau Eilers und bitte um meine Versetzung.“
Die Notärztin stand auf und kam auf die junge Frau zu. Sie legte ihr sanft die Hand auf die Schulter. „Wohin wollen Sie sich versetzen lassen?“
„Irgendwohin, wo ich nichts falsch machen kann.“
„Haben Sie sich das auch gut überlegt?“
Schwester Marianne nickte und griff zur Türklinke. „Danke, Frau Doktor.“
In diesem Moment klingelte das Telefon. Alexandra Heinze ging zum Schreibtisch und nahm den Hörer ab. „Heinze.“
Marianne sah, wie sich die Ärztin auf die Lippen biss und blass wurde. Sie ließ sich auf ihren Drehstuhl sinken. Erschöpft sah sie plötzlich aus.
„Jetzt beruhige dich, Mutter. Schau erst mal zu Hause nach, ob sie nicht schon da ist. Vielleicht wartet sie ja an der Wohnungstür bereits auf dich. Ruf mich dann noch mal an. Es gibt jetzt noch keinen Grund, sich Sorgen zu machen.“
Nachdem Alexandra Heinze aufgelegt hatte, stützte sie ihren Kopf in beide Hände auf den Schreibtisch. Irgendetwas schien sie zu bedrücken.
„Schlechte Nachrichten, Frau Doktor?“
Alexandra Heinze drehte sich seufzend zu Schwester Marianne um. „Na ja, jedenfalls keine guten. Anuschka, unser Hund, ist verschwunden.“