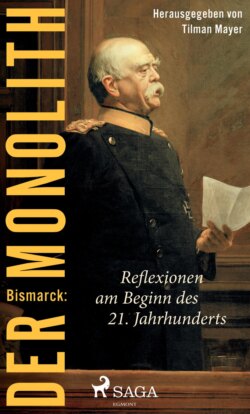Читать книгу Bismarck: Der Monolith - Reflexionen am Beginn des 21. Jahrhunderts - Tilman Mayer - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8. Ruhestand und Selbststilisierung
ОглавлениеVon den vier hier kursorisch betrachteten Kanzlern verlor nur einer sein Amt durch eine Wahlniederlage, Helmut Kohl 1998. 108 Jahre zuvor war die Niederlage des Bismarck-Kartells bei der Reichstagswahl unbestreitbar ein beschleunigendes Moment für seinen Abgang, aber nicht unmittelbar und nicht in einem formalen Maße zwingend. Aber von den Vieren, Bismarck, Bülow, Adenauer und Kohl, scheint nur Letzterer einigermaßen in Frieden aus dem Amt geschieden zu sein. Er hatte eine beispiellose Agenda auf der Habenseite, mit der niemand, er auch nicht, bei Antritt seiner Kanzlerschaft 16 Jahre zuvor hatte rechnen können: den Vollzug der deutschen Wiedervereinigung und die Weiterführung der europäischen Integration in einem Maße, das jedenfalls er als historisch ebenso notwendig wie legitimiert ansah. Kohl blieb im Geschäft; die Funktion des Ehrenvorsitzenden der CDU, die ihm wie selbstverständlich zugefallen war, interpretierte er durchaus politisch. Beim Europäischen Rat vom 11. Dezember 1998 avancierte er zum »Ehrenbürger Europas«.61 Dann riss mit einem Mal die Spendenaffäre, gemessen am historischen Zäsurcharakter der Phase vom Fall der Mauer in Berlin bis zur Entscheidung für die Einführung des Euro, eine Fußnote, Kohl medial-kommunikativ in den Abgrund. Und als er sich davon politisch einigermaßen erholt hatte, beraubten ihn körperliche Gebrechen weitgehend der Fähigkeit, seine historische Rolle selbst vital darzustellen. Anders sein Vorgänger Helmut Schmidt. Schmidt, dem wortgewandten Mitherausgeber der Wochenzeitung Die Zeit, stand und steht die ganze mediale Zunft der Elbmetropole zur Verfügung. Sie schreibt ihn je länger, desto intensiver zum Staatsmann und Intellektuellen von singulärer Urteilskraft hoch. Es dauert vermutlich lange, bis der deutschen Gesellschaft allmählich wenigstens in Teilen dämmern wird, dass dabei vielfach die Grenze zur peinlichen Hagiographie überschritten wird.62
Adenauer schied im Oktober 1963 mit viel Galle aus dem Amt. Schwer zu sagen, ob es besser gewesen wäre, hätte er einen von ihm stärker akzeptierten Nachfolger im Amt als Ludwig Erhard gefunden, von dem er noch dazu befürchtete, dass er das letzte Erbe seiner Politik, die privilegierte Beziehung zum gaullistischen Frankreich, ausschlagen werde.63 Adenauer behielt den Parteivorsitz solange es ging, bis zum 21. März 1966. Und er kommunizierte und intrigierte gegen Erhard und gegen die neuen Verhältnisse mit jedem, der nur in Frage kam: mit Charles de Gaulle, mit Franz Josef Strauß, mit Eugen Gerstenmaier; auch der Bundespräsident Heinrich Lübke war in diesem Spiel. Und so wurde auch Erhards letzter großer Triumph, der Sieg bei der Bundestagswahl 1965, ein »ungeheurer und unerwarteter Wahlsieg«, für den Vorgänger »eine böse Überraschung«64.
Bernhard von Bülow, inzwischen Fürst und »Durchlaucht«, schied 1909 aus dem Amt, mit kaum gebändigter Wut auf den Kaiser wie auf den ebenso ungeliebten wie verachteten Nachfolger Theobald von Bethmann Hollweg und ohne ersichtlich je über die eigenen großen Fehler wie Fehlschläge in seiner Politik zu reflektieren: über den Verrat des Kaisers in der Daily-Telegraph-Affäre 1908, über das Nichtzustandekommen einer umfassenden Finanzreform und schließlich – das war vielleicht der wundeste Punkt – über die Misserfolge in der sogenannten »Weltpolitik«. Bülow, der gelernte Diplomat, hatte Weltpolitik als strategische außenpolitische Aufgabe des Deutschen Reiches formuliert. Aber an strategischen Positionen war in seiner Amtszeit eigentlich nichts hinzugekommen. Viel schlimmer: Die Isolierung Deutschlands, ob nun Einkreisung oder Selbstauskreisung, machte ihre entscheidenden Fortschritte gerade in den Jahren seiner Kanzlerschaft. Die erste Marokko-Krise zeigte 1904 / 05 ein Zusammengehen Großbritanniens und Frankreichs, zwei Jahre später erreichten die vermeintlichen weltpolitischen Antipoden, London und St. Petersburg, ein Arrangement. Die Berliner Diplomatie hatte stets darauf gebaut, dass es eben dazu, zu einer Kooperation von Walfisch und Bär, nie kommen werde. Seine Wut arbeitete Bülow im dritten Band seiner Denkwürdigkeiten ab, der der Zeit nach seiner Entlassung über den Ersten Weltkrieg hinweg bis in die zwanziger Jahre gewidmet ist.65 Die ersten Kapitel des Buches dienen allein der Abrechnung, Abrechnung mit Kaiser wie Nachfolger, Abrechnung mit Staatssekretären und preußischen Ministern, die entweder unfähig seien oder ihn verraten hätten. Was folgt, ist eine Enzyklopädie von Begegnungen mit und Zuschriften aus der preußisch-deutschen Oberschicht, zumeist liberal-konservative Professoren, die Bülow als großem Staatsmann huldigen.
Kein Zweifel: Bismarck, obwohl nach der Entlassung in keinerlei Funktion mehr, war von allen vier Kanzlern für die verbleibende Lebenszeit die mit Abstand wichtigste Potenz. Gewiss. Das Bild ist ambivalent. Sein Biograf Otto Pflanze schreibt: »Kaum jemand konnte sich vorstellen, wer seinen Platz einnehmen sollte. […] Dennoch war die Reaktion auf Bismarcks Sturz in der Presse und im Parlament eher schwach. Nach zwanzig Jahren Sicherheit und Frieden erschien das Reich […] als eine unverrückbare Realität, die bestehen bleiben würde, wer immer an seiner Spitze stand.«66 Einen anderen Eindruck gewinnt, wer die Bilder auf sich wirken lässt, die eine der besten Chronistinnen der Zeit, die Baronin Spitzemberg, in ihrem Tagebuch von der Abfahrt Bismarcks am 29. März 1890 malt: »Wie eine Sturmflut warf sich die Menge dem Wagen entgegen, ihn umringend, begleitend, aufhaltend, Hüte und Tücher schwenkend, rufend, weinend, Blumen werfend. […] Frau von Hirschfeld war im Lehrter Bahnhof und schilderte den Enthusiasmus als unermesslich; die inneren Räume waren zum Erdrücken voll, die Fenster wurden ausgehoben, an den Säulen hingen die Menschen bis hoch oben, jubelnd, weinend, sich die Hände drückend; plötzlich fing einer an, die ›Wacht am Rhein‹ zu singen, und ›wie Donnerhall‹ pflanzte sich der Sang fort, bis draußen die Zehntausende entblößten Hauptes das alte Siegeslied sangen; den Kürassierschwadronen liefen die hellen Tränen von den Wangen […]«67 Bismarck nahm ein nationalliberales Reichstagsmandat an, er ging auch noch sehr viel mehr als in seiner Zeit als Reichskanzler auf den publizistischen Markt, gewann die Hamburger Nachrichten als sein Sprachrohr, daneben auch die Münchner Allgemeine Zeitung, und er konspirierte und kommunizierte mit Maximilian Harden, einem verlässlichen publizistischen Feind des Kaisers. Zu seiner Genugtuung konnte Bismarck erleben, dass die Ära seines Nachfolgers Caprivi, innenpolitisch im Zeichen einer liberalen Öffnung, außenpolitisch im Zeichen der Nichtfortsetzung des geheimen Rückversicherungsvertrages mit Russland, auf den sich Bismarck so viel zugute hielt, denkbar kurz blieb: zwei Jahre im Amt des preußischen Ministerpräsidenten, vier Jahre im Amt des Reichskanzlers. Bismarcks Anhängerschaft umfasste nicht die ganze deutsche Gesellschaft, aber doch einen beachtlichen Teil. Überspitzt formuliert kann man es vielleicht so sagen: Jetzt, in seinen letzten Lebensjahren, erreichte der Prozess einer Entborussifizierung wie Germanisierung seinen Abschluss. Bismarck wurde zum nationalen Idol des Bürgertums, der Akademiker, in besonderer Weise der Burschenschaften an den deutschen Universitäten. Und man kann mit einigem Grund sagen: Er inszenierte und genoss diesen Prozess, der seinen Höhepunkt bei zwei Anlässen fand: bei Bismarcks Mittel europareise von 1892, über Dresden, Wien, München und Bad Kissingen, aufgezogen wie ein nationales beziehungsweise großdeutsches Happening;68 und bei Bismarcks 80. Geburtstag am 1. April 1895, der zum großen Nationalfest und zugleich schon zum Abschied von ihm wurde. Dabei kam es Bismarck noch zugute, dass eine Reichstagsmehrheit aus Zentrum, Linksliberalen und Sozialdemokraten eine Woche zuvor, am 23. März, eine Grußadresse des Parlaments an den Jubilar abgelehnt hatte. Nun musste sich der Kaiser süß-säuerlich mit seinem Exkanzler solidarisieren. Er gab ein Bankett im Berliner Schloss, während in Friedrichsruh sechs Militärkapellen aufspielten, 10 000 Telegramme und 450 000 Zuschriften eingingen. Gut drei Jahre später verstarb Bismarck. Aber auch aus dem Schatten des Toten konnte sich Wilhelm II. zeit seines Lebens nicht befreien. Der Reichsgründer ragte als Mythos und als stiller Vorwurf gegen den seit dem 10. November 1918 im niederländischen Exil weilenden Kaiser bis weit in die zwanziger Jahre hinein. Den einen, die sich wie Gustav Stresemann nun an eine Ausgleichspolitik mit den Siegern des Ersten Weltkrieges machten, galt Bismarck als Vorbild für Realpolitik; den anderen, die wie die Deutschnationalen schlicht die Vergangenheit glorifizierten, diente er als Symbol einer überhöhten Vergangenheit und damit zugleich als stiller Vorwurf gegen die neue Republik.
Jeder der vier hier in die Betrachtung einbezogenen Kanzler war bemüht, das Urteil der Nachwelt möglichst selbst zu prägen, ja, was in keinem Falle gelingen konnte, gültig festzuzurren. Den größten Aufwand trieb aus diesem Quartett bis heute Helmut Kohl, am wenigsten manipulativ und am meisten wohl im Stile eines Chronisten ging Konrad Adenauer vor. Seine Erinnerungen gelten heute noch als aussagekräftige Quelle dafür, wie die frühe Bundesrepublik auf Westkurs getrimmt wurde.69 Bismarcks und Adenauers Memoirenwerk unterscheiden sich gravierend. Adenauer arbeitete mit hohem Dokumenteneinsatz, Bismarck wollte Genugtuung. Die jeweilige Gegenwart stimulierte ihn dazu, danach die jeweils geschilderte Vergangenheit auszurichten. »Bismarck, der Realist, war darauf bedacht, die Unfähigkeit seiner Nachfolger bloßzustellen. Bismarck, den Narzissten, gelüstete es, aller Welt zu offenbaren, wie schäbig man mit ihm verfahren war. Bismarck, der Pädagoge wollte die nächste Generation in den Prinzipien unterweisen, auf denen jede deutsche Außenpolitik gründen müsse. Bismarck, der Monarchist, zögerte, das Ansehen der Dynastie zu beschädigen. Dieser letzte Bismarck scheint die Vorherrschaft gehabt zu haben, doch nur um Haaresbreite […].«70 Aber so antipodisch Bismarck und Adenauer auch vorgingen, beide bedurften sie einer verlässlichen disziplinierenden, mitunter verzweifelnden Hilfestellung: In Adenauers Fall war es seine frühere Mitarbeiterin Anneliese Poppinga. Sie stellte das Gerüst zur Verfügung und recherchierte die Materialien. Ohne sie hätte es ebenso wenig je Memoiren Adenauers gegeben wie ohne Lothar Buchers Fron in Friedrichsruh die Erinnerungen Otto von Bismarcks. Bucher tat sich noch sehr viel schwerer als Anneliese Poppinga: Mit sehr viel weniger Material musste er aus den assoziativ-unsystematischen Erzählungen Bismarcks etwas machen, die Diktate wie ein Puzzle neu zusammenlegen. Die Gedanken und Erinnerungen erschienen wenige Monate nach Bismarcks Tod im November 1898. Der dritte Teil, mit der Kritik an Kaiser Wilhelm II. und der Entlassung im Mittelpunkt, folgte erst nach dem Ende der Monarchie 1921. Bismarck und Helmut Kohl haben sich über ihr je eigenes Memoirenwerk hinaus eines weiteren Kunstgriffes bedient: Sie gewährten ihnen nahestehenden Historikern noch in ihrer Amtszeit privilegierten Aktenzugang und taten so das ihnen Mögliche, um ein wissenschaftliches Bild ihrer Zeit vermitteln zu können. In beiden Fällen stand dabei naturgemäß das Zentralereignis ihrer Epoche im Mittelpunkt, bei Bismarck die Reichsgründung, bei Kohl die deutsche Wiedervereinigung. Mit anderen Worten: Was für Bismarck der nationalliberale, kleindeutsch orientierte Historiker Heinrich von Sybel war, wurde für Helmut Kohl der Politikwissenschaftler Werner Weidenfeld mit einer Arbeitsgruppe, die die verschiedenen für die Wiedervereinigung Deutschlands 1989 / 90 relevant anmutenden Themenfelder darstellte. Sybel war seit 1875 Direktor der preußischen Staatsarchive. Bismarck gewährte ihm qualifizierten Aktenzugang, und auf dieser Grundlage erschien 1889 bis 1894 das siebenbändige Werk Die Begründung des Deutschen Reichs durch Wilhelm I. Der einschlägige Brockhaus-Artikel resümierte 1934: »Die Darstellung erstreckt sich ausschließlich auf die politische Entwicklung und das Wirken Bismarcks.«71 Der erst in Mainz, dann in München lehrende Politikwissenschaftler Werner Weidenfeld galt als CDU-orientiert und in diesem Spektrum deutlich eher auf dem europäischen als auf dem nationalen Flügel stehend. Weidenfeld war vor allem durch Publikationen zur Legitimierung einer stetig fortschreitenden Intensivierung der europäischen Integration hervorgetreten. Er gehörte zu jenen, die die Deutsche Frage in einer künftigen europäischen Struktur aufgehoben sahen.72 Sein eigenes Opus magnum über den außenpolitischen Kontext der deutschen Wiedervereinigung »basiert auf einer Fülle von internen Dokumenten der Bundesregierung, die in der Regel einer dreißigjährigen Sperrfrist unterliegen. Eine Sondergenehmigung hatte den Zugang bereits wenige Jahre nach Abschluss des Einigungsprozesses eröffnet, was sonst nach dem Jahr 2020 ein Fall für die Historiker gewesen wäre.«73 Freilich ließ es Kohl nicht damit sein Bewenden haben. Im selben Jahr wie die Bände der Arbeitsgruppe um Werner Weidenfeld zur Geschichte der Deutschen Einheit 1998 erschien eine Sonderedition aus den Akten des Bundeskanzleramtes zum Wiedervereinigungsgeschehen.74 Und dieses Gesamtopus wurde also gerade noch auf den Weg gebracht und abgeschlossen, bevor durch den Wechsel im Kanzleramt von Helmut Kohl zu Gerhard Schröder Hindernisse hätten aufgebaut werden können. Kohl selbst hat bislang, neben einem Spezialband zur deutschen Einheit75, ein dreibändiges Memoirenwerk vorgelegt. Und dies einmal mehr mit dem Anspruch des politischen Akteurs, seine und die Geschichte seiner Zeit definitiv darstellen zu können – was ihm freilich so wenig gelingen wird, wie allen anderen Memoirenschreibern vor und nach ihm: »In meinen Erinnerungen geht es mir wesentlich darum, zu erklären, was wir damals warum und wie entschieden haben […]. Damit erhalten die Leserinnen und Leser einen unverstellten Einblick in jene schicksalhaften Jahre unserer Republik und in die komplizierten politischen Zusammenhänge dieser Zeit.«76 Im Falle der vierbändigen Denkwürdigkeiten des Fürsten Bülow, die er aus gutem Grund erst nach seinem Tode 1930 und1931 erscheinen ließ, ist der extrem hohe, auf die Spitze getriebene Subjektivitätsgrad so offenkundig, dass sich die Frage nach einer Dekonstruktion dieses Memoirenwerkes gar nicht mehr stellt. Bülow erscheint als genialer Politiker, unbestechlicher Beobachter von Zeit und Zeitgenossen wie als unübertrefflicher Bildungsbürger mit einem Zitatenvorrat ohnegleichen. Aber wer all das als Lektürevoraussetzung mit einer gewissen Ironie akzeptiert, mag von diesen vier Bänden Denkwürdigkeiten, die die Geschichte des Kaiserreiches auf ihre Weise bemerkenswert vielgestaltig vermitteln, vielleicht mehr profitieren als von einem Memoirenwerk, das auf der uneinlösbaren Prämisse von Objektivität beharrt.