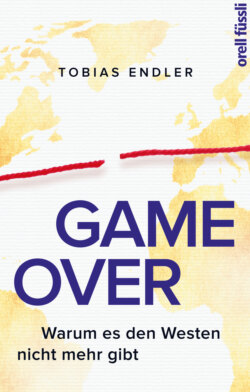Читать книгу Game Over - Tobias Endler - Страница 10
Rückzug der Supermacht
ОглавлениеFünf Gründe sind entscheidend dafür, dass sich die Amerikaner auf Dauer aus der Welt im Allgemeinen und unserem Teil der Welt im Speziellen zurückziehen werden (unabhängig davon, wer ab Januar 2021 im Weißen Haus residiert).
Erstens ist diese Entwicklung nicht neu. Die Tradition des Isolationismus bildet den einen der beiden Stränge, die sich durch die Geschichte der Vereinigten Staaten ziehen. Der andere Strang ist der missionarische Drang Amerikas, die Welt an sich teilhaben zu lassen. Genauer: Das eigene Staatsmodell und die eigene Nation als globale Speerspitze der Demokratie und freien Marktwirtschaft zu sehen. Aus europäischer Warte erscheint der Missionar Amerika klar prominenter als der Eremit Amerika. Dies vor allem mit Blick auf das lange 20. Jahrhundert, also Amerikas Engagement in den beiden Weltkriegen, im Kalten Krieg und in der Phase nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion bis hin zu den Kriegen in Afghanistan, Irak und Libyen. Diese Einschätzung ist richtig, aber auf einen bestimmten zeitlichen wie räumlichen Korridor beschränkt. Und sie erzählt bei weitem nicht die ganze Geschichte. Schon gar nicht bei einer Nation von den Dimensionen Amerikas, die fähig ist, das Missionarische und das Eremitische zu vereinen. George Washington hatte sein Volk schon Ende des 18. Jahrhunderts vor außenpolitischen Verstrickungen (foreign entanglements) gewarnt. Auf den ersten folgte später der fünfte Präsident der USA, James Monroe, und die nach ihm benannte Monroe Doktrin gegen eine Einmischung der europäischen Kolonialmächte in Amerika – und umgekehrt. Über den siebten Präsidenten der USA Andrew Jackson – dessen Porträt Trump im Oval Office anbringen ließ – bis zur America First-Bewegung zwischen den Weltkriegen zieht sich das Motiv des amerikanischen Rückzugs auf sich selbst.
Diese Linie reißt bis zum heutigen Tag nicht ab. Vielmehr wächst ihre Attraktivität in den Augen der Bewohner eines Landes, das sich auch im Inneren massiv verändert. Mit anderen Worten: Selbst wenn wir aus US-Sicht als transatlantische Partner alles »richtig« machen würden – und warum sollte dies unsere Leitlinie sein? –, gäbe es die über Jahrhunderte bestehende Tendenz der USA zum Isolationismus. Das macht es für Deutschland und Europa nicht leichter. Gefährlich wird es allerdings, wenn wir das Wesen dieses Isolationismus nicht durchschauen. Und uns nicht verdeutlichen, warum er gerade jetzt eine Renaissance erlebt. Mehr dazu im Kapitel »Disneyland Amerika« ab Seite 43.
Der zweite Grund ist sehr viel jünger. Er ist im Verlauf der letzten zwanzig Jahre bedeutend geworden und hat mit dem gegenwärtigen Naturell der USA zu tun. Die Rolle und der Einfluss der Massenmedien auf den öffentlichen Meinungsbildungsprozess hat eine Dimension erreicht, die zur Jahrtausendwende nicht vorstellbar war. Ganz zu schweigen von den 60er- und frühen 70er-Jahren, also der Zeit, in der ein Großteil derjenigen geboren wurde, die heute den harten Kern der Trumpianer ausmachen. »Das Medium ist die Botschaft«, so hatte es 1962 der kanadische Medienphilosoph Marshall McLuhan ausgerufen. McLuhan war seinerzeit der Superstar seiner Zunft. Jenseits davon hielten ihn viele für einen Spinner, manche für einen Visionär. Sicher ist: Er hätte sich die enorme Diversifizierung und Öffnung der Medienlandschaft in den digitalen Raum hinein nicht vorstellen können. Für die nachfolgende Generation ist es schlicht die Welt, in der wir leben.
Das Dauerfeuer medialer Inszenierung lässt die Menschen nicht mehr zur Ruhe kommen. Beim für amerikanische Verhältnisse gemäßigten Nachrichtensender CNN ist beinahe alles breaking news. Dementsprechend fallen Aufmachung, Tempo und musikalische Untermalung zu den Meldungen des Tages aus. Im Vergleich zur Konkurrenz bei Fox News wirkt CNN beinahe bieder. Auch ein Grund, warum Fox in den USA deutlich mehr Zuschauer hat – die ausschließlich Fox sehen, also ganz bewusst niemals CNN einschalten. So kommt es zum Tunnelblick auf Politik und Gesellschaft. Beide TV-Sender verblassen im Vergleich zur Reichweite der Talk Radios. Eine US-amerikanische Spezialität, wo größtenteils konservative Kommentatoren ununterbrochen ihre persönliche – und offen parteiische – Sicht auf das politische Geschehen feilbieten. Die Rush Limbaugh Show hat ca. 15 Millionen Zuhörer pro Woche. Limbaugh und seine Kollegen kennen ihr Publikum genau und beschallen es rund um die Uhr, inklusive der Werbeblöcke, die sie gleich miteinsprechen.
Schließlich sind in den letzten beiden Jahrzehnten Giganten auf dem Feld der Sozialen Medien herangewachsen, die kaum jemand auf der Rechnung hatte. Die Tech-Riesen Facebook, Amazon, Apple und Google (bzw. dessen Muttergesellschaft Alphabet) bewegen sich in einer eigenen Umlaufbahn, bislang scheinbar jenseits politischer Kontrolle. Doch nun wird dieser Tage ihre Rolle und Reichweite in den westlichen Demokratien kritisch durchleuchtet. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg sah sich vor dem US-Kongress einer stundenlangen Befragung ausgesetzt, nicht zuletzt, weil es berechtigten Grund zur Annahme gibt, dass sein Imperium bei den Wahlen 2020 erneut mitentscheidend sein könnte. Dabei hat sich Facebook nie im demokratischen Prozess legitimiert. Es ist, wenn auch häufig so genutzt, keine Informationsplattform. Sondern ein gewinnorientiertes – und börsenorientiertes – Unternehmen. Zuckerbergs Koloss fährt im dritten Quartal 2019 über sechs Milliarden Dollar Gewinn ein. Die großen Vier der Digitalbranche bringen es 2018 auf gewaltige 640 Milliarden Dollar Umsatz. Zum Vergleich: Die Schweiz weist für dasselbe Jahr ein Bruttoinlandsprodukt von rund 700 Milliarden Dollar aus.
Der Einfluss sämtlicher dieser Foren auf ein Land im Dauerwahlkampf ist enorm. Plattformen wie Facebook, YouTube, Tumblr und Instagram versprechen Weltläufigkeit, schließlich sind Neuigkeiten von allen Ecken und Enden des Planeten in Echtzeit verfügbar. Neue und lange Zeit ungekannte Netzwerke grenzüberschreitender Reichweite wachsen rasant. Deren Auswirkungen auf den politischen Prozess sind derzeit noch nicht abschätzbar. Wie Zuckerberg erst unter massivem Druck der Kongressabgeordneten zugibt, nutzen auch demokratiefeindliche Kräfte digitale Foren als Megafon ihrer Botschaften. Facebook hat hier bisher nur Lippenbekenntnisse zu bieten, was deren Eindämmung betrifft. Und sieht offenbar (noch) keinen zwingenden Handlungsbedarf. Warum auch, könnte man fragen, wenn man etwa Zeuge wird, wie der greise Senator Orrin Hatch (mittlerweile aus dem Senat ausgeschieden) Zuckerberg fragt, wie dessen Geschäftsmodell sich ohne Gebühren überhaupt tragen könne. Ein Moment der Heiterkeit, der fehl am Platz ist, schließlich hat Facebook just zu diesem Zeitpunkt ein Datenleck von 87 Millionen Accounts zu verantworten, abgeerntet durch die Beraterfirma Cambridge Analytica, die nichts mit der Eliteuniversität Cambridge, aber einiges mit der passgenauen Modellierung politischer Kampagnen in den USA, Großbritannien und anderswo zu tun hat.
Dieser Dilettantismus der politischen Vertreter/-innen macht es denjenigen, die sie gewählt haben, leicht, sich abzuwenden. Die Institutionen der ältesten existierenden Demokratie der Welt versagen in erschreckendem Maße in ihrer Kontrollfunktion. Von einer moderierenden oder auch nur informierenden Rolle gegenüber dem Volk sind sie gegenwärtig ein ganzes Stück entfernt. Viel zu sehr ist man mit der Fehde zwischen Weißem Haus und Kongress und der eigenen Wiederwahl beschäftigt. Ja, es gibt wichtige Ausnahmen. Da ist die junge Generation engagierter Volksvertreterinnen, die unerschrocken dafür kämpft, dass das moderne Amerika in all seiner Diversität endlich auch im Kongress ein Gesicht bekommt. Die einstige Barkeeperin puerto-ricanischer Herkunft aus der New Yorker Bronx, die offen zu ihrem sozialistischen Politikideal steht und das größte politische Talent ist, das die Demokraten seit Obama hervorgebracht haben. Die erste eingebürgerte Abgeordnete afrikanischer Herkunft, die muslimischen Glaubens ist, und die erste offen bisexuelle Amtsinhaberin, die vorübergehend in ihrem Leben obdachlos war. Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Kyrsten Sinema. Sie alle müssen gegen starke Vorurteile in der Bevölkerung ankämpfen, die ihnen ihre Vorgänger, überwiegend weiße ältere Männer wie der bei seinem Abtritt 84-jährige Hatch, eingebrockt haben. Denn viele Amerikaner außerhalb des Washingtoner Gürtels gehen mittlerweile reichlich desillusioniert davon aus, dass sich dort eine korrupte Kaste aus Politikern, Politikberatern und Lobbyisten ihren Vorteil sichert.
Die Frage liegt nahe, ob wir in diesen Zuständen die eigene Zukunft sehen, wie sie uns mit der üblichen transatlantischen Verzögerung von 5–10 Jahren ins Haus stehen könnte. Eine nicht von der Hand zu weisende Gefahr. Der Wahlkampf 2020 bringt sie ans Licht. Wir sollten genau hinsehen, auch wenn einem dabei manches Mal die Augen schmerzen. Mehr dazu im Kapitel »Wasserscheide« ab Seite 93.
Der dritte Grund, warum Amerika der Welt den Rücken zuwendet: Weil es kann. Die USA sind ein Land von der Größe eines Kontinents, mit der 27-fachen Fläche Deutschlands. Im Osten und Westen schützen Ozeane gegen ungewollte Besucher, im Norden die menschenleeren Weiten der kanadischen Wälder. Mit ihrem riesigen Binnenmarkt kann sich die Nation selbst versorgen. Seit Neuestem ist man auch energieunabhängig: Es muss kein Öl mehr importiert werden. Vier von zehn Amerikanern verlassen die Vereinigten Staaten ihr ganzes Leben lang nicht, jeder zehnte Bewohner nicht einmal den Bundesstaat, in dem er geboren wurde. Dies klingt weniger abwegig als es zunächst scheint, wenn man sich klarmacht, dass Texas alleine größer ist als Frankreich, die Schweiz und die Benelux-Staaten zusammen. Der Luxus, in einem Land dieser Größenordnung zu leben, hat natürlich auch eine Kehrseite. Das Bedürfnis, sich mit der Welt »da draußen«, außerhalb der Landesgrenzen auszutauschen, sinkt. Erfahrungen mit »den anderen« gehen verloren. Das Eigene wird zum absoluten Maßstab – America First.
So gesehen gilt das alte Klischee vom American Exceptionalism, der Einzigartigkeit und Sonderstellung Amerikas, noch immer. Man will aber nicht mehr länger die leuchtende Stadt auf dem Hügel sein. Derart hatten sich die Gründerväter das junge Land einst vorgestellt. The city upon a hill, an der sich die Welt ein Beispiel nimmt. Und faktisch ist der Glanz tatsächlich vielerorts verblasst. Um die Großen Seen herum legt sich der rust belt, der Rostgürtel der alten Industriestaaten Pennsylvania, Ohio, Indiana und Michigan. Bis hinauf ins südliche Wisconsin erstreckt sich die schwer gebeutelte Region, früher das Herz der amerikanischen Stahl- und Fertigungsindustrie. Hier fühlen sich viele Menschen als Verlierer der globalisierten Arbeitsmärkte, überrumpelt von der Wucht der Digitalisierung und ihrem Schicksal überlassen von Washington D.C. Eine ganze Generation nimmt ihr Leben als eine einzige Aneinanderreihung von Krisen wahr: die Terroranschläge vom 11. September 2001, die Immobilien- und Finanzkrise der Jahre 2007/08, die großen Fabriken geschlossen, grassierende Schmerzmittelsucht. Im Frühjahr 2020 dann eine Epidemie, die niemand hat kommen sehen, und die den Menschen brutal den Preis vor Augen führt, den ein auf Sand gebautes Gesundheitssystem im Ernstfall verlangt.
Aber – und das ist entscheidend – hier endet die Geschichte nicht. Auch in dieser Hinsicht ist Amerika außergewöhnlich. Das Land hat zwei gigantische Labore eingerichtet, wo zur Zukunft der Nation als Ganzes experimentiert wird. Texas und Kalifornien sind die beiden nach Einwohnerzahl und Fläche (sieht man von Alaska ab) größten Staaten der USA. Hier werden unterschiedliche gesellschaftspolitische Modelle wie wirtschaftliche Innovationen erprobt. Hier lässt sich ablesen, welchen Weg Amerika einschlagen könnte, wenn es um Einwanderung, Bildung und Gesundheitspolitik geht. Und das Selbstverständnis des Landes. Die Geschichte des Rostgürtels erinnert an die Geschichte des Ruhrgebiets. Doch wo ist unser Texas, unser Kalifornien? Unser Austin, unser Silicon Valley? Zentraleuropa sollte sich schleunigst ein Zukunftslabor bauen, schon um den Altlasten der Vergangenheit entgegenzuwirken. Wir altern beständig. Die Vereinigten Staaten sind die einzige westliche Industrienation, die jünger wird. Menschen aus aller Welt wollen dort ihr Glück versuchen. Das kommt nicht von ungefähr – und sollte uns zu denken geben. Mehr dazu im Kapitel »Labore hinter verschlossenen Türen« ab Seite 163.
Es ist offensichtlich: Amerika ist auf absehbare Zeit mit sich selbst beschäftigt. Ebenso offensichtlich ist ein weiterer – vierter – Grund für den Rückzug der USA auf sich selbst. Und doch wurde er von den Europäern und insbesondere den Deutschen lange allzu geflissentlich übersehen. Oder besser überhört. Im Sommer 2011 hält Obamas Verteidigungsminister Robert Gates eine flammende Rede in Brüssel. Das NATO-Engagement ihrer deklarierten Alliierten, der meisten europäischen Staaten und vor allem Deutschlands, ist den Amerikanern nicht genug. Erstere geloben Besserung, letztere warten ab. Neun Jahre später bestreiten die USA noch immer drei Viertel der Verteidigungsausgaben im Militärbündnis. Deutschland wendet 1.35 Prozent seines Staatsetats auf, zu den einst selbsterklärten 2 Prozent vom BIP kann man sich auf absehbare Zeit nicht durchringen. Das tut der Entrüstung keinen Abbruch, als Trump ein knappes Jahrzehnt nach Gates’ eindringlicher Mahnung ein Preisschild an die Bündnispolitik hängt. Ähnlich groß sind die transatlantischen Verstimmungen beim Handel. Trumps radikale Absage an multilaterale Freihandelsabkommen verstört viele, die Jahre zuvor das Freihandelsabkommen TTIP als Zumutung empfanden. Obamas Deutschland-Botschafter John Emerson sagt mir am Rande einer TV-Diskussion, sein Präsident wolle mit TTIP das transatlantische Verhältnis ein Vierteljahrhundert nach dem Ende des Kalten Krieges auf eine neue Ebene heben. Wenig später gibt die US-Regierung entnervt auf. Zu diesem Zeitpunkt haben dreieinhalb Millionen Wallonen das Freihandelsabkommen CETA zwischen 500 Millionen Europäern und Kanada bereits über Monate ausgebremst. Das ist ihr gutes Recht, Entscheidungen wie jene bezüglich CETA werden in der EU einstimmig getroffen. Aber es kostet einen Preis. Ein amerikanisches Sprichwort lautet: You can’t have your cake and eat it, too. Entweder ich genieße den Kuchen und esse ihn auf. Oder ich esse ihn nicht, weil ich seinen Anblick genieße. Beides gleichzeitig geht nicht.
Meinungsverschiedenheiten mit den Bündnispartnern können teuer werden. Den höchsten Preis hat Amerika nach eigener Ansicht jedoch auf den Schlachtfeldern in Afghanistan, im Irak, in Libyen und in Syrien bezahlt. Die Hybris der Bush-Jahre ist vorüber. Niemand erwartet mehr, als Heilsbringer aus dem Westen empfangen zu werden. Bei ihren außenpolitischen Manövern hat sich die letzte Supermacht der Erde in diesem Jahrhundert einmal zu oft verhoben. In diesem Punkt hat sich die vermessene Weltsicht vieler Amerikaner der realistischen Einschätzung vieler Europäer über die Jahre angenähert. Die Zeit der Interventionisten ist vorbei, die Neokonservativen sind in der Versenkung verschwunden. Obama leitete den – rhetorisch elegant verpackten – Rückzug der USA aus diesem Teil der Welt ein, der im Amerikanischen Greater Middle East heißt. Die »konstruktive Entkoppelung«, so die Formulierung des 44. Präsidenten, führt sein Nachfolger Trump nun fort. Im Unterschied zu Obama lässt er keinen Zweifel daran, auf wen sich konstruktiv bezieht. Und wer den längeren Atem hat. Weshalb uns amerikanische Außenpolitik überlegen ist, erläutere ich im Kapitel »Zwischen Jackpot und Trostpreis« ab Seite 193. Ob das zukünftig so bleibt, ist eine andere – und wichtige – Frage. Taugt das US-Modell für die Herausforderungen, die sich im 21. Jahrhundert auf dem Globus stellen? Daran wiederum schließt sich eine Frage an, die wir in Europa paradoxerweise zuerst klären sollten: Wenn das US-Modell nicht tragen sollte, welches Modell lassen wir uns dann rechtzeitig einfallen …?
Der fünfte und letzte Grund für den Rückzug der USA widerspricht dem vierten Grund. So scheint es zunächst. Allerdings nur unter der Annahme, dass US-Außenpolitik nach wie vor vom Streben nach langfristigen Bindungen geprägt ist. Tatsächlich fahren die Amerikaner schon seit geraumer Zeit einen neuen Ansatz: transaktionale Politik. Das kurzfristige Ziel der Profitmaximierung im Auge, werden zeitlich begrenzte Abkommen geschlossen, gleich einer Geschäftsvereinbarung. Solange sie beiden Seiten nützt, hat sie Bestand. Ansonsten kann sie jederzeit aufgelöst werden. Sodann spricht nichts dagegen, mit der Konkurrenz des Geschäftspartners einen anderen Deal einzugehen. Oder auch Abkommen mit einem Gegenüber zu treffen, dessen Wertvorstellungen man ansonsten nicht teilt. Der Geschäftsmann an der Spitze der US-Regierung steht für dieses Gebaren wie niemand vor ihm; stilecht wurde schon so manches Geschäft der internationalen Beziehungen auf dem Golfplatz abgeschlossen. Moralisch angreifbar in ihrer Skrupellosigkeit, ist diese Herangehensweise zunächst einmal im uramerikanischen Sinne pragmatisch – und auch unter einem möglichen Präsidenten Biden durchaus wahrscheinlich. Ideologie spielt nur eine untergeordnete Rolle. Allenfalls besteht die Ideologie in der Unberechenbarkeit für die andere Seite. Die Ausnahme stellt das Leitmotiv »Amerika zuerst« dar, das immer gilt.
So betrachtet gibt es ein stimmiges Konzept der Amerikaner hinter ihrem Rückzug aus dem transatlantischen Raum, ihrer strategischen Abwertung des Nahen Ostens und ihrem gleichzeitig punktuell sehr entschiedenen Engagement z.B. im Fernen Osten. Entgegen aller Beteuerungen der Obama-Regierung gilt: Der Achsendreh der Amerikaner nach Asien bedeutet, dass den Europäern der Rücken zugedreht wird. Die Zukunft liegt aus US-Sicht in China und darüber hinaus im indopazifischen Raum. Die Achse »Hollywood-Bollywood« gewinnt rasant an Bedeutung. Doch bis auf Weiteres steht im Zentrum der Aufmerksamkeit China, dessen Aufstieg nach Ansicht der Amerikaner nur China selbst verhindern kann. Unter Aufmerksamkeit ist eine Mischung aus Argwohn, Profitgier und Konkurrenzgebaren um die globale Vorherrschaft zu verstehen. In jedem Fall höchstes Interesse. Hiervon bleibt für die alten Partner im Westen (verstanden als Wertegemeinschaft, denn geografisch liegen wir aus US-Sicht im Osten) herzlich wenig übrig. Ein »New Kid in Town« Moment, den die Eagles auf Hotel California bereits Mitte der 70er-Jahre besungen haben. Heute ein dringender Weckruf für Europa. Mehr hierzu ebenfalls im Kapitel »Zwischen Jackpot und Trostpreis« ab Seite 193.