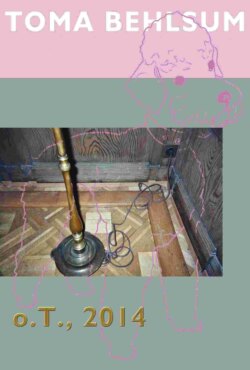Читать книгу o.T., 2014 - Toma Behlsum - Страница 7
1 Willi und Hans, Söhne eines Kleinbauernpaares im Westallgäu
ОглавлениеEin klarer warmer Sommernachmittag im Juli, es riecht nur ganz wenig nach Kuh, ein Tag wie geschaffen, vor dem Haus zu sitzen, ein Bier zu trinken. James, der eigentlich Johann heißt und damals noch Hans gerufen wird, 15 Jahre alt, und Willem, der Wilhelm heißt und Willi gerufen wird, 14 Jahre alt, die beiden Söhne des Mooshofbauern, sitzen so auf der Bank neben der Haustüre vor dem Haus, auf der noch mit verschmierter Kreide C+B+M 81 zu lesen ist, und versuchen, mit sich im Reinen zu sein oder zumindest so zu tun, als wäre alles im Reinen. Es gibt Presssack mit Brot und Tomaten.
‚Mahlzeit’, sagt Hans, und Willi nickt, dann spricht keiner mehr, weil sie beide mit essen und trinken beschäftigt sind. Hans holt zwei weitere Flaschen Weizenbier aus dem Haus.
Willi hat seit einer Woche die Volksschule beendet, damals hieß die Grund- und Hauptschule / Mittelschule noch Volksschule, und Hans macht seit einem Jahr eine Kochlehre im Gasthaus zur Post in dem Hauptort der Gemeinde, der aber auch nur ein Dorf mit dreitausend Einwohnern ist. Kochlehre heißt, er schält seit einem Jahr Kartoffeln und wäscht Salat, er beschwert sich nicht, er hat es nicht anders erwartet, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Auch wenn die zweite Hälfte des 20. Jahrhundert auch auf dem Land schon eingetroffen ist klingt die erste Hälfte gelegentlich noch nach.
Der Mooshof ist ein kleiner Hof, alles ist klein, die Felder, das Haus, die beiden Söhne und auch der Bauer selbst und die Bäuerin waren klein, als beide noch da waren, der Vater klein und dünn, mit einem Bauchansatz, der nur deshalb auffällt, weil der Rest so klein und dünn ist, die Mutter klein und dünn mit dünnen blonden Haaren, Willi ist dünn, klein sowieso, da ja noch jung, nur Hans ist klein und moppelig, so dass sich jemand, der darüber nachgedacht hätte, darüber gewundert hätte, dass das ein Sohn vom Mooshof sei, was aber nie jemand tat.
Im Erdgeschoß des Kleinbauernhauses gehen nach Osten vom Flur zur Giebelseite zwei kleine Zimmer ab, die Küche und das Wohnzimmer, die durch eine Türe verbunden sind. Im ersten Stock sind nochmals genau die gleichen beiden kleinen Zimmer, eines war bis vor kurzem noch das Schlafzimmer des Bauern und seiner Frau, und eines das der beiden Söhne, die jetzt jeder ein eigenes Schlafzimmer bewohnen.
Das Haus hat drei Eingänge, den Haupteingang zur Straße, der immer verschlossen ist, auf der gegenüberliegenden Seite des Flurs den Hintereingang zum Garten, der auch immer verschlossen ist, und einen Eingang innen neben dem Stall, den Eingang von der Tenne her, der immer offen ist. Die Tenne ist im hinteren Teil, wo das Gelände leicht abschüssig ist, mit Balken abgestützt, seit die beiden Jungen denken können, und alle paar Jahre ist einer dazugekommen, weil der Vater mit seinen beiden Berufen als Nebenerwerbslandwirt und Rohhüteformengießer ausgelastet ist und sich nicht auch noch um faulende Balken und herabfallenden Putz kümmern konnte.
Weil aber der Kuhstall direkt an den Flur angrenzt und die Türen alt und luftdurchlässig sind, riechen die Brüder von ihrer Geburt an bis zu ihrem Auszug aus dem Mooshof in von jetzt ab vier Jahren und einem Monat nach Kuhstall, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, im Winter vermischt mit dem Rauch des Küchenofens, der einzigen Wärmequelle im Haus, von den Kühen einmal abgesehen. Irish Moos und Boss for men machtlos.
Seit ein paar Wochen sind Hans und Willi nun schon ganz allein auf dem Hof. Hans, das Lieblingskind des Vaters, ist der Ältere, er ist wie erwähnt rundlich und gemütlich, Willi, das Lieblingskind der Mutter, ist dünn und aggressiv, aber die Mutter hatte sehr wohl erkannt, dass auch die gemütliche bärchenhafte freundliche Art von Hans im Ergebnis Ego pur sein kann und dass die emotionslose Aggressivität Willis sie sehr an sich erinnert.
Verschwunden ist dann zuerst die Mutter.
Über viele Jahre hat die Verzweiflung über ihr armseliges Dasein ihre Eltern noch notdürftig zusammengehalten, und die Bewunderung der Mutter für diejenigen, die es zu etwas gebracht haben, zu was auch immer, respektive deren Verachtung durch den Vater, Hauptsache gleiches Subjekt. Ihr Verschwinden hatte sich aber im Grunde genommen seit 15 Jahren abgezeichnet, seit ihr frisch angetrauter Ehemann, der einzige Sohn eines Kleinbauern und Student der Linguistik und Ethnologie, so genau hatte sie es damals nicht verstanden, nach dem plötzlichen Tod seiner Eltern sein Studium ‚aussetzte’, Hochbegabtenstipendium hin oder her, um sich ‚erst einmal’ um den Hof zu kümmern, und dann nicht mehr damit aufgehört hatte.
Monate vor ihrem tatsächlichen physischen Verschwinden musste sie, immer wenn der Vater zu Hause war, zur Elternsprechstunde. Elternsprechstunden gibt es in den 80er Jahren aber nicht, die Einrichtung wäre auch sinnlos, da die beiden Lehrer, einer für die Klassen 1-4 und einer für die Klassen 5-8, und die Eltern ihrer insgesamt 14 Schüler alle im Dorf und im Umkreis von 3 Kilometer rund um das Dorf wohnen und sich ganz ohne ihr Zutun fast täglich begegnen. Sowiesobegegnungen sozusagen. Die beiden Brüder erwarteten anfangs noch eine Reaktion als Resultat der vielen Elternsprechstunden, etwa ‚der Herr Lehrer meint, du sollst dich mehr auf die Rechtschreibung konzentrieren’, aber als diese ausbleibt beschäftigten sie sich nicht mehr damit, und der Vater hatte dafür keine Zeit, er war vollauf damit beschäftigt Bauer, oder, genauer, Nebenerwerbslandwirt zu sein, und Schichtarbeiter in der Hutfabrik, und daneben seiner Familie geistige Kapriolen und Luftsprünge zu präsentieren, die aber nur Hans und Willi hören wollten, und Willi auch nur deshalb, um daraus zu lernen, alles ganz sicher anders zu machen.
‚Die Tenne müsste mal neu abgestützt werden’ entgegnet die Mutter darauf nur, oder ‚Die Kuh ist schon wieder krank und bräuchte Antibiotika’, woraufhin der Vater stets mit ‚kommt nicht in Frage, keine Antibiotika’ antwortet.
Immer, wenn der Vater nicht da war, also oft, blieb die Mutter zu Hause und der Lehrer für die Klassen 5 – 8 kam vorbei, es dauerte lange, bis der Vater, der mehr in den Wolken lebte als auf den Feldern, davon Kenntnis zu bekommen bereit war. Als er nicht mehr umhin kam es zu merken, packte die Mutter den größten Koffer aus ihrem Kofferset, das sie mit in die Ehe gebracht hatte, und das aus insgesamt drei braunen genoppten Lederkoffern bestand, und verschwand. Die beiden kleineren Koffer lies sie zurück, und alles andere, das nicht in den großen Koffer passte, so wie ihre Söhne, ebenfalls. Das Land, sagte sie, selbst Tochter eines Bauern aus der Gegend, kurz vor ihrem Verschwinden, das brauche ich nicht, das Land macht krank, das ganze Jahr liegt das Land unter einer dünnen Schicht Bschütte*, und nur im Winter deckt der Schnee für ein zwei Monate alles zu. Ein Professor für Linguistik und Völkerkunde wäre schön gewesen, aber ein simpler Lehrer geht zur Not auch, um hier wegzukommen.
Der Lehrer lässt sich daraufhin in die Bezirkshauptstadt versetzen und die Söhne haben beide nie mehr wiedergesehnen. Zum nächsten Weihnachten schickt die Mutter ihnen noch eine Weihnachtskarte, die aber genau so aussieht wie die Weihnachtskarte, die sie vor Jahren einmal an eine Freundin geschrieben hat und dann vergessen abzuschicken, dann nicht mehr.
Der Vater, unbeugsam und unbelehrbar, wartet noch einige Wochen, ob sie nicht doch zurückkommt, überschreibt dann den Söhnen den Hof, gibt jedem von ihnen noch 1000 Mark und die Schlüssel für Haus und den alten Opel und geht dann ebenfalls. Was die 14 und 15 Jahre alten Buben mit einem Auto anfangen sollen sagt er nicht dazu.
Die Brüder nehmen den Verlust ihrer Familie ohne weitere äußere Gefühlsregung zur Kenntnis, in Kleinbauernhöfen sind Kinder von Respekt den Eltern gegenüber geprägt und nicht von zitierter Affenliebe wie in den Einfamilienhäuser am Stadtrand. Fortan übernimmt Willi, der hagere, harte Junge die Rolle der Mutter, während der rundliche gemütliche Hans die des Vaters übernimmt.
Sie bewirtschaften den Hof jetzt eben selbst, und nur nachts weinen sie gelegentlich, wenn der andere es nicht merkt, weil jetzt ja jeder ein eigenes Zimmer hat. Wenn jemand nach ihren Eltern fragt, was selten passiert, weil sie keinen Kontakt zu ihren Nachbarn haben, ihre Eltern schon nicht hatten, von ihre Mutter und ihrem Volksschullehrer einmal abgesehen, sind die Eltern gerade nicht da, krank im Bett, oder sonst wo. Sie leben auf einer Insel mitten im Land.
Die beiden Buben haben Angst vor dem Jugendamt, es ist aber ihre einzige Angst. Sie haben beschlossen, den Hof so lange zu bewirtschaften, bis Wilhelm 18 Jahre alt ist und Johann dann 19. Dann können und werden sie ihn verkaufen und ebenfalls weggehen, und nie mehr wiederkommen. Sie wollen alles anders machen. Ein Kleinbauernhof ist ein Kleinbauernhof, damit kann man nichts anders machen, das war ja schon das Dilemma ihrer Eltern die ganzen Jahre.
Das Land, sagen sie sich wie ihre Mutter auch, das brauchen wir nicht, das Land macht krank, das ganze Jahr liegt das Land unter einer dünnen Schicht Bschütte, und nur im Winter deckt der Schnee für ein zwei Monate alles zu.
Zu ihren Kühen sind sie nicht unfreundlich, haben aber keine Bindung an sie, und ihre Nachbarn meiden sie, und die wiederum haben auch kein Interesse an den zwei sonderbaren Kindern, höchstens Angst, sie könnten ihnen auf irgendeine Weise zur Last fallen. Die Nachbarn haben genug mit sich selbst zu tun und mit ihrer Arbeit und der Arbeit nach der Arbeit, und wenn sie nicht arbeiten schauen sie in den Fernseher, gehen sie zum verkaufsoffenen Sonntag nach Lindenberg und zur Wahl der Hutkönigin, oder fliegen eine Woche all inklusive nach Mallorca.
Verkaufsoffene Sonntage, die Wahl der Hutkönigin und all inclusive Urlaube interessieren die Brüder nicht, und nur gelegentlich verlassen sie ihre Insel und laufen in das nächste Dorf zu Omnibushaltestelle und fahren dann in die Kreisstadt, die Dinge zu besorgen, die sie nicht selbst herstellen können und um das andere Leben zu betrachten. Die beiden Brüder warten drauf, endlich volljährig zu werden. Warten auf die große Geste, vollbracht aber nicht etwa von irgend jemand anderem, vollbracht von ihnen selbst.
Wenn Hans hört, wie Willi nachts in seinem Zimmer auf und ab geht, fragt er ihn, ob er denn nie müde werde, aber Willi schläft nicht.
‚Schlafen kann ich wenn ich tot bin’, sagt er, aber nicht wegen der Kultur, wie Fassbinder, auch nicht wegen der Arbeit auf dem Hof, die er emotionslos verrichtet, er schläft nicht, weil er reich und mächtig, berühmt und schön werden möchte und ständig überlegt, wie er das bewerkstelligen könnte. Irgendwo da draußen rast die Welt dahin und er möchte dabei sein, mitwirken an der Raserei. Kultur und Kühe sind etwas, das er dabei nun wirklich nicht brauchen kann, er schaut sich noch nicht einmal Filme mit Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone an, den Idolen der Landjugend, geschweige denn, dass er ins Theater ginge, er ist vollauf damit beschäftigt, im Kopf sein eigenes Leben zu erfinden und zu inszenieren, erfundenen Fremdleben zuzuschauen bringt ihm da überhaupt nichts, noch nicht einmal als Anregungen. Wenn das Leben Geld verdienen ist, stellt er sich vor, und Rivalen aus dem Weg räumen, dann ist die Kultur dazu koksen und ficken.
Hans will auch reich werden, aber an mächtig, berühmt und schön findet er nichts, eher bewundert und glücklich. Die Welt draußen rast und er will dabei sein und mithelfen, sie anzuhalten.
‚Ich werde ein Künstler werden’, sagt er zu Willi.
‚Was jetzt’, schreit Willi dann und boxt ihm in den Arm. Hans ist es schon gewohnt, in den Arm geboxt zu werden und reagiert nicht darauf.
‚Egal’, sagt er.
‚Egal was? Irgendwas?’
‚Egal’ wiederholt Hans. ‚Ein Künstler ohne Werk. Ein Bohemien.’ Das Wort Bohemien gefällt ihm, das kennt er aus Erzählungen seines Vaters, auch wenn er noch nicht so genau weiß was es bedeutet.
Die Sonne geht unter und sie gehen ins Haus. Im Haus riecht es genauso wie draußen, nur noch mehr nach Kuh. Hans und Willi möchten irgendwann einmal wo sein, wo es nicht mehr nach Kuh riecht.
Von ihnen aus nach Abgasen oder nach Fisch, oder nach Ölraffinerie, nur nicht nach Kuh.
*Bschütte ist ein alemannischer Ausdruck für Odel oder Gülle. Tatsächlich produzieren die Hochleistungskühe mehr Bschütte / Gülle / Odel als rein rechtlich auf die zur Ernährung der Kühe erforderlichen Felder aufgebracht werden darf, jährlich in Deutschland mehr als 200 Millionen Tonnen. Es wird aber ausdrücklich nicht kontrolliert.