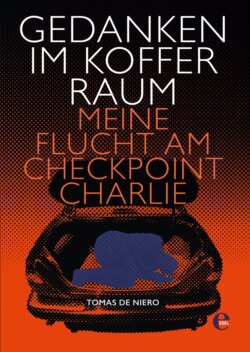Читать книгу Gedanken im Kofferraum - Tomas de Niero - Страница 8
MAMA SCHLÄFT
ОглавлениеNein, es gab doch etwas noch Bedrückenderes, Schmerzhafteres als dieses »Ausgeliefertsein« an völlig fremde Menschen in einem Kinderheim, an Erzieher, die uns den ganzen Tag herumkommandierten.
Die Erinnerung kehrt zurück, unvermittelt und mit aller Macht, hier in dieser Blechkiste, gefangen im Niemandsland zwischen den Welten. Und mit der Erinnerung kommt der tiefe Schmerz zurück, Hand in Hand mit der Verzweiflung.
Ich war etwa neun Jahre alt und schwänzte die Schule. Das heißt, ich war schon auf dem Weg dorthin, ließ mich aber von einem anderen Jungen überreden, zum Nordmarkplatz an der Prenzlauer Allee zu gehen, wo wir uns immer herumtrieben, Fußball spielten und Mädchen beobachteten.
Damit meine Mutter nichts von meiner selbst gewählten Schulfreiheit merkte, ging ich zur gleichen Zeit wie sonst nach Hause, so als wäre die Schule gerade vorbei.
Ich betrat die Wohnung, bog zunächst links ab in die Küche, da war aber niemand, lief den langen Flur hinunter zum letzten Zimmer, meinem Kinderzimmer. Das heißt, eigentlich war es nicht allein meins. Da für uns drei Jungs nur zwei Kinderzimmer vorhanden waren, konnte immer nur einer allein in dem einen wohnen, die anderen beiden mussten sich notgedrungen das andere Zimmer teilen. Das wechselte sich ab, je nach Lage der Dinge. Die Entscheidung darüber, wer für sich sein durfte, fällte Mama als Alleinherrscherin. Wer also besonders artig gewesen war, kam in den Genuss des Einzelzimmers, oft aber verdankte man den Luxus auch der simplen Tatsache, dass die anderen beiden etwas aus gefressen hatten oder man selbst nicht erwischt wurde.
Nachdem ich meine Schulsachen abgestellt hatte, ging ich ins Atelier meiner Mutter, in dem sich ein großes Kanapee befand. Mama hatte eine große Schwäche für Antiquitäten, und dieses Sofa hatte sie vor Jahren einer alten Dame aus der Greifswalder Straße abgekauft. Die Wohnung war voller alter Dinge. So gab es zum Beispiel einen alten Sekretär, angeblich aus dem neunzehnten Jahrhundert, mit einem richtigen Geheimfach. Das Schmuckstück der Wohnung war ein alter, majestätischer Bibliotheksschrank aus massivem Holz mit bunten in Blei gefassten Glasscheiben, dem gegenüber Mamas Bett stand. Der Schrank war so schwer, dass es vier Männer brauchte, um ihn zu bewegen. Das wusste ich, da meine Eltern eines Nachts auf die Idee gekommen waren, den Schrank ein Stück weiter nach rechts zu verrücken, um die bisher verdeckte Tür zum Nebenzimmer zugänglich zu machen. Wir Kinder wurden von einem Riesenknall wach und stürmten in das Wohnzimmer. Das Bild, das sich uns bot, war grotesk. Mein Vater und drei seiner Freunde hatten auf Anweisung meiner Mutter Kartoffelschalen unter die Füße des Schrankes geklemmt, um das Monster leichter bewegen zu können. In alkoholisierter Bestlaune war ihnen dies auch mehr als gelungen. Der Schrank war in einem Rutsch in den wirklich schönen Kohleofen in der Ecke gerauscht. Er stammte noch aus den Dreißigerjahren. Nun war er ein Trümmerhaufen, und alle fünf Erwachsenen ebenso wie die Möbel im Zimmer waren mit Ruß bedeckt.
Ich fand meine Mutter angezogen auf dem alten Bett liegend. Sie starrte merkwürdig abwesend auf den Bibliotheksschrank, und ich wunderte mich, was es da zu sehen gab. Außer mir war niemand weiter in der Wohnung. Ich sprach sie an, aber sie reagierte nicht. Ich rüttelte sie am Arm. Ein ungutes Gefühl kam in mir hoch und wurde zu einer ausgewachsenen Panik. Ich schrie sie verzweifelt an.
»Mama!«
Keine Reaktion. Ich rannte zu einer Nachbarin. Sie besaß ein Telefon und rief Mamas Freundin Karola, eine Ärztin, an. Karola kam so schnell sie konnte aus dem Krankenhaus Friedrichshain zu uns in die Wohnung. Sie lieferte Mama sofort ins Krankenhaus ein.
Mir war das alles unglaublich peinlich. Die lieben Nachbarn hatten auf dem Weg zum Krankenwagen ein Spalier gebildet und mutmaßten über Tod und Verbrechen. Es habe ja so kommen müssen, diese Künstler, der Alte habe sie vermutlich im Suff erschlagen, und dergleichen Bemerkungen mehr.
Karola war meine Patentante, bei der ich unregelmäßig an Wochenenden übernachtete. Sie selbst war kinderlos und steckte all ihre Mütterlichkeit und Liebe in mich. Und sie hatte etwas, was in meiner Kindheit eher selten war: einen immer randvollen Kühlschrank. Es war das Paradies. Denn zu Hause bestimmte mein Bruder Peer über die Essensverteilung. Bis Dirk sich darüber einmal richtig lange beschwerte. Daraufhin entschied Mama, einer von uns sollte immer teilen und einer der anderen konnte sich als Erster seine Portion aussuchen. Wie durch Zauberhand konnten Peer, Dirk und ich auf einmal chirurgisch genau jede Art von Speise schneiden. Mama hatte es faustdick hinter den Ohren!
Nun saß ich mit meiner Lieblingstante in unserer Küche.
Links stand ein riesiger Bauerntisch, an dem alle Platz hatten. Mama legte immer sehr viel Wert darauf, dass wir, egal wie viel oder auch wenig es zu essen gab, möglichst vollzählig an den Mahlzeiten teilnahmen. Es wurde so gut wie immer eingedeckt, Mama hatte ein herrliches blaues Zwiebelmustergeschirr und achtete von Anfang an auf gute Tischmanieren. Rechts in der Ecke stand ein alter Gasherd, an den sich eine kleine türlose Kammer anschloss, in der sich unser kleiner Kühlschrank befand. Die Regale und ein alter Schrank auf der anderen Seite waren von meiner Mutter handbemalt, meist mit Blumenmotiven. Das konnte sie gut. Die Zeiten, in denen es reichlich zu futtern gab und es uns gut ging, verdankten wir dieser Begabung unserer Mutter. Sie bemalte Bauermöbel, Kerzenleuchter und Holztruhen verschiedenster Größe für eine PGH, eine Produktionsgenossenschaft des Handwerks. In PGHs waren Handwerker zusammengeschlossen und stellten verschiedenste Dinge her.
Eigentlich hätte sie lieber ihre Grafiken und Ölbilder ausgestellt, aber das war nicht so einfach, wenn man nicht Mitglied der SED war. Auch wir Jungs wurden teilweise in die Massenproduktion eingebunden. Die PGH lieferte uns zum Beispiel Kerzenleuchter aus Holz ins Atelier. Diese wurden von einem von uns Jungs vorgestrichen, meist in einem herrlichen Bordeauxrot, und dann, nachdem sie getrocknet waren, von Mama in Affengeschwindigkeit bemalt. Das machte sie aus dem Handgelenk. War die Bemalung getrocknet, kam noch eine Lasur drauf. Die stank bestialisch, und so war der Job bei uns sehr umstritten. Es gab in ihrem Leben aber auch immer wieder künstlerisch wertvollere, jedoch nahrungstechnisch ärmere Zeiten.
Mama lag im Krankenhaus. Tante Karola versuchte mir zu erklären, was geschehen war, dass Mama sehr müde wäre und sonst nichts weiter. Ich verstand nur Bahnhof. Meine Brüder, die später hinzukamen, wurden ebenfalls schonend unterrichtet. Komischerweise schweißt das sofort zusammen. Wir drei saßen bis tief in die Nacht im Balkonkinderzimmer und rätselten über zwei Dinge: Was für eine Krankheit hatte Mama denn nun? Und wo war eigentlich unser Herr Vater?
Uns Kindern blieb das Verhältnis meines Vaters zu anderen Frauen nicht verborgen, das, sagen wir mal, ein sehr offenes war, was Mama natürlich nicht sonderlich gefiel. So hatte er beispielsweise ein paar Monate lang eine Frau Schwarz als Sekretärin, mit der er sich gerne in sein Arbeitszimmer einschloss, um ihr ungestört »diktieren« zu können. Eines Tages verschwand Frau Schwarz unter dem verbalen Donnerwetter meiner Mutter aus der Wohnung und ward nie mehr gesehen.
Meine kleine Kinderseele litt unendlich, als ich den Selbstmordversuch meiner geliebten Mutter durch Gespräche um mich herum langsam zu verstehen begann. Ich war heilfroh, als sie nach ein paar Tagen wieder in ihrem Atelier saß und malte. Wir haben über ihre Verzweiflungstat nie ein Wort gesprochen. Diese Kraft, egal was geschah, ein »Alles ist wieder gut« ausstrahlen zu können, habe ich an ihr immer bewundert. Ich habe das auch gerne und immer sehr schnell geglaubt.
Ich liebe meine Mutter und hänge furchtbar an ihr, auch jetzt, oder besser: gerade jetzt, selbstverständlich ohne ihr das andauernd zu zeigen. Schließlich ist man ja ein Junge! Es gab aber Zeiten, in denen ich meine Zuneigung sehr deutlich demonstrierte. Wenn wir zum Beispiel auf der Straße spazieren gingen, geschah es des Öfteren, dass Kinder und auch Erwachsene ihr nachriefen:
»Guck mal, ist die aber fett!«
Ich regte mich dann immer sehr auf, obwohl Mama versuchte, mich zu beruhigen. Trotzdem lief ich meistens zu den Lästerern hin und schrie: »Meine Mama is nicht fett, sie is vollslank!«
Das hatte mir Oma mal so erklärt. Meist lachten die Leute, und ich war unglücklich. Vielleicht lachten sie auch über meine hohe Operettenstimme oder meinen kleinen Sprachfehler, den ich durch einen nach vorne ragenden Vorderzahn hatte.
Einmal ging so ein Kerl auf meine Mutter zu und brüllte ihr mitten ins Gesicht, sie sei selbst schuld und solle nicht so viel fressen. Da bekam ich einen hysterischen Anfall und trat ihm voll in die Eier.