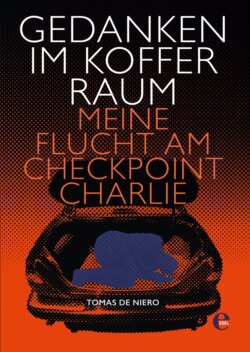Читать книгу Gedanken im Kofferraum - Tomas de Niero - Страница 9
MEINE ERSTE GROSSE LIEBE
ОглавлениеAb der dritten Klasse wohnten wir wieder zu Hause und besuchten auch wieder die 18. Oberschule in der Christburger Straße. Und ich konnte wieder verliebte Blicke auf Sabine werfen.
Sie war blond und süß, und ich stand schon seit der ersten Klasse auf sie, hatte sie aber nie zur Freundin bekommen. Doch vor einigen Wochen hatte es nach fast elf Jahren Schwärmerei auf einer Fete plötzlich gefunkt.
Niemand war darüber überraschter als ich. Viele Jahre lang war ich ihr nach der Schule gefolgt, war wie ein läufiger Hund die Straße, in der sie wohnte, auf und ab gelaufen, wieder und wieder, nur damit sie mich vielleicht ein einziges Mal vom Fenster aus bemerkte. Auch mein kleiner Bruder Dirk musste mit ran: Damit ich nicht allzu sehr auffiel, zwang ich ihn, die Strecke mitzulaufen und ab Sichtweite ihres Hauses angeregte Gespräche über dies und das mit mir zu führen. Dirk nahm mir das sehr übel und fühlte sich ausgenutzt. Verständlich, so im Nachhinein.
Sabine blieb mein Interesse natürlich nicht verborgen; sie spielte Spielchen mit mir, die ich mir alle gefallen ließ. Oft machte sie mich eifer süchtig und verschwand mit anderen Jungen. Zum Beispiel mit Frank.
Frank war ein Freund meines Bruders Peer und schon ein paar Jahre älter als ich. Als Sohn eines hohen Offiziers und einer Mutter, deren Tätigkeit sie auch ins Ausland führte – sie hatte mit Außenhandel zu tun –, war er materiell sehr verwöhnt, was ihn aber nicht, wie man vermuten könnte, irgendwie zufriedener machte, im Gegenteil. Er war mit großer krimineller Energie ausgestattet und hatte immer ein langes Tauchermesser in der Hosentasche, aber es gab in der DDR ja keine Kriminalität, sondern nur beim kapitalistischen Klassenfeind. Ausgerechnet jener Frank verknallte sich in meine Sabine.
Und die blöde Kuh ließ sich auch noch auf ihn ein! Frauen lieben immer die bösen Jungs.
Sie gingen nun schon einige Wochen miteinander. Ein unerträglicher Schmerz! Ausgerechnet der. Da ich aber große Angst vor ihm hatte, machte ich mit bei einem seltsamen Spiel, das Frank sich ausgedacht hatte.
Frank postierte sich mit dem Feldstecher seines Vaters im Dachgeschoss des Hauses gegenüber von Sabines Wohnung und schickte mich dann zu ihr. Ich sollte Zeit mit ihr verbringen, möglichst nah am Fenster, damit er feststellen konnte, ob sie ihm treu bliebe. Unfassbar eigentlich.
Sabine machte Rühreier. »Möchtest du was trinken?«, fragte sie mich und wies auf eine Sammlung kleiner Bols-Fläschchen in einem Karton. Westware! Ich war gerade zwölf geworden, wollte aber natürlich nicht als Schlappschwanz dastehen. Sabine goss alle zehn Fläschchen in einen Bierstiefel, trank selbst einen großen Schluck und reichte ihn an mich weiter: »Auf ex!«
Aus dem Augenwinkel konnte ich Frank sehen, wie er uns mit dem Fernglas aus seiner Dachluke heraus beobachtete. Ich bekam eine derartige Wut, dass ich nicht lange überlegte, das Riesenliterglas ansetzte und es in einem Zug leerte. Mir war sofort schlecht, und ich schaffte es gerade noch aus der Tür. Was weiter passierte, habe ich nur noch dunkel und bruchstückhaft in Erinnerung:
Ich sagte zu Hause meiner Oma kurz Bescheid, dass ich nichts zu Mittag essen würde, und begab mich direkt in die Kneipe gegenüber unserer Schule. Dort rief der Wirt die Polizei. Schemenhaft erinnere ich mich, aus dem Fenster des Polizeiautos gekotzt zu haben. Das Nächste, was ich mitbekam, war, dass meine Mutter bei mir an einem Krankenhausbett saß. Sie holte mich nach Hause, wo ich wieder in erlösende Dunkelheit versank, um erst zwei Tage später wieder zu erwachen. Mama saß wieder vor mir auf dem Bett.
»Hier, trink mal ’nen Schluck, großer Mann!«, sagte sie und hielt mir eine Flasche Wodka unter die Nase. Sofort wurde mir wieder schlecht. Dieser Geruch! Seitdem kann ich keinerlei Schnaps mehr trinken. Ich bin Mama dafür ewig dankbar!
Sabine wiederum, die meine erste und einzige Alkoholvergiftung ja verschuldet hatte, verschwand nach diesem Vorfall. Erst zwei Tage später wurde sie auf dem Dachboden unseres Hauses gefunden. Sie hatte Angst vor der Reaktion ihrer Eltern bekommen, war in angetrunkenem Zustand zu Frank geschlichen und von ihm dort versteckt worden.
Dabei hatte ich mir geschworen, nie mehr ein Krankenhaus zu betreten.
Da war ich im vorhergehenden Jahr ungefähr zehn Wochen lang gewesen, auch so eine merkwürdige Geschichte – und wie alles in meinem Leben kompliziert.
Ich hatte über Nacht große Eiterbeulen an den Armen, später auch an den Beinen und schließlich am ganzen Körper bekommen. Man lieferte mich in eine Station ein, in der sämtliche Patienten, allesamt Kinder, unter Quarantäne standen. Alle Zimmer waren, statt wie üblich mit Wänden, mit Glasscheiben ausgestattet, sodass die Schwestern praktisch aus jedem Zimmer in die anderen sehen konnten. Niemand außer den Schwestern und Ärzten durfte hier herein. Das galt auch für alle Besucher. Da gerade Winter war, stand Mama, als sie mich besuchen kam, in der klirrenden Kälte draußen auf dem Balkon meines Zimmers, und wir sprachen durch das leicht gekippte Fenster miteinander. Anders ging es nicht, und so entließ ich sie meist nach wenigen Minuten aus dieser Qual.
Mama besorgte mir, woher auch immer, ein Radio, eine sogenannte Kofferheule, was mir die Aufmerksamkeit der ziemlich attraktiven Nachtschwester einbrachte, die mit mir in so manch aufregender Nacht heimlich die fröhlichen Wellen von Radio Luxemburg hörte. Das war nicht gerade ein musikalischer Genuss, denn der Sender wurde (von wem auch immer) mit Störsignalen überzogen, sodass die Hits jener Zeit eher aus dem roten Kasten zischten als tönten. Als Entschädigung für den schlechten Ton bekam ich aber ordentlich was auf die Augen. Die Schwester hatte einen ziemlich knappen weißen Kittel an und saß seitlich auf meinem Bett, anfangs. Später legte sie sich auch gerne mal neben mich. Manchmal fielen ihr dabei minutenlang die Augen zu, und ich konnte sie in aller Ruhe betrachten.
Die Entzündungen waren sehr schmerzhaft, niemand wusste so recht, was ich hatte. Also entfernte man mir erst einmal prophylaktisch den Blinddarm. Den brauchte man sowieso nicht, wurde mir erklärt. Aber die Beulen blieben.
Meine Blinddarmnarbe befindet sich fast an der rechten Hüfte, wodurch Mama sich zu der Bemerkung hinreißen ließ: »Na, da war der Kollege Chirurg aber nicht mehr ganz so nüchtern, oder?«
Nachdem der Blinddarm draußen war, entschied man sich, mit den Mandeln weiterzumachen, danach mit den Polypen. Es gab viel Eis nach den Operationen, aber die Beulen blieben.
Danach begann folgende Tortur: Alle zwölf Stunden bekam ich Penicillin gespritzt, um 12 Uhr und um 24 Uhr, genau 112-mal. Das tat unglaublich weh und ließ mich meist erst weit nach Mitternacht einschlafen. Schon vor dem Abendbrot begann ich mich davor zu fürchten. Ähnlich ging es mir vor dem Frühstück mit Blick auf die Mittagszeit.
Tante Karola, die in dem Krankenhaus arbeitete, sah fast täglich nach mir. Das machte die sich zäh hinziehenden Tage erträglicher. Zu Beginn war ich allein in dem Zweibettzimmer, aber nach ein paar Wochen kam ein Junge dazu. Er hatte massive Nierenprobleme und war ziemlich dick, fast jeden Tag musste er zu einer anderen Untersuchung. Wir freundeten uns schnell an, es tat mir gut, mich unterhalten zu können. Die vielen Stunden alleine hatte ich mich ziemlich gelangweilt. Gottseidank gab es wenigstens James Krüss. Mein Urgroßvater und ich und »Das Männer-ABC« hatten mich vor dem Langeweiletod bewahrt. Letzteres kann ich noch heute auswendig:
Adam war der erste Mann,
also fang ich mit ihm an.
Brutus fand es gar nicht fein,
zweiter Mann in Rom zu sein ...
Schließlich und endlich verschwanden aber die Beulen – ob durch die vielen Spritzen oder wie auch immer. Nach achtzig Fehltagen in der Schule wurde ich wieder ins normale Leben entlassen.
Und ich freute mich auf die Schule – und natürlich besonders auf Sabine!