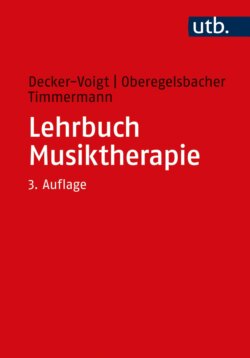Читать книгу Lehrbuch Musiktherapie - Tonius Timmermann - Страница 11
Оглавление3Forschungsstand Musiktherapie
von Dorothea Oberegelsbacher und Tonius Timmermann
„Die Brille des Forschers steuert seinen Gegenstand,
weswegen der Forscher erforscht werden muss.“
(Wissenschaftstheorie nach Maturana)
Wenn man an eine musiktherapeutische Wirkung denkt, scheint es zunächst immer um eine musikalische Wirkung zu gehen. Ist das wirklich so? Ist die Musik das Medikament in der Musiktherapie? Sind die Worte das Medikament in einer Gesprächstherapie? Oder was alles wirkt da in hoher Komplexität zusammen?
Unbestritten ist zunächst einmal die Musik als Medium in der Musiktherapie – wie auch immer mit diesem Medium konkret gearbeitet wird (s. Kap. 6 Praxeologie). Auch gibt es in zeitgenössischen Richtungen der Musiktherapie Ansätze, die sich auf spezifische Wirkfaktoren musischer Elemente (z. B. bestimmter Intervalle, Skalen bei bestimmten Beschwerden) bzw. daraus resultierende methodische Systeme begründen, z. B. die Anthroposophische (s. Ruland 1981) und Altorientalische (Tucek 1997) Musiktherapie. Allerdings stehen noch immer kontrollierte Studien aus, die sich der psychischen Wirkung der verwendeten musikalischen Elemente systematisch annehmen. Somit bleiben die postulierten Wirkqualitäten bislang Arbeitshypothesen, die allerdings im jeweiligen Setting auch ohne Objektivierbarkeit durchaus wirksam sind.
Es mag an der Sehnsucht des Menschen nach schmerzfreien Heilungsprozessen liegen, jedenfalls nimmt die Suche nach universellen Wirkfaktoren in der langen Geschichte der musiktherapeutischen Literatur einen relativ breiten Raum ein (s. a. Kap. 16 und Timmermann 1983b). Immer wieder geht es dabei um Grundfragen an das Medium, mit dem therapeutisch umgegangen werden soll: Wie wirkt Musik bzw. ihre Elemente? Gibt es verlässliche Standards oder ist alles beliebig oder nur situationsabhängig?
Spezifischer
Wirkfaktor
Musik?
Die Mehrzahl der heutigen MusiktherapeutInnen stimmt darin überein, dass Verallgemeinerungen bezüglich der Musikwirkung in der alltäglichen Erfahrung nicht bzw. nur sehr begrenzt feststellbar sind. Gleichzeitig will auch moderne Musiktherapie nicht ohne funktionelles Wissen über Musikwirkung im Bereich der Stimulation oder Relaxation auskommen, also beispiels-weise
keine
generalisierte
Wirkung
„ohne den beruhigenden Sechsachteltakt eines Wiegenliedes, ohne ein Metrum in der Frequenz des Ruhepulses, ohne tranceinduzierendes Klanggeschehen, ohne sinnstiftende Melodieverläufe oder auch Textpassagen“ (Oberegelsbacher/Timmermann 1999).
Hegi entwickelt in seinen Büchern (1986; 1998) fünf Wirkungskomponenten der Musiktherapie: Klang, Rhythmus, Melodie, Dynamik und Form (1998, 51 f.). Diese können in musiktherapeutischen Interventionen gezielt eingesetzt werden. Allerdings gilt auch hier, dass die Intention des Therapeuten bezüglich des musikspezifischen Effektes und die tatsächliche Wirkung beim Klienten von vielen weiteren Faktoren abhängen.
Der Beweis einer Objektivierbarkeit von Musikwirkung ist der Musikpsychologie und ihren wissenschaftlichen Metho-den der empirischen Wirkungsforschung bisher nicht gelungen (Gembris 1996). Zu groß ist die Zahl von Variablen, so dass man die Wirkung einer Musik kaum trennen kann von der Wirkung der Umstände, unter denen sie gehört wird (persönliche Erlebnisse mit dieser Musik, Geschmacksfragen, momentane Stimmung, die Beziehung zum Versuchsleiter und den anderen Versuchspersonen, die Atmosphäre der Testsituation usw.). Gleichzeitig erhebt sich aber auch die Frage, inwieweit ein moderner Musiktherapeut überhaupt an einer messbaren Objektivierung von Musikwirkung interessiert ist, wenn es ihm eigentlich um die individuellen Erfahrungen des Klienten geht?
In der tiefenpsychologisch orientierten Musiktherapie geht es jedenfalls nicht um eine „pharmakologische“ oder „mechanistische“ Verwendung von Musik und ihren Elementen. Sie geht aus von der grundlegenden Bedeutung der therapeutischen Beziehung, die hier mit Hilfe der Musik als wesentlichem Faktor mitgestaltet wird. Die Wirkungen der Musik selbst werden innerhalb des Gesamtwirkungsgeschehens unter zwei grundsätzlichen Aspekten betrachtet: dem sich aktuell Ereignenden und diesem biografischen Hintergrund. Die entstehende Beziehungs- und Musikwirklichkeit wird weder als zufällig noch als beliebig betrachtet. Die Musik ist sinnvoll eingebettet in diesen Gesamtzusammenhang der Situation. Insofern ist sie nichts, was von außen hineingetragen wird. Sie repräsentiert die Gebundenheit an das Gegebene und Gewordene ebenso wie den Spiel-Raum im jeweiligen Schicksal. Sie folgt den Gesetzmäßigkeiten der Musik und den Freiheiten der Intuition.
„keine
Musikpharma-kologie“
Die Musiktherapeutin lernt im Rahmen ihrer Ausbildung einerseits den Umgang mit der Musik als künstlerischem Medium, andererseits den Umgang mit seelischen Prozessen, mit ihrer Wahrnehmung, mit Gegenübertragungsphänomenen usw. Die geschulte Intuition führt dann beides zusammen.
Im musiktherapeutischen Beziehungsgeschehen kommen Struktur und Dynamik des Unbewussten in Verbindung mit der persönlichen Geschichte des Klienten zum Ausdruck und können leidstiftende Elemente wandeln. Dies bildet den Hintergrund für das Erleben von Musik, für frei improvisierten, musikalischen Ausdruck und musikalische Interaktion. Von besonderer Bedeutung für die Musiktherapie sind außerdem entwicklungspsychologische Erkenntnisse, insbesondere die Ergebnisse der Säuglingsforschung bezüglich der frühen, präverbalen Interaktion (Stern 1992).
Im therapeutischen Setting konnte dieses Beziehungsgeschehen als zentraler Heilfaktor nachgewiesen werden. Das zentrale Ergebnis der Psychotherapieforschung ist: Nicht die Methode, die angewendet wird, ist das eigentlich Bedeutsame, sondern die Qualität der therapeutischen Beziehung (Czogalik 1988). Das gilt dann natürlich sowohl für verbale Psychotherapie als auch für die Therapien, die mit künstlerischen Medien arbeiten. Im Besonderen ist es allerdings entscheidend für die Wirkung, ob Medium und Methode nicht nur der Persönlichkeit des Therapeuten, sondern auch der des Patienten und seiner Problematik entsprechen, also einer speziellen Indikation gemäß gewählt werden.
Heilfaktor
Beziehung
Nach dieser allgemeinen Einleitung möchten wir im Folgenden einen Überblick über den Stand der Forschung in der Musiktherapie geben. Hier zunächst ein Überblick über die wichtigsten Zentren für musiktherapeutische Forschung im deutschsprachigen Raum:
●Universität Ulm: Aufbau eines musiktherapeutischen Forschungsfeldes seit 1987; von 1988 bis 2008 jährliche, d. h. 1. bis 20. „ulmer werkstatt für musiktherapeutische grundlagenforschung“ (ab 2009 an der Universität Augsburg, s. u.).
●Heidelberg: Deutsches Zentrum für musiktherapeutische Forschung seit 1995; http://www.dzm.fh-heidelberg.de/deutsch/index.htm (31.1.12).
●Deutsches Institut für angewandte Therapieforschung (DIAT e. V.) Heidelberg, http://www.musiktherapie.de/typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/external_link_new_window.gif, (31.1.12), www.fh-heidelberg.de.
●Universität Witten-Herdecke: Institut für Musiktherapie, Lehrstuhl für qualitative Forschung. http://www.musictherapyworld.de
●Hochschule für Musik und Theater Hamburg: Institut für Musiktherapie. Promotion zum Dr. mus. www.rrz.uni-hamburg.de
●Forschungsstelle Musik und Gesundheit an der Philosophisch-Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg. Seit 2009 jährliche „werkstatt für musiktherapeutische forschung augsburg“ Promotion zum Dr. phil. Erstellen einer kompeletten deutschsprachigen Dissertationsliste http://www.musiktherapie.de/typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/external_link_new_window.gif, www.philso.uni-augsburg.de, 31.1.12
In Norwegen befasst sich die Forschergruppe rund um Christian Gold (Grieg Academy Music Therapy Research Center, Uni Research, Bergen, Norwegen) mit der Erforschung musiktherapeutischer Wirkweisen (Effektforschung) und Wirkmechanismen (Process-Outcome Forschung). „Wie wirkt Musiktherapie?“ und „Was wirkt in der Musiktherapie?“ sind die zentralen Themen, die überwiegend im Bereich psychischer Erkrankungen erforscht werden.
Als nächstes blicken wir auf ihren situativen Kontext. Die Forschungslandschaft der Musiktherapie ist derzeit in ihren Untersuchungsgegenständen und Methoden sehr heterogen. Die Vielfalt rührt daher, dass
heterogene
Forschungsland-schaft
1.unterschiedliche musiktherapeutische Identitäten existieren;
2.verschiedene Klienten, Patienten und Indikationen zu finden sind;
3.musiktherapeutisches Geschehen an sich einen hohen Grad an Komplexität hat;
4.mehrere wissenschaftliche Forschungstraditionen bestehen;
5.viele abgestufte Forschungsebenen existieren;
6.unterschiedliche Zielrichtungen möglich sind.
Treffen nun diese sechs Dimensionen aufeinander, so gibt es zwischen ihnen nahezu unendliche Kombinationen, aus denen eine mögliche Fragestellung entsteht. Die Fragestellung wird zu einer Untersuchung, einer Studie oder einem Projekt führen. Alle können ihr Gutes haben und Ausdruck von Sehnsucht nach mehr Klarheit sein.
Dimension „musiktherapeutische Identität“: Die unterschiedlichen Identitäten reichen von Musiktherapie als mehr künstlerischem Verfahren hin zu einem mehr medizinischen oder psychologischen. Dementsprechend wird die Forschung auf bestimmte Paradigmen (griech. = Beispiele) zurückgreifen und somit tendenziell eher ausgehen von:
a) Kunst, ihrem kreativen Prozess, ihren Wirkfaktoren, den Gestaltungsmitteln und -formen, Instrumenten, dem gestaltenden Subjekt, dem Kunstprodukt usw.,
b) der Heilkunde, ihren Spezialgebieten, ihren angewandten Heilmitteln, dem Medikamentenmodell, ihren funktionellen Organsystemen, den Orten der Heilung, wie z. B. ambulant oder stationär, usw.,
c) der Psychologie, ihren Spezialgebieten wie etwa den Bereich der Kognition, der Lernprozesse, vor allem aber der Interaktion und Beziehung, der Emotion, der Kommunikation; des Weiteren die zugehörigen Konstrukte und Messinstrumente (Fragebogen und Tests), mehr oder weniger operationalisierte (d. h. planmäßige) Behandlungssysteme.
Dimension „Klientel“: Die verschiedenen Klienten und Indikationen haben einen Einfluss darauf, welche Beobachtungsschemata und Manuale Einsatz finden. Die in den letzten 20 Jahren zur Pflicht gewordene „Erforschung der Forscher und ihrer Beziehung zu den Forschungsobjekten“ hat als Hintergrund das Phänomen, dass die Sichtweise des Forschenden sein Objekt wesentlich mit steuert und damit das Forschungsergebnis. Von Forschern und ihren Sichtweisen hängt auch ab, ob eher entwicklungstherapeutische Stufenmodelle herangezogen werden, z. B. von Daniel Stern oder Jean Piaget, wenn es um Nachreifung geht; ob eher persönlichkeitstheoretische Modelle gewählt werden, z. B. Charakter- oder Emotionspsychologie, wenn es um Veränderung der Persönlichkeit geht; ob eher psychosoziale Konzepte verwendet werden, z. B. jenes der Vulnerabilität (lat. = Verletzlichkeit), wenn es um Rehabilitation geht usw.
Dimension „musiktherapeutische Komplexität“: Die Komplexität des musiktherapeutischen Geschehens wurde bereits eingangs aufgezeigt. Wiederholend sei gesagt, dass die Wirkung der Musik, der Einfluss der therapeutischen Beziehung, der Aspekt des aktiven Handelns und das Verhältnis von Verbalsprache und Musiksprache usw. zu bedenken sind. Alles wirkt ineinander und kommt in der therapeutischen Situation nicht isoliert vor. Forschung wird in ihrem Design versuchen, die Mischungsverhältnisse so zu variieren, dass einzelne Wirkgrößen isoliert hervortreten können.
Dimension „Forschungstradition“: Die Forschungstraditionen schließlich sind in unserer abendländisch-mitteleuropäischen Kultur seit jeher zwei (s. a. Kap. 4). Sie stehen gleichberechtigt nebeneinander, obwohl dies einige Forschungs- und Lehrstätten ablehnen.
●Die idiografische Tradition (griech. „idios“ = eigen; „graphein“ = schreiben; d. h. eigenhändig) will das Einzelne in seiner geschichtlich bestimmten Gestalt erforschen. Sie steht den Geisteswissenschaften und dem Menschenbild der Romantik nahe. Erkenntnis entsteht durch Konzentration auf das Individuum, das Subjekt (Innenschau). Die Methodik ist, durch Erzählen und Beschreiben Sinn zu finden.. Die Entsprechung in der Analogie (d. h. Ähnlichkeit) ist ein vollgültiger (ana)logischer Weg der Erkenntnis. Zugehörige Begriffe sind z. B. Narrativ, Heuristik, Einzelfallforschung.
●Die nomothetische Tradition (griech. „nomos“ = Zahl, Gesetz; „thesis“ = Lehrsatz) geht von der Erkenntnis allgemeiner Gesetze aus und steht den Naturwissenschaften und dem Menschenbild der Aufklärung nahe. Erkenntnis entsteht durch Hinwendung zum Objekt und zur großen Zahl. Die Methodik ist Zählen, Zergliedern, Messen und Verallgemeinern. Die Kausalität von Ursache-Wirkung ist logischer Weg der Erkenntnis.
Musiktherapieforschung hat heute Anteil an beiden Paradigmen, oft auch innerhalb eines Forschungsvorhabens, und benötigt beide für ihre Weiterentwicklung. Sie lehnt sich im Wesentlichen an die Psychotherapieforschung an.
Dimension „Forschungsebene“: Ergänzend zu den Forschungstraditionen wollen auch Forschungsebenen unterschieden werden. Drei hierarchische Ebenen der Musiktherapieforschung unterscheidet bereits 1985 der Niederländer Frans Schalkwijk (zit. n. Oberegelsbacher 1985):
a) Die allgemeine Musiktherapie: Dazu zählen Grundlagenforschung, einzelne Parameter betreffend, Abgrenzungsbemühungen zu verwandten Therapieformen, Erwartungen an die Musiktherapie, Befragungen von Therapeuten, Inhaltsanalysen von Stellenangeboten usw.
b) Die Entwicklung von Methoden: Diese sei in der Psychiatrie am weitesten, in der Geistigbehindertenarbeit am wenigsten entwickelt. Viele Praktiker halten ihre Methoden kaum fest und arbeiten nach impliziten Theorien. Durch systematische Befragung, Beobachtung durch Einwegspiegel oder Fallbeschreibungen durch die Forscherin kann die Methode erforscht werden.
c) Die Prüfung von Methoden: Diese sei in den USA am weitesten fortgeschritten, wobei dort derzeit noch ein vorwiegend lerntheoretischer Hintergrund bestehe. Die Ergebnisforschung („Ist eine Therapie wirksam?“) erfolgt mit psychologischen Messmethoden. Oft ist in dieser Phase der Musiktherapeut gewissermaßen sozial ausgeschaltet. Häufig würden vielen Wissenschaftlern geeignete Messinstrumente und das Wissen um die zentralen Vorgänge in der Musiktherapie fehlen. Ergebnisforschung werde oft zu früh angepeilt, lange bevor eine formulierte Methode vorliege.
„Für Musiktherapieforschung muß als eine erste und notwendige Bedingung die Beteiligung von ausgebildeten MusiktherapeutInnen an den sensiblen Stellen des Forschungsvorganges, v. a. im Planungsstadium, aber auch bei der Durchführung der Therapie und bei der Interpretation gefordert werden.“ (Oberegelsbacher 1993, 86)
Dimension „Forschungsziel“: Die Zielrichtung einer Forschung hat mit der „causa finalis“ (der „Zielursache“, dem letzten „Zweck“) zu tun. Will ich mikroskopisch fein in die Musiktherapie hineinsehen, z. B. durch Mikroanalysen in einer Prozessforschung, oder mit Weitwinkel auf sie blicken, z. B. durch Makro- oder Metaanalysen? Auch die Beweggründe sind hier maßgeblich. Forschung sieht je anders aus, wenn dadurch Finanzierung, ein akademischer Grad, soziale oder berufliche Veränderung, Qualitätsabsicherung oder eine Weiterentwicklung der Disziplin erreicht werden soll. Die Unterschiedlichkeit von Forschungsarbeiten ausgebildeter MusiktherapeutInnen soll an der folgenden kurzen Auswahl von Beispielen deutlich werden.
Eine Einteilung in Stadien der Musiktherapieforschung nimmt Horst Kächele (2001) in
Anlehnung an die Psychotherapieforschung vor:
●Stadium 0: Klinische Fallstudien
●Stadium I: Deskriptive Studien
●Stadium II: Experimentelle Analog-Studien
●Stadium III: Kontrollierte Studien
●Stadium IV: Anwendungs-Beobachtungs- Studien
●Stadium V: Patientenorientierte Studien
Kächele hält fest, dass erst IV und V über die Nützlichkeit entscheiden, dass jedoch derzeit ausschließlich strenge, limitierte, kontrolliert saubere Bedingungen (III) finanziert werden würden.
Die Analyse einer Einzelmusiktherapie mit einem lernbehinderten, verhaltensauffälligen Mädchen präsentiert J. Wimmer-Illner (2000). Diese kombinierte Prozess-Erfolgsstudie wählt ein einzelfallmethodisches Design und Zeitreihenanalysen, die inferenzstatistisch, also quantitativ ausgewertet werden. Zum Einsatz gelangten Teile eines Fragebogens (Marburger Verhaltensliste, MVL), den die Mutter zweimal wöchentlich ausfüllte – insgesamt 50-mal. Auch Videomitschnitte wurden von Experten beurteilt. Die Durchführung der Musiktherapie führte zu einer signifikanten Abnahme unangepasster sozialer Verhaltensweisen. Ebenfalls signifikant waren Korrelationen, die zeigen, dass die Patientin das Medium Musik vor allem kathartisch und kreativ nützen kann und dass die emotionale Übereinstimmung zwischen Patientin und Therapeutin für den Therapieerfolg wichtig sind.
Prozess/Outcome, Einzelfall
Aus der mehrjährigen Einzeltherapie mit dem schwer entwicklungsretardierten autistischen Buben Max entwickelt Karin Schumacher (1998) mittels Videoanalyse auf der Grundlage der Entwicklungstheorie nach Jean Piaget und Daniel Stern ein siebenstufiges System zur Einschätzung von Beziehungsqualitäten (EBQ). Diese reichen von totaler Kontaktlosigkeit (Modus 1) bis gemeinsamer Begegnung im Spiel (Modus 6). Somit liegt ein sehr praxisrelevantes musiktherapeutisch-diagnostisches Instrument zur Feststellung von Veränderungen bei sehr frühen Kommunikationsstörungen vor.
Prozess, Entwicklungs-diagnostikum
In einer kontrollierten quasi-experimentellen Vorher-nachher-Studie (n = 136) wurde von Ch. Gold (2003) die Effektivität von ambulanter Einzelmusiktherapie mit untersucht. Kinder und Jugendliche (n = 75) mit emotionalen Störungen, Störungen von Anpassung, Verhalten, Entwicklung oder Essverhalten wurden während einer Musiktherapie (durchschnittlich 23 Stunden) bzw. während einer Wartezeit untersucht. Symptome, Kompetenzen und Lebensqualität wurden mittels der Child Behaviour Checklist (CBCL) und dem Fragebogen zur Lebensqualität (KINDL) vor und nach der Therapie gemessen. Die Effekte der Musiktherapie waren abhängig vom Vorhandensein komorbider somatischer Störungen sowie von der Verwendung typischer versus atypischer Medien und Aktivitäten innerhalb der Musiktherapie. Die Ergebnisse deuten an, dass Musiktherapie effektiver bei Klienten ohne Komorbidität ist und effektiver, wo auf den Einbezug anderer Medien und Aktivitäten verzichtet wird zugunsten einer Fokussierung auf musiktherapeutische Techniken wie Improvisation und verbale Reflexion.
Prä-Post/Outcome, Gruppenvergleich
Dieses Beispiel ist der Ausbildungsforschung zuzurechnen. Dorothea Oberegelsbacher (2002) führte eine katamnestische Befragung an 80 Musiktherapiestudenten durch, die berufsbegleitend eine psychodynamische musiktherapeutische Selbsterfahrungsgruppe von 24 Einheiten besucht hatten. Mit Hilfe eines Fragebogens zur Erfassung der Wirkfaktoren von Musiktherapie (WIMU; Danner/Oberegelsbacher 2001) durch Faktorenanalyse wurde untersucht, was von der Musiktherapie in Erinnerung bleibt. Es zeigte sich u. a., dass von den spezifisch musiktherapeutischen Wirkfaktoren vor allem musiktherapeutisches Durcharbeiten von Problemen, Ausdruck, Darstellung und Kommunikation mittels Musik sowie die Wirkung der Musik tragend sind. An unspezifischen Wirkfaktoren waren die wertschätzende Haltung der Therapeutin, die Wichtigkeit der Gruppe an sich und sich dort mit anderen vergleichen zu können am wichtigsten. Es gab Unterschiede bei den Vorqualifikationen der Befragten: Erzieher und und Lehrer haben gegenüber Musikern größere Schwierigkeiten, Gruppe an sich als hilfreich zu erleben. Mit Vorsicht könnte gesagt werden, dass für sie prozessorientierte psychodynamische Gruppenaktivitäten mehr Unsicherheiten und Abwehr auslösen.
Deskriptiv-Katamnestik, Ausbildungs-forschung
Die folgenden Beispiele, dankenswerterweise skizziert von Karin Mössler, zeigen Forschungsergebnisse der bereits erwähnten Gruppe um Christian Gold in Norwegen. Im Rahmen von Cochrane Reviews wurden in den letzten Jahren die Wirkweise von Musiktherapie bei Autismus, Depression und Schizophrenie erforscht. Ergebnisse dieser systematischen Übersichtsarbeiten zeigten, dass Musiktherapie zu signifikanten Verbesserungen sozialer Fähigkeiten bei autistischen Kindern führt (Gold et al. 2006) und depressive Symptomatik signifikant zu reduzieren vermag (Maratos et al. 2008). Letzteres Ergebnis konnte auch innerhalb einer aktuellen Studie gezeigt werden, die zusätzlich zu einer signifikanten Reduktion von depressiver Symptomatik auch eine Verringerung der Angstsymptomatik demonstrierte (Erkkilä et al. 2011).
Effektforschung, Process-Outcome-Forschung
Musiktherapie bei Erwachsenen mit Schizophrenie und schizoformen Störungen bewirkt eine signifikante Verbesserung des allgemeinen Zustandsbildes, der Negativsymptomatik sowie des sozialen Funktionsniveaus. Die qualifizierte Anwendung von musiktherapeutischer Methodik sowie die Anzahl von besuchten Therapieeinheiten scheinen dabei wesentliche Faktoren zu sein, die den Effekt beeinflussen. So wurden signifikante Effekte erst ab einer Stundenanzahl von 20 Einheiten gefunden (Mössler et al. 2011). Dieses Ergebnis stimmt mit jenen Resultaten überein, die Gold et al. (2009) in einer Dosis-Wirkung-Studie fanden. Diese Übersichtsarbeit zeigte, das mittlere Effekte von Musiktherapie auf das allgemeine Zustandsbild, die Negatvisymptomatik und das soziale Funktionsniveau erst ab einer Frequenz von 16 bis 24 besuchten Therapieeinheiten auftreten. Spezifische Wirkfaktoren scheinen in der Musiktherapie eine wesentliche Rolle zu spielen (Danner/Oberegelsbacher, 2001) und Forschung konzentriert sich neuerdings auf die Anwendung musiktherapeutischer Techniken als Outcome-Prädiktoren (Mössler et al. 2011). Gold et al. (2007) fanden in diesem Zusammehang bereits, dass die Vewendung musiktherapiespezifischer Techniken (z. B. freie Improvisation) zu besseren Ergebnissen in der Therapie mit Kindern und Jugendlichen führt, als die Verwendung nicht-spezifischer Techniken (z. B. freies Spiel).
Am Ende dieses Kapitels soll nun ein ausführlicheres Beispiel zeigen, wie ein musiktherapeutisches Forschungsdesign aussehen kann. Dieses Projekt wurde im Rahmen einer der frühen musiktherapeutischen Dissertationen durchgeführt (Timmermann 1999a). Es orientiert sich an bewährten und anerkannten Methoden aus der Psychotherapieforschung.
Die aktive Musiktherapie geht von der Hypothese aus, dass in musikalischem Ausdruck und Interaktionsverhalten Persönlichkeit und Probleme eines Patienten erkennbar und bearbeitbar werden können. Um diese Hypothese zu prüfen, wurde danach gefragt, ob externe Beobachter in der Tat aufgrund von videografierten Ausschnitten aus einer Musiktherapie in der Lage sind, Aussagen über den Patienten zu machen, und inwiefern sich dabei Experten und Laien unterscheiden. Eine zehnstündige einzelmusiktherapeutische Intervention wurde auf Video mitgeschnitten. Der Patient litt unter einer narzisstisch-schizoiden Persönlichkeitsstörung verbunden mit einer Fesselsymptomatik. Die bisherigen Therapien waren geprägt durch eine kontrollierende Beziehungsregulation, die sich auch in der Musiktherapie wiederholte. Indem der Patient die musikalische Beziehung abbrach, sobald der Therapeut etwas lauter, schneller oder sonstwie dynamischer spielte, erzeugte er in diesem sukzessiv das Gefühl, „gefesselt“ zu sein, und reinszenierte damit seine eigene Kindheitssituation.
Prozess, Methodenforschung
Der Therapeut verfasste nach jeder Sitzung ein „Affektives Spontan-Protokoll”, später ein ausführliches Protokoll anhand der Videoaufzeichnung sowie Protokolle von den Konsultationen mit einer Kollegin. Aus dem gesamten Videomaterial wurden zunächst alle musikalischen Dialoge herausgeschnitten und codiert. Sodann wählten drei Musiktherapeuten zunächst unabhängig voneinander intuitiv Szenen aus, die sie für klinisch relevant hielten, d. h. die Pathologie des Patienten spiegelten oder Veränderungsprozesse zeigten. Gemeinsam einigten sie sich schließlich auf acht Szenen (Länge jeweils ca. 2 Minuten). Diese Szenen wurden dann 20 Musiktherapeuten, zehn Psychotherapeuten und 20 Laien vorgespielt, die zunächst nach jeder Szene standardisierte und freie Fragen zum Patienten und Therapeuten beantworten sollten. Nach Beobachtung aller Szenen sollten sie noch einmal frei Patient und Therapeut beurteilen.
Die Auswertung der standardisierten Fragen erfolgte durch eine zweifaktorielle Varianzanalyse. Die freien Äußerungen wurden als Inhaltsanalyse, qualitativ, heuristisch und in Form von Kategorien ausgewertet. Die Hypothesen über den Patienten aufgrund der hinlänglich bekannten Pathologie („Hypothesen-Kategorien”) wurden verglichen mit den „Rater-Kategorien”, die sich aus den freien Äußerungen bilden ließen. Der Patient und seine Problematik wurde von den Ratern insgesamt überzeugend erkannt und beschrieben, obwohl sie außer den zusammen etwa 16 Minuten musikalischen Dialogen mit dem Musiktherapeuten keinerlei Informationen über ihn erhielten. Auch die inneren Konflikte des Therapeuten angesichts des Patienten spiegeln sich in den Ergebnissen. Die drei Gruppen urteilen sehr übereinstimmend; der Signifikanz-Test weist keine signifikanten Unterschiede auf. Sie differieren jedoch tendenziell dahingehend, dass die Psychotherapeuten am stärksten die Pathologie des Patienten wahrnehmen, während die Laien diesen am positivsten beurteilen. Die Musiktherapeuten liegen zwischen den beiden Gruppen: Sie sehen mehr Pathologisches als die Laien und mehr Gesundes als die Psychotherapeuten.
Diese Forschungsarbeit zeigt anhand eines praktischen Beispiels, dass und wie im musikalischen Ausdrucks- und Interaktionsverhalten die Persönlichkeit und die pathologischen Strukturen eines Patienten erkennbar und bearbeitbar werden. Sie hat damit einerseits Relevanz für den Nachweis dessen, was in der Musiktherapie geschieht, und zeigt den musiktherapeutisch Arbeitenden bzw. Studierenden, wie dies genau geschieht.
Argstetter, H., Hillecke, T., Bradt, J., Dileo, C. (2007): Der Stand der Wirksamkeitsforschung – Ein systematisches Review musiktherapeutischer Meta-Analysen. In: Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin 28 (1), 39–61
Gold, C. (2009): Systematische Übersichtsarbeit und Meta-Analyse. In: Musiktherapeutische Umschau 30 (1), 65–68
Kächele, H. (2003): Qualitätssicherung in der ambulanten Musiktherapie – noch einmal … Musiktherapeutische Umschau 24, 5–9
Mössler, K., Fuchs, K., Heldal, T. O., Karterud, I. M., Kenner, J., Næsheim, S., Gold, C. (2011): The clinical application and relevance of resource-oriented principles in music therapy with psychiatric clients. Accepted for publication British Journal of Music Therapy
Petersen, P. (Hrsg.) (2003): Forschungsmethoden Künstlerischer Therapien. Grundlagen – Projekte – Vorschläge. Mayer, Berlin
Smeijsters, H., Rogers, P. (1993): European Music Therapy Research Register. Vol I: Werkgroep Onderzoek Muziektherapie NVKT
Smeijsters, H., Rogers, P., Kortegaard, H.-M., Lehtonen, K., Scanlon, P. (1995): European Music Therapy Research Register. Vol II: Stichting Muziektherapie, Castricum
Wosch, T., Wigram, T (2007): Microanalysis in Music Therapy: Methods, Techniques and Applications für Clinicians, Resesrchers, Educators an Students. Jessica Kingsley Publishers, London/Phildelphia