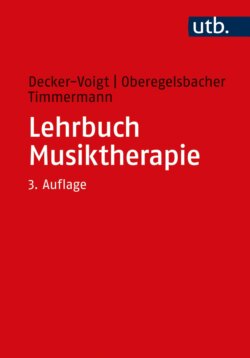Читать книгу Lehrbuch Musiktherapie - Tonius Timmermann - Страница 14
Оглавление6Praxeologie
von Tonius Timmermann
„Verrichte zuerst das Notwendige, sodann das Mögliche,
schließlich gelingt Dir das Unmögliche.“
(Franziskus von Assisi)
Musiktherapie hat sich in ihrer Geschichte prinzipiell parallel zur Psychotherapie entwickelt und geht nur selten als ein spezifisches Verfahren oder eine bestimmte Methode aus der Psychotherapie hervor. Während die Psychotherapie in der Medizin, speziell der Psychiatrie wurzelt, finden wir am Beginn der Musiktherapie eher kulturtherapeutische Ansätze musikalisch-künstlerischer und pädagogischer Art. In der Begegnung dieser beiden Entwicklungen kombiniert die Musiktherapie diese Ansätze mit Vorgehensweisen aus dem breiten Spektrum der Psychotherapie auf der Basis des aktuellen medizinischen und psychologischen Wissensstandes sowie spezifischer Forschung. Sie ist integriert in ein wissenschaftlich orientiertes Gesundheitssystem.
eklektisches
Vorgehen
Musiktherapie lässt sich als im positiven Sinne eklektisch charakterisieren: Sie prüft Theorie- und Handlungsmodelle, die sich aus einer Kombination musischer und psychotherapeutischer Elemente ergeben, sorgfältig darauf, wie sie sich in der therapeutischen Praxis bewähren. Eklektisches Vorgehen bedeutet, dass umsichtig und konsequent aus dem musiktherapeutischen Repertoire die Mittel und Wege gewählt werden, die aufgrund der spezifischen Indikation des Klienten erforderlich und im Einklang mit der Konzeption der jeweiligen Institution sind. Dabei muss im Einzelfall sehr darauf geachtet werden, dass sich die Methodik nicht an die Widerstände des Klienten anpasst und der Therapeut immer dann die Strategie ändert, wenn es schwierig wird: das wäre Synkretismus.
differentielle
Musiktherapie
Die Musiktherapie sorgt bei aller Anwendung verschiedenartiger Techniken gleichzeitig für eine einheitliche Grundlegung. Deswegen könnte man sie nach von Quekelberghe (1979) auch als „differentiell“ bezeichnen, in dem Sinne, dass sie dem Unterschied zwischen Störungen, Klienten, Therapeuten, Techniken, Therapiezielen etc. Rechnung trägt (Oberegelsbacher 1999, 48).
psychotherapeu-tische Techniken
Musiktherapeutisch Tätige beobachten und prüfen, welche psychotherapeutischen Theorien und Techniken sich auf welche Weise mit musiktherapeutischem Handeln verbinden lassen, wie mit dem Medium Musik eigenständige Vorgehensweisen im großen psychotherapeutischen Kontext entstehen und wie wir darüber hinaus durch musiktherapeutische Praxis und Forschung die Psychotherapie insgesamt bereichern können.
situationsgerechte
Modifizierungen
Musiktherapie verstehen wir als ein psychotherapeutisches Verfahren, dem ein auf das Medium Musik bezogenes reichhaltiges methodisches Repertoire zur Verfügung steht. Aus diesem schöpft sie situationsadäquat und modifiziert es und erforscht und entwickelt dessen besondere Wirkungen weiter. Sie verfügt über spezifische Wirkelemente und Möglichkeiten, bio-psycho-soziale Probleme aufzudecken und zu bearbeiten.
Verortung von
Musiktherapie
Den Begriff „Praxeologie“ kann man nur klären, wenn man die Begriffsvielfalt (und -verwirrung) in der Psychotherapie überhaupt betrachtet. Musiktherapie als Sammelbegriff lässt sich eben verschiedenen theoretischen und praktischen Ebenen zuordnen (s. a. Fitzthum 1997, 212 f.; 2001, 38 f.).
Es gibt im Rahmen der musiktherapeutischen Tätigkeit Menschen, die sich eindeutig einer bestimmten Grundorientierung, einem Verfahren und einem oder mehreren dazu passenden Methoden zuordnen. Allerdings sind Musiktherapeuten heute im Hinblick auf eine solche Bindung immer weniger ausschließlich und zunehmend integrativ bzw. eklektisch, vor allem mit zunehmender Berufserfahrung.
Grundorientierung
Was die Grundorientierung anbetrifft, bietet die historische Entwicklung der Psychotherapie eine gute Orientierung. Sie beginnt mit der Entdeckung des Unbewussten und den sich daraus entwickelnden tiefenpsychologischen Schulen und Verfahren. Deren gemeinsamer Nenner ist die Erfahrung, dass der Mensch entscheidend durch die – vor allem frühen – Beziehungen zu Mutter und Vater sowie deren Verarbeitung geprägt ist. Die dabei sich bildenden Grundmuster wirken positiv oder negativ im späteren Lebensverlauf weiter.
Theoretische und praktische Ebenen der Musiktherapie
Grundorientierungen: tiefenpsychologisch, humanistisch, behavioral, systemisch
Verfahren: z. B. Psychoanalyse, Gestalt,
Psychodrama
Methoden: spezifizieren entsprechend dem Verfahren, also z. B. analytische Gruppentherapie, analytische Musiktherapie)
Techniken: Halten, Stützen, Nähren usw.
Praxeologie
Aus diesem ersten und grundlegenden tiefenpsychologischen Ansatz gehen die humanistischen Verfahren hervor, welche den Spiel-Raum der klassischen psychoanalytischen Behandlungstechnik – Liegen und Aussprechen, was einfällt – erweitern. Das aktive, leiborientierte und ausdrucksbezogene Handeln des Klienten wird als positives Element entwickelt. Die sich durch solche Angebote im Hier und Jetzt abbildenden alten Muster werden durch eben diese spezifischen Vorgehensweisen auch bearbeitet. Dies ist für die therapeutische Arbeit mit kreativen Medien, und mithin für die Musiktherapie, von besonderer Bedeutung.
Die lerntheoretischen oder behavioralen Ansätze der Verhaltenstherapie sind auch eher am Hier und Jetzt orientiert und wollen negative Konditionierungen durch Übung wandeln. Allerdings entsteht auch bei einem Verhaltenstraining eine therapeutische Beziehung mit all ihren Aspekten, selbst wenn diese hier nicht näher berücksichtigt werden. Gleichzeitig kann Üben ebenfalls auf tiefenpsychologischem Hintergrund basieren.
Das systemische Denken in der Psychotherapie ergänzt den dyadischen Ansatz der Tiefenpsychologie um den erweiterten Blick auf die ganze Familie als System. Systemische Therapien arbeiten mit verschiedenen Ansätzen und Vorgehensweisen (Näheres dazu s. Kap. 20.3.2).
Methode
Musiktherapie
Derzeit lässt sich Musiktherapie nach unserem Verständnis charakterisieren als eine Methode, deren Theoriebildung in Richtung auf die Etablierung als Verfahren geht. Die Praxis einer therapeutischen Arbeit mit musischen Elementen – mit Musikrezeption, Improvisation, Körperwahrnehmung, Atem- und Stimmarbeit, Bewegung usw. – ist in Einklang zu bringen mit den seit über 100 Jahren immer umfassender und differenzierter erforschten und beschriebenen Gesetzmäßigkeiten der Psyche, mit der Dynamik des Unbewussten und seinen intra- und interpersonellen Manifestationen.
Tabelle 6.1 zeigt rezeptive und aktive Möglichkeiten, aus denen sich das große Repertoire an musiktherapeutischen Vorgehensweisen speist. Der Behandlungsplan, aber auch der konkrete Augenblick, bestimmt die Entscheidung, was in welcher Form angeboten wird. Die Tabelle gibt einen kurzen Überblick über die Grundformen (nach Timmermann 2004, 95). Diese Vorgehensweisen bzw. Gruppen von Vorgehensweisen sind z. T. miteinander kombinierbar, z. B. mit leiborientierten und anderen künstlerisch-therapeutischen Vorgehensweisen (Ausdruckstherapie, Medientherapie, Integrative Therapie). Dies wird im weiteren Verlauf dieses Lehrbuchs anhand der praktischen Beispiele noch deutlicher werden.
Arten von
Therapiemusik
Tab. 6.1: Musiktherapeutische Vorgehensweisen (nach Timmermann 2004a, 95)
Bei rezeptiven Vorgehensweisen wird den Klienten traditionell Musik „life“ vom Therapeuten vorgespielt, wobei dieser in seltenen Fällen vielleicht einmal Stücke aus der Literatur wählt, in geeigneten Situationen ein Lied für den Klienten singt, meist aber für ihn mit Instrumenten und/oder Stimme Musik erfindet. In der modernen Musiktherapie können Musikstücke auch von Schallplatte bzw. anderen Tonträgern erklingen. In beiden Fällen wird im Allgemeinen anschließend über das Erlebte gesprochen, oder der Klient verbalisiert sein Erleben direkt während des Hörens. In den letzten 20 Jahren wird zunehmend das Spielen und Singen für den Klienten bzw. die Gruppe, das „Für-Spiel“ im Unterschied zum „Vor-Spiel“, vorgezogen. Dies ist eine gute Möglichkeit, etwas für den Klienten zu tun, für ihn zu spielen – i. S. einer Zuwendung oder auch Wunscherfüllung. Er erfährt hierbei, dass er von einer Bezugsperson etwas bekommt ohne Bedingungen und Gegenleistung. Dadurch wird an eine entwicklungspsychologisch sehr frühe Kindheitserfahrung angeknüpft.
rezeptives Angebot
„Für-Spiel“
Es wurde bereits dargelegt, dass es nicht um mechanistische, quasi „medikamentöse“ Musikwirkungen geht, sondern dass der Beziehungsaspekt eine herausragende Rolle spielt. So wird die Therapeutin den Klienten mit der dargebotenen Musik eher versuchen dort abzuholen, wo er sich stimmungsmäßig gerade befindet, anstatt zu versuchen, ihn voreilig „umzustimmen“.
Selbstverständlich gibt es musikalische Strukturen, die an sich eher aktivieren (ergotrope), und solche, die eher beruhigen (trophotrope). Ein Klient allerdings, der gar nicht beruhigt werden will, kann durch eine beruhigende Musik noch erregter werden, als er bereits ist – und sich gleichzeitig unverstanden und mit seinem Eigenen nicht beachtet fühlen.
ergotrope und
trophotrope
Musikstruktur
Relevant für die Therapie ist ferner die biografische Ebene, wenn sie durch die Zuordnung von Musik in bestimmte Lebensphasen und bewegende Ereignisse angesprochen wird. Andererseits wird durch Musik auch ein Erleben phantasierter innerer Gestaltungen, Tagträume usw. ausgelöst. Die biografischen Assoziationen haben nichts mit dem Charakter einer Musik zu tun, sondern damit, in welchen Lebensmomenten sie für den Hörenden eine Bedeutung hat. Dagegen können die ausgelösten inneren Bilder durchaus im Zusammenhang mit den musikalischen Inhalten stehen.
biografische
Assoziationen
Das Spielen für den Klienten kann auf einem selbst gewählten, evtl. situationsadäquaten Instrument geschehen. Die Improvisation bietet hierbei die beste Möglichkeit, das Atmosphärische und das atmosphärisch Notwendige zu erspüren, musikalisch auszudrücken und auf den Klienten zu reagieren (Beziehung!).
Beim „Für-Spiel“ sollte der Therapeut auf jedem Instrument seines Instrumentariums und vor allem auch mit der Stimme für den Patienten spielen bzw. singen können. Dabei ist sichere Einfachheit überzeugend. Entscheidend ist, dass hier nichts schwankt, so dass der Patient sich getragen und geschützt fühlen kann. In jedem Fall ist in unserer von Musikbeschallung überschwemmten Zeit eine Einstimmung wesentlich, die der Musikdarbietung vorausgeht und den Klienten durch einen Moment von Stille, durch die Fokussierung der Wahrnehmung auf seine seelische Befindlichkeit, auf Körper, Atem und Klang des Augenblicks auf das Hören vorbereitet.
Einstimmung
Bei aktiven Vorgehensweisen wird im Allgemeinen improvisiert. Im offenen Setting bietet man dem Klienten einen Frei-Raum an mit instrumentalem, stimmlichem und körperlichem Ausdruck, ohne dass irgendwelche Voraussetzungen musikalischer oder sonstiger Art erwartet werden. Die Musiktherapeutin begleitet ihn bei diesem improvisierten Ausdruck in einer Haltung offener, sich einfühlender Antwortbereitschaft, einem der Situation gemäßen Mitspiel: Agieren und Mitagieren sind hier positive Qualitäten des therapeutischen Settings (Abs 1989).
aktives Angebot
„Ausdruck“
Bei Menschen mit einer schwachen Ich-Struktur muss man Anhaltspunkte und klare Orientierungen setzen. Therapeutisch begründete Vorgaben, Themen und Spielregeln für die Improvisationen dienen als Übungsangebote auf der Beziehungsebene. Sie ermöglichen experimentelles Handeln in problematischen Bereichen oder das Aufgefangenwerden in einer persönlichen Krise. Themen wie „Porträt meiner Mutter“, „Mein Kinderzimmer“ usw. können zur Exploration eingesetzt werden. Sie vermitteln atmosphärische Eindrücke aus der Kindheit des Klienten, ermöglichen differenzielle musiktherapeutische Diagnostik und lösen gleichzeitig psychodynamische Prozesse aus.
Improvisationen
Die vorgestellten rezeptiven und aktiven Vorgehensweisen sind sich methodisch ergänzende Elemente der musiktherapeutischen Arbeit. Die Situation des jeweiligen Klienten bzw. in der Gruppe entscheidet, ob Musikhören oder Musikmachen angeboten wird. Ändert sich die Situation, können sich auch Vorgehensweisen ändern. Gezielte Angebote aus dem musiktherapeutischen Repertoire aktiver und rezeptiver Musiktherapie helfen ihm, neue Erfahrungs- und Verhaltensmöglichkeiten durch Probehandeln aufzubauen (s. Timmermann 1998).
Probehandeln
Die spezifischen aktiven und rezeptiven Vorgehensweisen der musiktherapeutischen Praxis finden ihr Pendant in den allgemeinen psychotherapeutischen Techniken.
musiktherapeu-tische Techniken
Musiktherapeutische Techniken wie Halten, Nähren, Stützen usw. (Storz 2000) sind weder abhängig vom spezifischen therapeutischen Kontext noch vom Therapeutischen überhaupt. Sie lassen sich durchaus z. B. in präventive, psychohygienische Zusammenhänge übertragen. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung auf eine Verständigung mit anderen psychotherapeutischen Verfahren und Methoden. Hierzu gibt es Ansätze bei Priestley (1982; 1983), Oberegelsbacher (1997b, 42 ff.), Storz (2000, 444 f.) und Fitzthum (2001, 38 f.), die im Folgenden systematisiert (nach Timmermann 2004a, 95 ff.) werden.
Psychotherapeutische Techniken
●Halten/Holding/Containing
●Stützen
●Nähren
●Spiegeln
●Konfrontieren/Provozieren
●Durcharbeiten
●Verbalisisieren/Deuten/Nonverbales Verdeutlichen
Wie konkretisiert sich dies nun in der Musiktherapie?
Halten/Holding/Containing: Diese Qualität meint ein entwicklungspsychologisch frühes Gefühl sicheren Gehaltenseins, das vor der Angst bewahrt, zu fallen oder zu zerfallen. Es kann im Klienten entstehen, wenn es gelingt, ein Setting zu schaffen, in dem er sich hingibt, sich ganz und gar einhüllen lässt in eine verlässliche klanglich-rhythmische Gestalt, wenn er sich getragen weiß vom Spiel des Therapeuten bzw. der von diesem angeleiteten Gruppe.
Dies kann mit sehr einfachen musikalischen Mitteln geschehen, und zwar sowohl im Rahmen von aktiven als auch von rezeptiven Vorgehensweisen. Spielt der Therapeut für den Klienten, ist es wesentlich, dass die Musik von einer inneren Sicherheit des Spielenden zeugt, also klar und verlässlich erklingt: ein Rhythmus, der ruhig einfach sein kann, aber an dem nichts „wackelt“ – ein voll fließendes Klangkontinuum, eine mit dem Herzen gesummte Melodie aus sich wiederholenden Motiven …
Bei aktiven Vorgehensweisen nutzt die Musiktherapie die tragende Wirkung der Musik im Dialog oder im Gruppenklang. Der Therapeut ist ein verlässlicher Spielpartner, der mit seiner Musik spürbare Präsenz und aufmerksame Zuwendung signalisiert. Fundierende Basslinien und Rhythmen oder auch repetitive melodische Muster geben dem Spiel des Klienten einen sicheren Rahmen, innerhalb dessen der Klient zu seinem eigenen Spiel finden kann. Auch eine improvisierende Gruppe als haltende, tragende, wiegende „gute Mutter“ kann diese Qualität im Klienten ermöglichen.
Stützen: Diese Qualität bezieht sich auf den entwicklungspsychologisch folgenden Schritt. Der Mensch ist schon dabei, eigene Schritte ins Leben zu gehen, er braucht aber noch eine stützende Begleitung, wie ein Kind, das noch nicht alleine gehen kann. Hier sind eher aktive Vorgehensweisen gefragt, die ähnlich sind wie beim Holding. Fundierende Rhythmen und Basslinien bieten Schutz, aber auch bestätigende Antworten auf musikalische Äußerungen und ermutigen, auf dem eigenen Weg voranzuschreiten. In der Gruppe kann sich der Klient z. B. „Helfer“ wählen, andere Gruppenteilnehmer, die er um sich herum sammelt. Sie stützen ihn musikalisch, damit er nicht allein damit ist, ein schwieriges Gefühl auszudrücken. Dies knüpft an das Setting traditioneller Heilungsrituale an (s. a. Kap. 10, Anthropologie), in denen die stützende Begleitung der Gemeinschaft eine wesentliche Rolle spielt. Verschiedenste Spielregeln und rituelle Inszenierungen können stützende Funktion haben. Sie konkretisieren sich an der jeweiligen Situation.
Nähren: Diese psychotherapeutische Technik wendet sich an das seelisch nach Beziehung hungernde innere Kind. Auch diese Technik kann musikalisch rezeptiv oder aktiv angewendet werden. Das Spezifische an der Musiktherapie ist, dass die Therapeutin direkt etwas für den Klienten tun kann. Sie kann (rezeptiv) für ihn spielen und singen, ihn mit „satten“, lebendigen Klängen „symbolisch füttern“ (Rudolf 1996, 19). In der aktiven Begegnung schwingt sich die Therapeutin auf ihn ein i. S. eines „tuning in“ des Säuglingsforschers Daniel Stern (1992). Dieser frühe, präverbale Mutter-Kind-Dialog über lautmalerisches Kommunizieren an den Wurzeln der Persönlichkeit ist lebenswichtige „seelische Nahrung“. Wenn bei frühen Persönlichkeitsstörungen Nachreifungsprozesse erforderlich sind, ist dies eine wichtige Indikation für eine musiktherapeutische Behandlung.
Spiegeln: Diese Technik dient der Stärkung des Klienten dadurch, dass er sich emotional wahrgenommen und dieser Beachtung wert fühlt. Gerade bei narzisstischen Störungen ist das Spiegelbild – dem Mythos entsprechend – von hervorragender Bedeutung. In der Einzeltherapie kann man rezeptiv z. B. für den Klienten eine Musik spielen, in der er seine eigene Stimmung wiederfindet, oder aktiv die musikalischen Äußerungen des Klienten so wiederholen, dass dieser seinen eigenen Gefühlsausdruck in ihnen wiedererkennt. Ein an diese Thematik anknüpfendes Angebot in Gruppen ist die Solo-Tutti-Improvisation, bei der ein Klient spielt, wie er sich gerade fühlt, und die Gruppe hört ihm dabei aufmerksam zu. Dann lauscht er selbst (wenn möglich mit geschlossenen Augen), während die Gruppe mit einem musikalischen Feedback antwortet.
Konfrontieren/Provozieren: Diese Technik bezieht sich auf die Qualität der Auseinandersetzung: mit problematischen Persönlichkeitsanteilen, entsprechenden Schwierigkeiten in Beziehungen, aggressiven Gefühlen usw. Für den Therapeuten ist neben einfühlsamem, unterstützendem Begleiten manchmal auch ein konfrontatives bis provokatives Vorgehen der Situation angemessen. Der Therapeut nimmt hier seine Gegenübertragungsgefühle ernst und macht sich in gewisser Weise zum Anwalt der verleugneten Teile des Klienten, indem er diese in sich spürt und ausdrückt.
Dabei darf er einerseits nicht die erforderliche therapeutische Abstinenz und den nötigen Überblick über die Situation aufgeben. Andererseits kann nur durch gefühlsmäßige Beteiligung im gemeinsamen Spiel der eigentliche emotionale Zustand aufgedeckt und bearbeitet werden. Auch dies ist wiederum ein Spezifikum der Musiktherapie, denn derartige Provokationen erlaubt wohl am ehesten die Spielebene, wo sich solche Grenzgänge eben „spielerisch“ gestalten können. In der Musik kann dies beispielsweise geschehen, indem der Therapeut den Klienten „stört“: bei Vermeidungsstrategien wie „harmonisierendem Geklimper“, musikalischen Stereotypien usw.
Durcharbeiten: Spezifisch musiktherapeutisch ist, dass klassische Behandlungstechniken in der beschriebenen musikalisch modifizierten Form auftreten. Dabei werden auch intellektuell retardierte Personen mit sprachlichen Beeinträchtigungen sowie Patienten mit strukturellen Ich-Störungen psychotherapeutisch behandelbar. Dagegen setzt die Technik des Durcharbeitens in der Psychoanalyse ein intaktes Ich sowie Einsichtsfähigkeit voraus (Oberegelsbacher 1997b, 48 f.).
Musiktherapie ermöglicht ein „Üben ohne zu üben“ (Schmölz 1985; 1988; o. J.), indem „gespielt“ wird. Es geht nicht um Programme, in denen verändertes Erleben und Verhalten trainiert wird, sondern die Angebote werden sorgfältig und einfühlsam auf den individuellen Prozess des Klienten abgestimmt. Man könnte von einem „tiefenpsychologischen Üben“ sprechen, bei dem Wandlungsprozesse im geschützten Rahmen probehandelnd vollzogen werden können. An anderer Stelle (Timmermann 1994, 151 ff.) wurde der musiktherapeutische Prozess in vier Phasen beschrieben, die zeitlich natürlich nicht streng getrennt werden können, sondern sich durchmischen: Erleben – Erkennen – Üben – Wandeln. Die Veränderung in Richtung mehr seelische Gesundheit wird in der therapeutischen Situation selbst durch experimentelles Handeln gestärkt, in der musikalischen Interaktion also, die lebendig vorbereitet auf das Handeln im alltäglichen Leben. Ein solcher Prozess vollzieht sich im Rahmen von mehreren, manchmal vielen Stunden, in denen sich die Dinge wiederholen und allmählich verändern dürfen.
Verbalisisieren/Deuten/Musikalisches Verdeutlichen: In der Musiktherapie kann verbal, nonverbal sowie im Wechsel von beidem aufgearbeitet werden. Nonverbal steht hier das gesamte Repertoire rezeptiver und aktiver Vorgehensweisen zur Verfügung. Auf der Gesprächsebene kann man die Choreografie des nonverbalen Dialoges beschreiben und mit dem alltäglichen Beziehungsgeschehen vergleichen. Außerdem kann man weitere musikalische Aktionen vereinbaren. Die Bearbeitung von Konflikten kann auch in der Musik selbst stattfinden. Die entsprechenden Gefühle auszudrücken muss oft mühsam wiedererlernt und d. h. eben auch „tiefenpsychologisch geübt“ werden.
In verbalen Formen von Psychotherapie steht bei der Bearbeitung der auftauchenden Problematik das Wort, die Sprache im Vordergrund, während gleichzeitig im Hintergrund andere Kräfte intensiv mitwirken. Diese haben einerseits zu tun mit dem Atmosphärischen, mit Stimmung, Schwingung, Resonanz, Rhythmen usw. sowie mit den Botschaften jenseits des semantischen Gehaltes von gesprochenen Worten, den sog. paralinguistischen oder außersprachlichen Elementen des Sprechens: Stimmklang, Tonhöhe, Lautstärke, Sprachrhythmen sowie Gestik, Mimik, Körperhaltungen, -bewegungen, -reaktionen (s. Nitschke 1984; Timmermann 2004a). Auch die präverbale Bedeutung des Rhythmus von Sprechen und Schweigen im therapeutischen Gespräch wurde bereits untersucht (Kächele et al. 1973). Dazu kommen eine Fülle von Faktoren, die in der gesamten Haltung des Therapeuten wurzeln und im Bündnis mit dem Klienten eine heilsame Beziehung begründen können.
Diese Beispiele sollen verdeutlichen, wie psychotherapeutische Techniken in einer die Grundorientierungen, Verfahren und Methoden überschreitenden bzw. übergreifenden Weise und bezogen auf das spezifische Medium Musik in der therapeutischen Situation zur Wirkung gebracht werden können.
Die Praxeologie zeigt, dass musiktherapeutisches Handeln gleichermaßen von Wissen und Intuition getragen ist und auf beiden Ebenen vom Musiktherapeuten umfassende Fähigkeiten verlangt.
Wissen und
Intuition
Timmermann, T. (1998): Rezeptive und aktive Musiktherapie in der Praxis. In: Kraus, W. (Hrsg.): Die Heilkraft der Musik. C. H. Beck, München, 50–66
Timmermann, T. (2004): Tiefenpsychologisch orientierte Musiktherapie. Bausteine für eine Lehre. Reichert, Wiesbaden