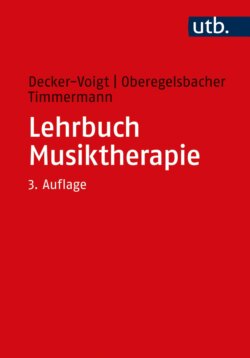Читать книгу Lehrbuch Musiktherapie - Tonius Timmermann - Страница 17
Оглавление9Das Wort in der Musiktherapie
von Tonius Timmermann
„Sie konnte so zuhören, dass ratlose und unentschlossene Leute auf
einmal ganz genau wussten, was sie wollten. Oder dass Schüchterne
sich plötzlich frei und mutig fühlten. Oder dass Unglückliche und
Bedrückte zuversichtlich und froh wurden. Und wenn jemand meinte, sein Leben sei ganz verfehlt und bedeutungslos und er selbst nur
irgendeiner unter Millionen, einer, auf den es überhaupt nicht ankommt und der ebenso schnell ersetzt werden kann wie ein kaputter Topf – und er ging hin und erzählte das alles der kleinen Momo, dann wurde ihm, noch während er redete, auf geheimnisvolle Weise klar, dass er sich gründlich irrte, dass es ihn, genau so wie er war, unter allen Menschen nur ein einziges Mal gab, und dass er deshalb auf seine besondere Weise für die Welt wichtig war. So konnte Momo zuhören!“
(aus „Momo“ von Michael Ende)
Seinserfahrung ist zunächst einmal nicht an Sprache gebunden. Sprache drückt das aus, was auch jenseits von ihr existiert. Das Wort als Zeichen weist auf etwas hin, was über das Zeichen hinausgeht. Das Bezeichnen, Benennen eines Phänomens bewirkt, dass es weniger mächtig und unheimlich wird. Das ist Sprach-Magie: Sie bannt Gefahr.
Wissenschaftlich ist Sprache ein semiotisches System (Semiotik ist die Lehre von den Zeichen), für den Menschen und seine Entwicklung sicher das Wichtigste. Der Mensch verfügt über die Möglichkeit, Seinserfahrung mit Hilfe von Worten zu bezeichnen (Zeichen), zu beschreiben und zu kommunizieren. Akustische Semiotik umfasst neben der Musik die gesprochene Sprache incl. der paralinguistischen (nicht semantischen) Faktoren. Dies sind:
Sprache als
semiotisches
System
●Stimmklang
●Tonhöhe
●Lautstärke
●Sprachrhythmen
●Gestik
●Mimik
●Körperhaltungen, -bewegungen, -äußerungen
paralinguistische
Faktoren
In Form bestimmter paralinguistischer Faktoren hat Sprache also auch musikalische Anteile, hat Rhythmen, Melodien, Pausen – und Wirkkraft allein aufgrund dieses nicht kognitiven Wahrnehmens, den prä- und transverbalen Ebenen von Sprache als Ganzes. Diese Aspekte sind von großer Bedeutung für die Therapie und sollten während einer Therapeutenausbildung bewusst gemacht und geübt werden. Hier eröffnet sich ein interessantes Forschungsgebiet für die Musiktherapie.
musikalische
Anteile von
Sprache
Das Repräsentationssystem der Sprache entspricht anderen wie Denken, Sehen, Bewegung, Musik usw., da es dem gleichen Nervensystem entstammt und die gleichen Strukturprinzipien wirken. Die von den Linguisten identifizierten formalen Prinzipien der Sprache bieten einen expliziten Ansatz zum Verständnis jedes Systems menschlicher Gestaltung. Hier geht es um Sprache.
Der amerikanische Linguist Whorf (1964) bezeichnet Musik als eine spezielle Form der Sprache, da sie gleicher Abstammung wie die Wortsprache sei und den gleichen, im universellen Sinne grundlegenden Strukturschemata entspringe. Man könnte auch sagen: Musik und andere Formen der Künste sind Ausdruck einer universellen oder archetypischen Struktur von Systemen, die in symbolisierter Form Mitteilung und Austausch ermöglichen. Dann kann man die verschiedenen künstlerischen Ausdrucksformen als „nichtlinguistisches Sprechen“ auffassen. Sie können sich auf seelische Schichten beziehen, die jenseits des semantischen Gehaltes von Sprache liegen. Die sprachlichen oder verbalen Anteile in der Musiktherapie sind von mehr oder weniger Bedeutung für den einzelnen Patienten, je nachdem
Musiksprache
●wie sprachfähig er ist (allgemein intellektuell, krankheits-/behinderungsbedingt),
●wie bedeutsam Sprache für die Behandlung ist (z. B. frühe Störung).
Es ist auch bedeutsam, auf welcher Ebene der Patient symbolisiert, ob sich sein Unbewusstes über gestalterische Prozesse ausdrückt oder ob er diese Impulse bewusst in Sprache formulieren kann. Dabei ist übrigens umstritten, dass Symbolisierungsfähigkeit von der Sprachfähigkeit abhängt. Die Fähigkeit, Wesentliches akustisch, visuell oder haptisch-gestisch-mimisch zu symbolisieren, sollte man nicht geringer achten.
Fähigkeit zu
Symbolisierung
Für die Musiktherapeutin ist wichtig, dass Musik eine Sprache ist, in der Ausdruck und Kommunikation auf bestimmten Ebenen sehr gut möglich ist. So erreicht sie auch Menschen, die noch nicht oder überhaupt nicht Sprache erworben haben oder die Sprachverlust erlitten durch Krankheit oder Alter. Zum Handwerk des Musiktherapeuten gehört, dass er mit Sprache im therapeutischen Kontext umgehen kann. Dazu muss er grundsätzlich zwei Formen des Umgangs mit Sprache üben:
Aufgaben der
Sprache
1.Die Anleitung zu aktiven und rezeptiven Angeboten.
2.Das therapeutische Gespräch.
In der rezeptiven Musiktherapie geht es darum, Angebote zu Körperposition, zu Körper- und Atemwahrnehmung, zum Hören zu machen. In der aktiven Musiktherapie wird zum Improvisieren eingeladen, werden Spielregeln angeboten usw. Diese Angebote auf eine Art und Weise zu formulieren und vom Stimmklang her zu gestalten, dass der Patient sich eingeladen fühlt, dass er Vertrauen entwickelt und sich einlässt auf das Geschehen und Erleben, ist die Kunst der sprachlichen Vorbereitung in der Musiktherapie.
Anleitung, Einführung
Das andere ist die Gesprächführung nach den Angeboten, bei Erstbegegnung, Abschied usw. Hier kann die Musiktherapie aus einem Fundus schöpfen, den PsychotherapeutInnen, die vorwiegend mit Sprache arbeiten, im Laufe vieler Jahrzehnte gesammelt haben. Das therapeutische Gespräch erfüllt zunächst drei Funktionen:
therapeutisches
Gespräch
●Informationssammlung, spez. Anamnese,
●Exploration der Persönlichkeit des Klienten,
●Mittel zur Persönlichkeitsänderung.
In der Gesprächstherapie nach Rogers (s. Weber 2006) werden indirekte Fragen bevorzugt wie: „Ich frage mich, wie Sie das gefühlsmäßig erleben?“ „Ich halte es für wichtig herauszufinden, was Ihr Herz (Körper) dazu sagt?“ „Ich nehme an, dass hinter oder unter Ihrer Aussage ein bestimmtes Gefühl steht?“ Andererseits definiert diese Richtung einen Katalog von sog. Lastern in der Gesprächsführung wie Dirigieren, Debattieren, Dogmatisieren, Diagnostizieren usw.
Man spricht aber auch vom „Hören mit dem dritten Ohr“, wenn der Therapeut über die verbale Mitteilung hinaus auf das hört, was der Klient noch von sich mitteilt, also wenn er in seine Wahrnehmung die paralinguistischen Faktoren einbezieht. Momos „Zuhören“, eingangs zitiert, bedeutet in der Therapeutenrolle: „ganz Ohr sein“. Dies geschieht nicht nur mit den Ohren, sondern auch durch Sehen und Fühlen. Ich möchte möglichst viel wahrnehmen, z. B. auch die Angst, die während einer Pause entsteht, oder die Hemmung, etwas Peinliches auszusprechen. Diese besondere Zuwendung erleben viele Patienten als heilsam. Es wird ein Raum geschaffen, in dem der Patient sich erleben, ausdrücken und austauschen kann.
Sprache in den
Musiktherapien
Wie wird Sprache in der Musiktherapie nun von den verschiedenen Richtungen und Schulen gesehen. Ulrike Mönter (2002) befasste sich mit dieser Frage und kam zu folgenden Ergebnis-sen:
●Anthroposophische Musiktherapie: Hier gilt die Musik selbst als das Heilmittel. Daher wird das Gespräch kaum erwähnt. Es werden erklärende, strukturierende und konkret beratende musikalische Handlungsanweisungen gegeben. Deren spezifische Wirkungen werden anschließend besprochen. Mit anderen Worten: Es geht im Gespräch weniger um den Beziehungsaspekt als vielmehr um Informationsaustausch, Mitteilung, Aufforderung und Handlungsanweisung.
Übermittlung
von Information
●Nordoff/Robbins: Diese Therapieform geht davon aus, dass Musik keiner Übersetzung bedarf, da sie ihren Sinn unmittelbar offenbart und als Phänomen zu ihrer eigenen Erklärung wird. Daher wird rein musikalisch, ohne verbale Aufarbeitung des musikalischen Prozesses gearbeitet. Wenn gesprochen wird, dann in Form einer sachlichen Auseinandersetzung über die Musik bzw. als Handlungsanweisungen, Bestätigungen und Beschreibungen der Musik.
sachliche Musikbeschreibung
●Regulative Musiktherapie (Schwabe): Das Gespräch hat hier die Funktion der immer gezielter werdenden Anregung zur Wahrnehmung und Wahrnehmungsdifferenzierung, ohne dass diese interpretiert oder in Richtung Ursachenzusammenhang hinterfragt werden. Das Gespräch beinhaltet: konkrete Handlungsanweisung, deren anschließende Beschreibung, Fokussierung auf die Wahrnehmung im Hier und Jetzt.
Differenzierung
von Wahrnehmung
●Integrative Musiktherapie: Das Gespräch ist geprägt von der Gestalttherapie. Es hat vor allem die Funktion, das Erlebte zu benennen, u. a. um nicht von Gefühlen überflutet zu werden und um die Fähigkeit zu erwerben, sich auch außerhalb der Therapie verbal angemessen verständigen zu können. Die Gesprächsinhalte beziehen sich besonders auf das Erleben im Hier und Jetzt. Erst soll das Gefühl und dann Erkenntnis oder Einsicht zum Thema gemacht werden. Beziehung und Kontakt sind wesentlicher Aspekt der verbalen Kommunikation, Übertragung und Deutung finden sich vereinzelt. Viele Gestaltübungen setzen längere Handlungsanweisungen voraus.
Benennen von
Erleben und
Beziehung
●Tiefenpsychologisch orientierte Musiktherapie: Diese musiktherapeutische Schule, zu der auch die psychoanalytisch orientierten Formen gehören, ist am weitesten verbreitetet (ca. 80%). Der Beziehungsaspekt steht klar im Vordergrund. Die Beziehung wird aus gegebenen Gründen über das Medium Musik gestaltet. Dieses Medium soll einen erlebnisorientierten Zugang zum Unbewussten ermöglichen. Sprache soll nicht nur die musikalischen Phänomene beschreiben, sondern vor allem das dabei Erlebte in Worte fassen. Dann kann es in Beziehung gesetzt werden zur Lebensgeschichte und aktuellen Lebenssituation. Daraus ergeben sich nunmehr naheliegende musiktherapeutische Angebote, die den Prozess weiterführen können. In der tiefenpsychologisch orientierten Musiktherapie spielen zwei Faktoren eine wichtige Rolle:
Benennung von
hier und jetzt, dort und damals
–phänomenologisches Beschreiben von Wahrnehmung und
–Deutung der sich inszenierenden Phänomene.
Beschreibung
von inszenierten
Phänomenen
Die phänomenologische Haltung bedeutet, dass man geschehen lässt, was sich inszenieren möchte, und das Geschehene an sich wirken lässt. Die verbale Beschreibung bedeutet: Man lässt den Patienten beschreiben, was er wahrnimmt, und beschreibt als Therapeutin, was man wahrnimmt. Dieser Vorgang hebt das Geschehnis ins Bewusstsein des Patienten und auch die Unterschiede in der Wahrnehmung.
Deutung von
inszenierten
Phänomenen
Noch einmal ein anderer Schritt, der wohlüberlegt sein will, ist die Deutung des Geschehens, der Inszenierung – vor dem Hintergrund dessen, was man bereits über den Patienten weiß. Der Therapeut als von außen auf die Person des Patienten schauender und abstinenter Partner im Prozess kann leichter als der Patient selbst die leidstiftenden repetitiven Muster im Erleben und Verhalten erkennen. Als professioneller teilnehmender Beobachter im Prozess versteht er die oft komplexen und komplizierten unbewussten Symbolisierungen des Patienten leichter als dieser selbst. Natürlich ist es besser, wenn der Patient seinen Ausdruck und seine Gestaltungen selbst erkennt und versteht, aber vorsichtige Deutungen als Hinweise und Wegweiser sind auch wiederum besser als ein verhüllendes Schweigen.
Ein positives Schweigen dagegen ist von großem therapeutischen Wert. Es kann im Gespräch der Zeitraum sein für das innerliche Sicheinstimmen auf das Reden oder für das Nachwirkenlassen des Gesagten. Es kann aber auch problematisch sein (Angst, Ärger, Abwehr). Schweigen gehört zum Reden. Es begrenzt das Reden. Auch im Gespräch entstehende Pausen gehören dazu, sind Bestandteile des Gesprächs, die es formen und strukturieren. Stille ist die „große Grenze“ am Anfang und Schluss.
positives
Schweigen
Mönter, U. (2002): Das Gespräch in der Musiktherapie. Musiktherapeutische Umschau 23 (1), 5–21
Smetana, M. (2005): Stille in der Musiktherapie. In: Smetana, M., Heinze, S., Mössler, K. (Hrsg.): Stille, Sterben, Erwachen. Musiktherapie im Grenzbereich menschlicher Existenz. Wiener Beiträge zur Musiktherapie, Bd. 7 Edition Praesens, Wien, 9–111
Weber, W. (2019): Wege zum helfenden Gespräch. 15. Aufl. Ernst Reinhardt, München